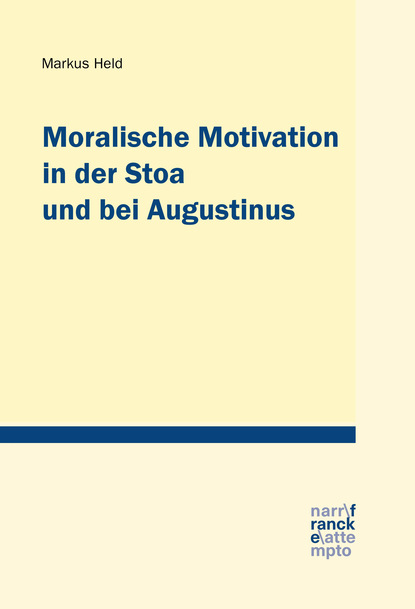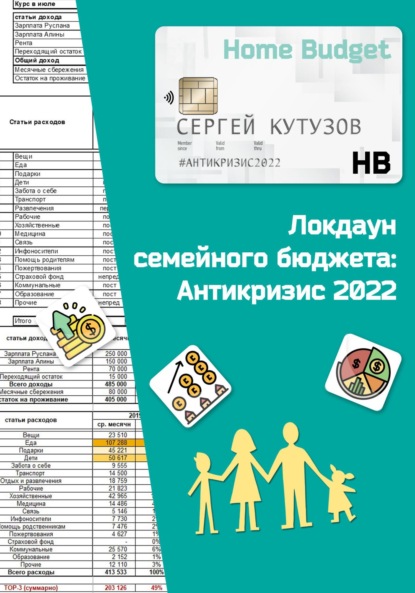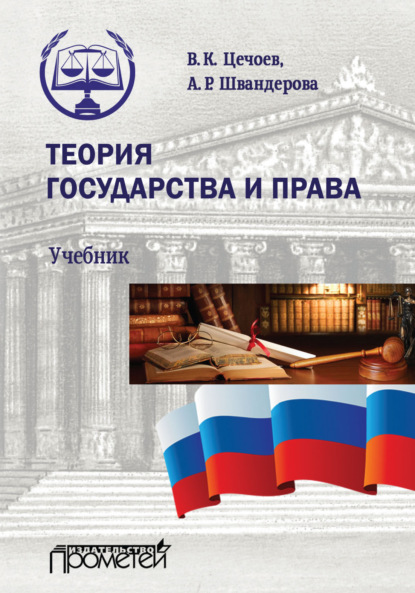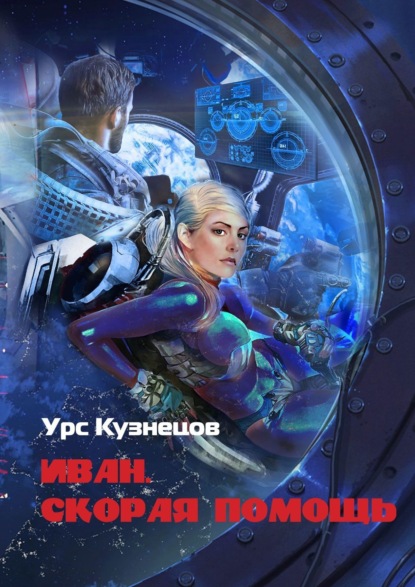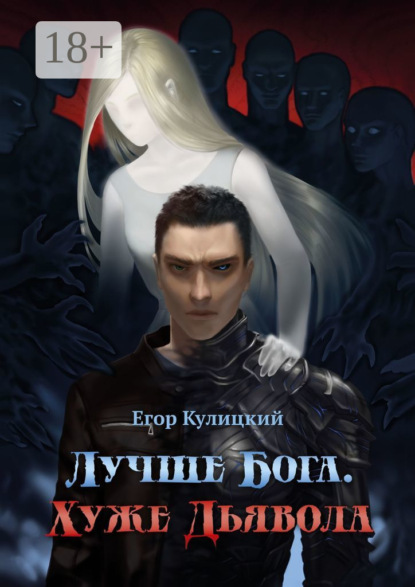Religionsbegründung ohne Erkenntnis Gottes
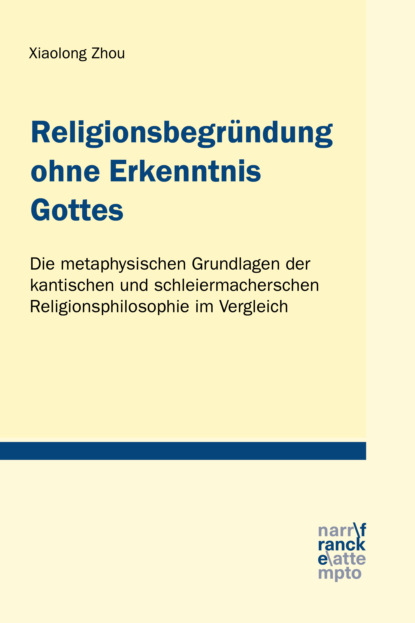
- -
- 100%
- +
Joseph Schmucker bringt zwei sehr subtile Kritikpunkte an Dieter Henrich vor: (1) Enthält das ens realissimum das Prädikat der Notwendigkeit? (2) Kann es sein, dass das Ideal des entis realissimi, das aus dem 2. Abschnitt des Theologie-Hauptstückes stammt, unmittelbar eine Umdeutung des Beweises im Beweisgrund aus der Perspektive der kritischen Philosophie ist? Im Folgenden möchte ich beide Punkte weiter verdeutlichen.
(1) Schmucker weist darauf hin, dass Kant im 2. Abschnitt des Theologie-Hauptstückes zeigt, dass das Ideal des entis realissimi als Urwesen ein „einiges, einfaches, allgenugsames, ewiges etc“13 ist. So kann scheinbar gesagt werden, dass das Prädikat der Notwendigkeit nicht darin enthalten ist. Aber was meint Kant hier mit „etc“? Schmucker denkt, dass die fehlenden Prädikate hier durch den Inhalt des 7. Abschnitts des Theologie-Hauptstückes ergänzt werden können. Darin behauptet Kant: „die Nothwendigkeit, die Unendlichkeit, die Einheit, das Dasein außer der Welt (nicht als Weltseele), die Ewigkeit ohne Bedingungen der Zeit, die Allgegenwart ohne Bedingungen des Raumes, die Allmacht etc. sind lauter transscendentale Prädicate.“14 Daher ist die Notwendigkeit auch in den Prädikaten dieses transzendentalen Ideals enthalten.15
(2) Schmucker hat zudem durch sein ausführliches und eingehendes Studium der vorkritischen Schriften Kants klar aufgewiesen, dass die kritische Perspektive der Paragraphen 1–15, nämlich das transzendentale Ideal, nur als subjektive Gültigkeit zu behandeln ist. Des Weiteren hat Schmucker darauf hingewiesen, dass dieses Ideal nicht eine Umdeutung des Beweises im Beweisgrund durch die kritische Philosophie ist, sondern das Ergebnis der kantischen Selbstreflexion zum Beweisgrund in der vorkritischen Periode, d.h. die Kritik innerhalb der Paragraphen 1–15 des Theologie-Hauptstückes ist das theoretische Ergebnis der vorkritischen Periode.16
Tatsächlich akzeptiert Dieter Henrich implizit die Methodologie von Klaus Reich, der behauptet, dass der Gottesbeweis im Beweisgrund dogmatisch ist und damit der Ableitungsprozess des entis realissimi in den Paragraphen 1–15 kritisch sei, so wie es im Untertitel seiner Arbeit von 1937, Ein Beitrag zum Verständnis des Verhältnisses von Dogmatismus und Kritizismus in der Metaphysik, impliziert ist.17 Joseph Schmucker weist weiter darauf hin, dass Kant das transzendentale Ideal bereits weit vor der kritischen Philosophie im Jahr 1769 als subjektive Gültigkeit betrachtet hat.18
Zum Punkt (1) ist es unmöglich, ein einfaches Urteil zu fällen, da es sich auf das ganze Denken Dieter Henrichs über Kants Gottesbeweis bezieht. Hier wird nur darauf hingewiesen, dass das Ideal des entis realissimi wegen seiner höchsten Realität die Notwendigkeit als Prädikat in sich enthält. Außer der KrV gibt es noch andere Texte, die beweisen können, dass die Notwendigkeit zu den Prädikaten des entis realissimi gehört.19 Die Debatte über die Notwendigkeit ist von großer Bedeutung, weil es sich um die Existenz Gottes handelt. Dieter Henrich scheint zu behaupten, dass es ein ontologischer Beweis sei, die Notwendigkeit als ein Prädikat des entis realissimi zu betrachten. Aber für Kant gilt dies nicht. Es gibt bei Kant viele verschiedene Bedeutungen von Notwendigkeit. Das wollen wir im folgenden Unterabschnitt 2.1.3 veranschaulichen. Punkt (2) betreffend, unterstütze ich den Standpunkt von Joseph Schmucker. Er untersucht, ausgehend von einer ausführlicheren Studie, den anhaltenden Einfluss der vorkritischen Zeit Kants auf dessen Gotteslehre in der KrV. Daraus kann gefolgert werden, dass Kants Denken in der KrV nicht gänzlich kritisch ist.
An dieser Stelle kann postuliert werden, dass die Kritik in den Paragraphen 1–15 als eine Selbstreflexion Kants zum Beweisgrund betrachtet werden muss. Diese Kritik erfolgt nicht gänzlich aus der Perspektive der kritischen Philosophie, die in den Paragraphen 16–18 ausgeführt wird. Um die Beschaffenheit der Notwendigkeit zu verstehen, soll nun dieser mehrdeutige Begriff diskutiert werden.
2.1.3 Verschiedene Bedeutungen von Notwendigkeit
Aus dem ebenen Gesagtem kann man ersehen, dass im Mittelpunkt der Debatte die Frage steht, ob das ens realissimum das Prädikat der Notwendigkeit besitzt. Die meisten Forscher stimmen zu, dass das ens realissimum nur eine subjektive Notwendigkeit hat. Da Kants Kritik am traditionellen ontologischen Beweis darin liegt, dass dieser ausgehend von der Idee des entis realissimi auf ein Wesen schließt, das notwendig existiert, lehnt Dieter Henrich die Notwendigkeit als das Prädikat des entis realissimi ab. Allerdings müssen wir die Bedeutungen von Notwendigkeit in der kantischen Philosophie sorgfältig unterscheiden. Ich vertrete die Auffassung, dass der Begriff der Notwendigkeit in Kants Philosophie wenigstens drei Bedeutungen hat: als subjektive, logische und existenzielle Notwendigkeit.
Zuerst diskutieren wir die logische Notwendigkeit. Sie bedeutet, dass das Prädikat logisch zum Subjekt gehören muss. Sie wird auch die Notwendigkeit des Urteils genannt. Im 4. Abschnitt des Theologie-Hauptstückes, d.h. in der Kritik am ontologischen Beweis, nimmt Kant die drei Ecken des Dreiecks als Beispiel und betont: „Die unbedingte Nothwendigkeit der Urtheile aber ist nicht eine absolute Nothwendigkeit der Sachen. Denn die absolute Nothwendigkeit des Urtheils ist nur eine bedingte Nothwendigkeit der Sache, oder des Prädicats im Urtheile. Der vorige Satz sagte nicht, daß drei Winkel schlechterdings nothwendig sind, sondern, unter der Bedingung, daß ein Triangel da ist (gegeben ist), sind auch drei Winkel (in ihm) nothwendiger Weise da.“1 Das heißt, diese logische Notwendigkeit beruht auf der Existenz des Subjekts. In diesem Fall verursacht die bloße Aufhebung des Prädikats einen Widerspruch. Wenn das Subjekt (Dreieck) und das Prädikat (drei Ecken) gemeinsam aufgehoben werden, entsteht jedoch kein Widerspruch.2 Das notwendige Dasein Gottes, das Kant erforschen möchte, ist offensichtlich keine logische Notwendigkeit. Im Beweisgrund weist Kant darauf hin: „Man kann indessen die Nothwendigkeit in den Prädicaten blos möglicher Begriffe die logische Nothwendigkeit nennen. Allein diejenige, deren Hauptgrund ich aufsuche, nämlich die des Daseins, ist die absolute Realnothwendigkeit.“3 Das bedeutet, dass die traditionelle rationale Theologie, die den ontologischen Beweis unterstützt (einschließlich Kant in seiner vorkritischen Zeit), die Notwendigkeit der Existenz Gottes beweisen wollen. Mit anderen Worten, der traditionelle ontologische Beweis möchte Gott die existenzielle Notwendigkeit zuschreiben. Aufgrund dessen leugnet Dieter Henrich die Notwendigkeit als das Prädikat des entis realissimi. Genau dies entspricht der kantischen Meinung jedoch nicht. Die Notwendigkeit gehört offensichtlich zu den Prädikaten des entis realissimi. Diese Notwendigkeit ist aber weder eine logische noch eine existenzielle, sondern eine subjektive Notwendigkeit. Kant möchte aussagen, dass das Ideal des entis realissimi nur die subjektive Notwendigkeit enthält. So behauptet Knudsen: „Zu dem Zweck muß er zeigen, daß die vom Rationalismus behauptete Bestimmtheit des göttlichen Wesens als ein notwendiges und metaphysisch objektives Sein nur den Seinssinn einer auf die Vernunft bezogenen Idealität haben kann.“4
Die subjektive Notwendigkeit ist eigentlich eine Notwendigkeit des Denkens, das heißt, es ist notwendig, dieses Ideal als Voraussetzung anzusehen, um die wirkliche Welt besser zu verstehen. Mit anderen Worten, das ens realissimum ist notwendig, insofern es ein regulatives Prinzip der Vernunft ist. Obwohl wir die Existenz des entis realissimi nicht voraussetzen oder nicht garantieren, ist dieses Ideal für uns unabdingbar, um die Welt zu klären, wie Kant im 2. Abschnitt des Theologie-Hauptstückes gesagt hat: „um ein Ding vollständig zu erkennen, muß man alles Mögliche erkennen und es dadurch, es sei bejahend oder verneinend, bestimmen.“5 Dies ist die Rolle, die das Ideal des entis realissimi spielt. Wie bereits erwähnt, haben Joseph Schmucker und Giovanni B. Sala behauptet, dass diese Schlussfolgerung von Kant bereits in der vorkritischen Periode gezogen worden ist. So sagt Kant beispielsweise in der Reflexion: „Alle Große Eigenschaften, die ich von Gott aus der willkührlichen Idee desselben sage, sind nur expositionen der hypothesis, die ich annehme.“6
So erschließt sich, dass das ens realissimum nur eine subjektive Notwendigkeit hat. Auch wenn hier behauptet wird, dass die Notwendigkeit zu den Prädikaten des entis realissimi gehört, sind wir nicht der Ansicht, dass das ens realissimum notwendigerweise existiert. Es ist nur eine Notwendigkeit in Bezug auf das Denken, wie Kant sagt: „Nehme ich nun das Subjekt (Gott) mit allen seinen Prädikaten (worunter auch die Allmacht gehört) zusammen, und sage: Gott ist, oder es ist ein Gott; so setzte ich kein neues Prädikat zum Begriffe von Gott, sondern nur das Subjekt an sich, mit allen seinen Prädikaten, und zwar den Gegenstand in Beziehung auf meinen Begriff.“7
Zusammenfassung. Diese Untersuchung behauptet, dass es im Abschnitt 2 des Theologie-Hauptstückes zwei unterschiedliche Kritiken gibt, die gegen die Realisierung, Hypostasierung und Personifizierung des entis realissimi gerichtet sind: die Kritik in den Paragraphen 1–15 und in den Paragraphen 16–18. Die erste Kritik ist von der Selbstreflexion Kants in der vorkritischen Periode abgeleitet. Deshalb wird das ens realissimum als subjektive Gültigkeit oder Notwendigkeit betrachtet. Die letztere aber rekonstruiert dieses Ideal aus der Perspektive der kritischen Philosophie und deckt eine Illusion auf, die durch das Weglassen der sinnlichen und empirischen Einschränkung entsteht und damit zu einer transzendentalen Subreption führt. Allgemein gesagt, ist die Existenz Gottes als entis realissimi nicht gesichert. Eine kleine Anmerkung dazu: Wir können die Existenz des entis realissimi weder festlegen noch verneinen, wie Kant behauptet: „Auf der andern Seite ist es aber auch aller menschlichen Vernunft unmöglich, je zu beweisen, daß eine solche Zusammensetzung aller Vollkommenheiten in Einem Dinge unmöglich sey; denn dazu gehörte wieder eine Einsicht in den Umfang aller Wirkungen des Alles der Realität, indem dieselben Gründe, durch welche das Unvermögen der Menschlichen Vernunft in Ansehung der Behauptung des Daseyns eines der gleichen Wesens vor Augen gelegt wird, nothwendig auch zureichen, um die Untauglichkeit einer jeden Gegenbehauptung zu beweisen. Kurz, es ist unmöglich zu beweisen, daß Gott unmöglich sey. Vielmehr legt mir die Vernunft auch nicht das mindeste Hinderniß in den Weg, die Möglichkeit eines Gottes, wenn ich auf andere Art mich dazu verbunden fühle, anzunehmen.“8
2.2 Die höchste Intelligenz und der symbolische Anthropomorphismus
Die höchste Intelligenz wird aus der geordneten sinnlichen Welt abgeleitet und Gott zuschrieben. Ob die Gewissheit der Existenz Gottes als archetypi intellectus garantiert werden kann, müssen wir genau untersuchen. In diesem Abschnitt wird über folgende Inhalte diskutiert: Kant unterscheidet zwischen an sich und für uns, diese Unterscheidung wird im Theologie-Hauptstück häufig erwähnt. In der KU definiert Kant diese Unterscheidung weiter als die zwischen κατ' αληθειαν (in Bezug auf die Wahrheit) und κατ' ανθρωπον (in Bezug auf den Menschen), d.h. was Gott an sich ist, ist uns unklar. Wir können nur behaupten, was Gott in Bezug auf die Welt ist1 (2.2.1). Bei der Behandlung von Gott als der höchsten Intelligenz hat Kant immer betont, dass Gott gedacht werden kann, als ob er der Grund der systematischen Einheit der Welt wäre. Die Frage ist nun, wie man das „als ob“ hier versteht. Anfang des 20. Jahrhunderts entwickelte Hans Vaihinger die sogenannte „Als-Ob-Philosophie“. Sie verbindet Kants Ideenlehre mit Nietzsches Gedanken, die Welt als Spiel vom Willen zur Macht zu betrachten.2 Ausgehend von dieser Philosophie hält Hans Vaihinger die Idee Gottes bei Kant für eine nützliche Fiktion, eine Fälschung und Selbsttäuschung. Vaihingers Gedanken über das „als ob“ entwickeln sich zu einer Religionsphilosophie bei Henrich Scholz.3 Allerdings widerspricht Erich Adickes Vaihingers Interpretation über Kants Lehre vom „als ob“. Adickes hält daran fest, dass das „als ob“ Ungewissheit bedeutet, und dass die Existenz Gottes als der höchsten Intelligenz nicht bejaht oder verneint werden kann.4 Die folgende Untersuchung wird diese Debatte kurz behandeln, um letztendlich mit der Interpretation von Adickes übereinzustimmen (2.2.2). Der Grund für diese Übereinstimmung liegt darin, dass Kants Religionsphilosophie schließlich eine Art des Anthropomorphismus, nämlich den symbolischen Anthropomorphismus, befürwortet. In den Prolegomena kritisiert Kant Hume aufgrund dessen, dass Hume in den Dialogues concerning Natural Religion (im Folgend als Dialogues bezeichnet) das menschliche Denken über Gott völlig ablehnt. Wir werden Kants Begründung dafür untersuchen (2.2.3).
2.2.1 Die Unterscheidung zwischen „an sich“ und „für uns“
In dieser Untersuchung wird argumentiert, dass eine der wichtigsten Ursachen für den Mangel an Gewissheit der Existenz Gottes darin besteht, dass Gott als die höchste Intelligenz nicht so genau festgelegt wird, wie man ein konkretes Objekt bestimmt, sondern nur gemäß der Beziehung zwischen Gott und der Welt. Wie in Abschnitt 1.3 dargestellt wurde, können wir durch die Methode der Analogie das vierte Glied an sich nicht bestimmen, sondern nur das Verhältnis zwischen dem vierten und dritten Glied erhalten. Im Anhang zur transzendentalen Dialektik betont Kant unermüdlich, dass wir nicht aussprechen können, was Gott an sich ist. Zur Verdeutlichung dienen folgende Beispiele:
„Denn daß wir ein der Idee correspondirendes Ding, ein Etwas oder wirkliches Wesen, setzen, dadurch ist nicht gesagt, wir wollten unsere Erkenntniß der Dinge mit transscendenten Begriffen erweitern; denn dieses Wesen wird nur in der Idee und nicht an sich selbst zum Grunde gelegt, mithin nur um die systematische Einheit auszudrücken, die uns zur Richtschnur des empirischen Gebrauchs der Vernunft dienen soll.“1
Über Gott als die höchste Intelligenz sagt Kant das Folgende:
„Auf solche Weise aber können wir doch (wird man fortfahren zufragen) einen einigen, weisen und allgewaltigen Welturheber annehmen? Ohne allen Zweifel; und nicht allein dies, sondern wir müssen einen solchen voraussetzen. Aber alsdann erweitern wir doch unsere Erkenntniß über das Feld möglicher Erfahrung? Keinesweges. Denn wir haben nur ein Etwas vorausgesetzt, wovon wir gar keinen Begriff haben, was es an sich selbst sei (einen bloß transscendentalen Gegenstand); aber in Beziehung auf die systematische und zweckmäßige Ordnung des Weltbaues, welche wir, wenn wir die Natur studiren, voraussetzen müssen, haben wir jenes uns unbekannte Wesen nur nach der Analogie mit einer Intelligenz (ein empirischer Begriff) gedacht, d.i. es in Ansehung der Zwecke und der Vollkommenheit, die sich auf demselben gründen, gerade mit den Eigenschaften begabt, die nach den Bedingungen unserer Vernunft den Grund einer solchen systematischen Einheit enthalten können. Diese Idee ist also respectiv auf den Weltgebrauch unserer Vernunft ganz gegründet.“2
In Von der Endabsicht der natürlichen Dialektik der menschlichen Vernunft findet man noch ähnliche Sätze, die ich hier nicht mehr zu zitieren brauche.3 Wie oben erwähnt, wurzelt die Unterscheidung zwischen an sich und für uns im Erkennen Gottes durch die Analogie. In der Formel G1 : F1 = G2 : F2 wird das Glied G2 nicht unmittelbar definiert, sondern durch die Beziehung zwischen G2 und F2, die ein Analogon der Beziehung zwischen G1 und F1 ist. In Bezug auf das Erkennen Gottes ist die höchste Intelligenz keine direkte Bestimmung Gottes, denn über das, was Gott an sich ist, haben wir kein Wissen. Der Grund, warum wir Gott die höchste Intelligenz nennen, liegt darin, dass die systematische Einheit der Welt es uns ermöglicht, ihn als die höchste Intelligenz zu bestimmen, so wie unsere menschliche Intelligenz den Grund der künstlichen Werke bildet. Daher ist Gott nicht an sich selbst die höchste Intelligenz, sondern für uns oder für die systematische Einheit der Welt, wie in den Prolegomena ausgeführt wird: „Vermittelst dieser Analogie bleibt doch ein für uns hinlänglich bestimmter Begriff von dem höchsten Wesen übrig, ob wir gleich alles weggelassen haben, was ihn schlechthin und an sich selbst bestimmen könnte; denn wir bestimmen ihn doch respectiv auf die Welt und mithin auf uns, und mehr ist uns auch nicht nöthig.“4 Diese Passage macht deutlich, dass die höchste Intelligenz nicht die Bestimmung von Gott an sich selbst ist. Außerdem hat Kant die obige Auffassung in der KU auf eine neue Weise zum Ausdruck gebracht:
„Ein Beweis aber, der auf Überzeugung angelegt ist, kann wiederum zwiefacher Art sein, entweder ein solcher, der, was der Gegenstand an sich sei, oder was er für uns (Menschen überhaupt) nach den uns nothwendigen Vernunftprincipien seiner Beurtheilung sei (ein Beweis κατ' αληθειαν oder κατ' ανθρωπον, das letztere Wort in allgemeiner Bedeutung für Menschen überhaupt genommen), ausmachen soll. Im ersteren Falle ist er auf hinreichende Principien für die bestimmende, im zweiten bloß für die reflectirende Urtheilskraft gegründet.“5
In dieser Passage ist die Analogie eng mit der reflektierenden Urteilskraft verbunden. Daher ist es Kant zufolge ein Beweis κατ' ανθρωπον bzw. in Bezug auf die Menschen, dass Gott die höchste Intelligenz hat. Das unterscheidet sich von der bestimmenden Urteilskraft, die das hinreichende Prinzip ist, um die Mannigfaltigkeit unter einen einheitlichen Begriff oder unter die Kategorien zu bringen. Die Analogie oder der Beweis κατ' ανθρωπον bezieht sich aber auf die reflektierende Urteilskraft, die die intellektuellen Eigenschaften Gott zuschreiben, um die systematische Einheit der Welt zu interpretieren. Wie Kant in Von dem regulativen Gebrauch der Ideen der reinen Vernunft der KrV sagt: „Die Einheit aller möglichen empirischen Verstandeshandlungen systematisch zu machen, ist ein Geschäfte der Vernunft, so wie der Verstand das Mannigfaltige der Erscheinungen durch Begriffe verknüpft und unter empirische Gesetze bringt.“6 D.h. Gott ist nicht ein sinnlicher Gegenstand, der von den Kategorien bestimmt wird, er bezieht sich immer auf die systematische Einheit der Welt. Damit wird die höchste Intelligenz immer respektiv auf die Welt Gott zugeschrieben.
Zusammenfassend kann durch die Unterscheidung zwischen an sich und für uns festgelegt werden, dass die höchste Intelligenz keine direkte Bestimmung von Gott als Ding an sich ist, so wie der Verstand seinen Gegenstand direkt bestimmt. Nur in Bezug auf Gottes Verhältnis zur Welt und zum Menschen kann Gott als die höchste Intelligenz betrachtet werden. Anders gesagt, die systematische Einheit der Welt als Folge erfordert die höchste Intelligenz als Grund. Was Gott an sich angeht, ist die Gewissheit seiner Existenz jedoch noch unbekannt.
2.2.2 Die Als-Ob-Philosophie und die Gewissheit der Existenz Gottes
Aus den obigen Schlussfolgerungen ergibt sich das folgende Problem: Wenn die Eigenschaft Gottes respektiv auf den Menschen oder in Bezug auf das Verhältnis zwischen der Welt und Gott übertragen wird, kann dann daraus erschlossen werden, dass Gott nur eine freie Schöpfung des Menschen ist? Dieses Problem hängt mit der häufigen Verwendung des Wortes als ob in Kants Philosophie zusammen. In Unterabschnitt 1.3.2 zitieren wir viele Absätze, in denen Kant durch die Analogie Gott als höchste Intelligenz betrachtet hat. Jeder Absatz enthält das Wort „als ob“, beispielsweise „als ob sie Anordnungen einer höchsten Vernunft wären“, oder „wir sind genöthigt, die Welt so anzusehen, als ob sie das Werk eines höchsten Verstandes und Willens sei.“ Neben der theoretischen Philosophie ist „als ob“ von Kant sehr häufig in den Bereichen der praktischen Philosophie, der Religionsphilosophie, der Ästhetik usw. angewendet worden.1 Die Frage ist nun, wie das „als ob“ verstanden werden kann. Hans Vaihingers Als-Ob-Philosophie repräsentiert eine Tendenz, Kants Gottesbegriff als eine heuristische Fiktion zu betrachten.
Des Weiteren deckt Hans Vaihingers Als-Ob-Philosophie, wie der Untertitel seines Buches andeutet,2 ein breites Themenspektrum ab, das die theoretische, die praktische und die Religionsphilosophie umfasst. Vaihinger glaubt, dass Kant ein Vorläufer der Als-Ob-Philosophie ist und dass der so von ihm interpretierte Kant der wahre Kant ist.3 Diese Untersuchung befasst sich mit der Verwendung der Als-Ob-Philosophie in der Religionsphilosophie. Anhand der Zusammenfassung von Heinrich Scholz können wir Vaihingers Konzept der Religionsphilosophie bzw. die Verwendung der Als-Ob-Philosophie in der Religionsphilosophie veranschaulichen:
„(1) Im Zentrum der Religion steht der Gottesglaube.
(2) Die empirische Religion versteht unter dem Gottesglauben den Glauben an das Dasein Gottes.
(3) Dieser Glaube ist sinnlos, denn es gibt keinen Gott.
(4) Die Aufhebung dieses Glaubens ist aber nicht gleichbedeutend mit der Aufhebung der Religion.
(5) Religion im Vollsinne des Wortes ist mehr als bloßer Gottesglaube; sie ist die Gestaltung des Lebens durch diesen Glauben. Die Lebensgestaltung ist gewissermaßen der Ausweis der Religion.
[…]
(7) Da nun von einer Wirklichkeit Gottes schlechterdings nicht die Rede sein kann, so muß der Gottesglaube als Glaube an ein imaginiertes höchstes Wesen definiert werden.“4
Für die Als-Ob-Philosophie existiert Gott daher nicht, und das menschliche Konzept von Gott ist etwas, das sich die Menschen vorstellen, und damit eine Fiktion der menschlichen Vernunft. Die Religion ist nur ein Glaube an die von den Menschen selbst geschaffene Idee Gottes. Ausgehend von einem solchem Fiktionalismus betrachtet Hans Vaihinger Gott bei Kant schlechthin als Fiktion der menschlichen Vernunft, denn Gott existiert tatsächlich nicht. Hans Vaihinger hat das „als ob“ in Kants Schriften eingehend untersucht: von den vorkritischen Schriften bis zum Opus Postumum, von der theoretischen Philosophie über die praktische Philosophie bis hin zur Religionsphilosophie. Er ist der Meinung, dass die wahre kritische Philosophie Kants die Als-Ob-Philosophie ist. Dies kommt an folgenden Stellen zum Ausdruck. Zum Beispiel zitiert Hans Vaihinger einen Satz aus dem Abschnitt Von der Endabsicht der natürlichen Dialektik der menschlichen Vernunft der KrV: „wir müssen alles, was nur immer in den Zusammenhang der möglichen Erfahrung gehören mag, so betrachten, als ob diese eine absolute.[…] Einheit ausmache, […] zugleich aber, als ob der Inbegriff aller Erscheinungen (die Sinnenwelt selbst) einen obersten […] Grund […] habe, nämlich eine gleichsam selbständige, ursprüngliche und schöpferische Vernunft, […] als ob die Gegenstände selbst aus jenem Urbilde aller Vernunft entsprungen wären.“5 Daraus erschließt Hans Vaihinger: „d.h. man dürfe sich dieser Begriffe als heuristischer Fiktion bedienen.“6 Die folgenden Absätze repräsentieren die typische Auffassung von Hans Vaihinger:
„Also ‚die Voraussetzung, dass eine höchste Intelligenz alles nach den weisesten Zwecken geordnet habe‘ usw. – alle diese Vorstellungen, welche doch ‚blosse Ideen‘ sind, will Kant auch als ‚Glaube‘ bezeichnen. Also in diesem Sinne, in diesem Zusammenhang ist Glaube so viel als die Annahme, als ob etwas wäre, was nicht wirklich ist und nicht wirklich sein kann. Nicht nur Kant nennt hier diese fiktiven Annahmen ‚Glauben‘—auch rückwärts aus der Geschichte der Religionen, speziell aus der Geschichte der Mystik, lässt sich durch viele Beweise erhärten, dass auch umgekehrt vielfach vielen Gläubigen ihre Glaubenswelt nur eine bewusste Selbsttäuschung, d.h. eben eine Welt von bewusster Fiktion war – und noch heute ist.“7