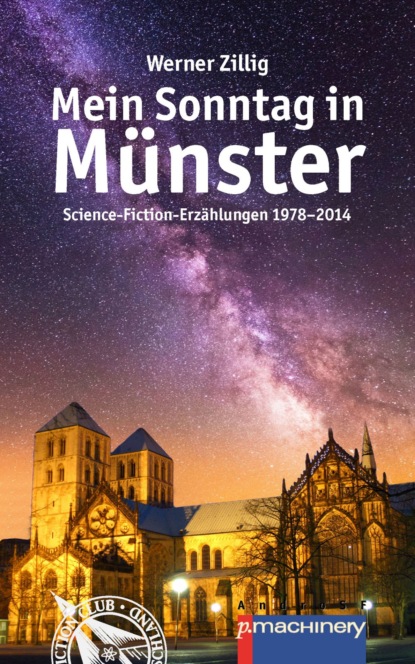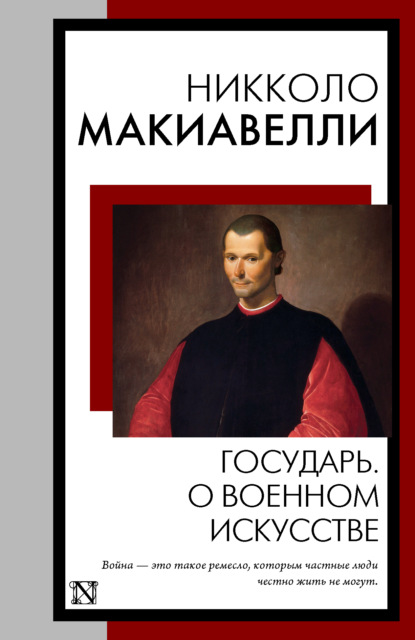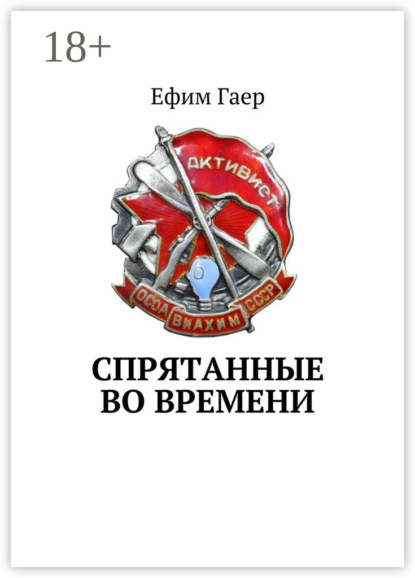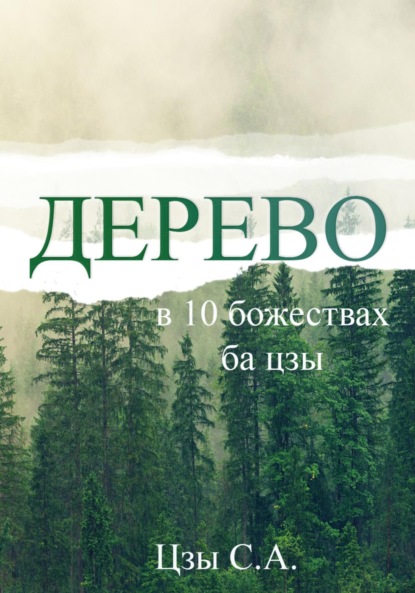Es fällt mir ein wenig schwer, von all dem zu erzählen. Aber dennoch – es ist so: Seit über zehn Jahren, seit ich in Münster lebe, treffe ich sie jeden Sonntag. In der Regel am Nachmittag, und sie ist, wie ich verlässlich weiß, von einem fremden Planeten. Ich erinnere mich: Vor einigen Jahren habe ich einmal gefragt: «Woher kommst du?» Damals habe ich gesagt: «Deine Heimat muss viele Lichtjahre von der Erde entfernt sein. Unsere Astronomen hätten sie sonst ja längst entdeckt.» Sie hat darauf nur geantwortet: «Mach' dir darüber keine Gedanken. Entfernung und Zeit, das sind irdische Begriffe. Für uns liegt die Erde sozusagen – direkt um die Ecke. Verstehst du?» (Mein Sonntag in Münster)
<br/>
Diese Zusammenstellung enthält alle Science-Fiction-Geschichten, die Werner Zillig zwischen 1978 und 2001 veröffentlicht hat. Und dazu eine für diesen Band geschriebene Erzählung, die den ›Sonntag in Münster‹ abschließt und erklärt.
- Книги
- Аудиокниги
- Вебтуны
- Жанры
- Cаморазвитие / личностный рост
- Зарубежная психология
- Попаданцы
- Боевая фантастика
- Современные детективы
- Любовное фэнтези
- Зарубежные детективы
- Современные любовные романы
- Боевое фэнтези
- Триллеры
- Современная русская литература
- Зарубежная деловая литература
- Космическая фантастика
- Современная зарубежная литература
- Все жанры
- Бесплатные книги
- Блог
- Серии
- Черновики
Вход В личный кабинетРегистрация