Von Dolomiten im Vorgarten und anderen Herausforderungen
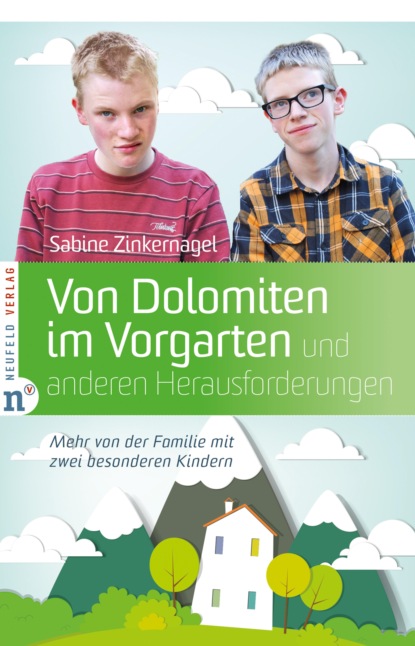
- -
- 100%
- +
Immerhin hat die Mutter sich nach reichlich Fürsprache des Vaters dazu überreden lassen, das vor kurzem noch so hilfsbedürftige, unselbstständige Kind in ihrem Auto Fahrpraxis sammeln zu lassen. Aber muss sie nun ängstlich darüber wachen, dass er auch ja keinen kilometerweit entfernt auf dem Radweg fahrenden Radfahrer übersieht? Muss sie vor jeder Kurve hörbar den Atem anhalten und sich panikartig an den Türgriff klammern? Muss sie ihn vor jeder Fahrt zur Vorsicht und zur Rücksicht auf ihre angstgestressten Nerven mahnen?
Man kann sich leicht ausmalen, dass zwischen dem gerade fahrtüchtig gewordenen Sohn und seiner beschützerinstinkt-geleiteten Mutter nur selten traute Harmonie herrscht. Auch wenn der Sohn irgendwann weitere Schritte ins Leben unternimmt und zu Hause auszieht, wird dieser Konflikt beide Seiten noch lange verfolgen. Die Mutter, die nun keinerlei Möglichkeiten mehr hat, auf ihren Sohn aufzupassen, und deren Fantasie sich darum umso schlimmere Bilder ausmalt, was diesem auf seinen Fahrten so alles zustoßen könnte. Und den Sohn, der auch ohne die mahnende Anwesenheit der Mutter weiter gegen deren unterschwelligen Vorwurf ankämpft, er könne nicht richtig Autofahren.
Was wäre besser dazu geeignet, diesen Verdacht endgültig aus der Welt zu schaffen, als eine hübsche junge Dame, die ihrem Helden am Steuer bewundernde Blicke zuwirft, während dieser seinen Ford Fiesta in James-Bond-Manier mit Tempo 120 lässig über die Autobahn steuert?
Es soll Fälle geben, in denen dieses Szenario Wirklichkeit wird.
Bei Martin und mir stimmten dafür von Anfang an einige Voraussetzungen nicht: Erstens besaß Martin gar kein Auto, als wir uns ineinander verliebten. Der Fiesta war meiner. Zweitens bin ich kein Bond-Girl. Nicht nur, weil ich weder Model-Maße noch Wimperntusche besitze. Sondern auch, weil ich im Physikunterricht zumindest soweit aufgepasst habe, dass ich eine Ahnung von Fliehkräften und Bremswegen habe.
Ich halte mich trotzdem für eine gute Beifahrerin.
Immerhin habe ich meinen Liebsten ohne Zögern ans Steuer meines Wagens gelassen. Ich weise ihn nicht auf rote Ampeln hin und gebe keine Tipps zur Bedienung der Gangschaltung.
Aber ich halte in der Regel meine Augen offen. Folglich sehe ich, dass drei Autos vor uns ein Bremslicht aufleuchtet. Oder dass der LKW etwa einen Kilometer vor uns auf der Autobahn den Blinker zum Überholen gesetzt hat. Ich weiß, dass ein solches Ereignis die nachfolgenden Autos zum Bremsen veranlassen wird, und dass die kollektive Bremsaktion irgendwann auch uns erreichen muss.
Trotzdem macht der durchaus sichere Fahrer links neben mir keinerlei Anstalten, seinen Fuß vom Gas- auf das Bremspedal umzusetzen.
Was liegt da näher, als selbst auf die Bremse zu treten?
Wohlgemerkt, als Beifahrerin.
Wir haben keinen Fahrschulwagen, also kann ich so oft und so heftig in das Bodenblech treten, wie ich will, das Auto wird seine Geschwindigkeit auch nicht im Geringsten verringern.
Das einzige, das sich ändert, ist die Laune des Fahrers. Muss ich so mit den Füßen herum zucken? Ja doch, natürlich hat er den ausscherenden LKW gesehen. Aber noch ist ja gar nicht sicher, ob auch wir deswegen bremsen müssen, dafür ist der LKW viel zu weit vor uns. Ob ich ihm nicht zutraue, dass er alles im Griff hat? Ob ich tatsächlich denke, er könne nicht sicher Autofahren?
Noch bevor Martin mit seinen vorwurfsvollen Fragen fertig ist, hat meine Laune sich der seinen angepasst.
Natürlich traue ich ihm zu, dass er uns beide heil an unser Ziel bringt. Aber das Auto dort vorne hat doch wirklich gebremst! Ob er da nicht wenigstens den Fuß vom Gaspedal nehmen könnte? Und außerdem hat er ganz offensichtlich vorhin das Tempo-100-Schild übersehen, sonst würde er nicht immer noch auf der Überholspur zusammen mit allen anderen Autos 120 fahren. Ob er vielleicht irgendwann gedenkt, nach rechts zu wechseln, um uns einen Strafzettel zu ersparen?
Nein, daran denkt der Mann am Steuer nicht. Schließlich gibt es hier weder eine Radarfalle noch einen Grund für die Geschwindigkeitsbeschränkung. Und ein Spurwechsel verzögert den Verkehrsfluss.
Er könnte auch den Zeitpunkt unseres ersten Unfalls verzögern, denke ich. Diese Überlegung behalte ich aber lieber für mich.
Und so schweigen wir uns in der folgenden halben Stunde sehr beredt an.
So lange, bis ich mich in einer engen Kurve am Türgriff festhalte. Für mich eine instinktive Reaktion, für Martin ein Zeichen von vollkommen unnötiger Angst. Das Auto wird schon nicht aus der Kurve fliegen! Ob ich immer noch nicht weiß, dass er fahren kann?
Natürlich weiß ich, dass Martin völlig sicher Auto fährt! Aber gerade eben war da diese Kurve …
Und prompt geht die ganze Diskussion, nur mit leicht abgewandeltem Thema, von vorne los.
So haben wir auf längeren Fahrten immer wieder gestritten und uns letztendlich schmollend angeschwiegen. So lange, bis Martin den entscheidenden Satz gesagt hat, der uns auf den tiefen Grund unserer regelmäßigen Verstimmungen geführt hat: „Du benimmst dich wie meine Mutter!“
Doch, ich schätze meine Schwiegermutter durchaus. Nur ist sie eben eine reichlich besorgte Beifahrerin. Und ihr mütterlicher Beschützerinstinkt ist besonders stark ausgeprägt. Wie schon gesagt, bei einem Kleinkind ist letzterer wichtig und notwendig. Aber auf einen achtzehnjährigen Fahranfänger trug die Kombination aus mütterlicher Angst und Sorge nicht gerade zu einer Steigerung seines Autofahrer-Selbstbewusstseins bei.
Und nun sitzt neben dem Fahranfänger von einst die ersehnte junge Dame. Aber die denkt gar nicht daran, sich in Bond-Girl-Manier völlig cool darauf zu verlassen, dass er alle Eventualitäten des Straßenverkehrs mit links meistern wird. Stattdessen denkt die Blondine auf dem Beifahrersitz mit drei oder vier Autos vor sich mit. Und reagiert auf deren Fahrweise schneller, als ihr Liebster am Steuer das tut. So greift sie eben manchmal nach dem Türgriff, zuckt instinktiv zusammen oder tritt auf eine nicht vorhandene Bremse. Für sie ist das überhaupt keine Kritik an seinem Fahrstil. Aber bei ihm kommt es so an. Weil ich mit meinem Zucken die gleiche Kerbe in den Gefühlen meines Liebsten treffe wie vor Jahren seine Mutter.
Als Martin und ich endlich auf die Gründe für unsere ungewöhnlich häufigen und heftigen Diskussionen beim Autofahren gestoßen sind, haben wir uns erst einmal betreten angeschaut. Denn was konnten wir schon tun, um derartige Szenen künftig zu vermeiden? Das Mitdenken und Mit-Reagieren als Beifahrerin war mir doch schon längst in Fleisch und Blut übergegangen! Das würde ich so einfach nicht ändern können, auch wenn ich jetzt um Martins Empfindlichkeit an diesem Punkt wusste. Und wie sollte Martin die tiefe Kerbe in seinem Inneren ignorieren, die von jeder ängstlichen Reaktion meinerseits noch ein wenig tiefer eingeschlagen wurde?
Es wurde tatsächlich eine lange Übungsphase für uns beide. Ein ums andere Mal musste ich mich bemühen, ruhig darauf zu vertrauen, dass Martin bremsbereit war, auch wenn ich davon nichts sehen konnte. Musste ich mich daran erinnern, dass er bisher immer noch rechtzeitig reagiert hat. Martin musste sich seinerseits ein ums andere Mal sagen, dass mein Tritt auf die imaginäre Bremse ihn weder als Autofahrer noch als Mensch herabwürdigte. Dass ich zwar in kritischen Situationen kurz zusammenzuckte, aber nicht in Panik verfallen würde.
Ganz abgeschlossen ist diese Übungsphase bis heute nicht. Wir müssen uns immer wieder gegenseitig an diese Wahrheiten erinnern. Aber immer seltener. Jedenfalls bekommt das Bodenblech vor dem Beifahrersitz wesentlich weniger Tritte ab. Und wenn ich in einer kritischen Situation hörbar die Luft anhalte, fragt Martin ohne vorwurfsvollen Unterton, ob ich mich unsicher fühle. Um dann notfalls das Tempo zu drosseln oder die zweite Hand ans Lenkrad zu nehmen.
James Bond und sein Mädchen auf dem Beifahrersitz besiegen auf ihren halsbrecherischen Autofahrten stets irgendwelche finsteren Bösewichte. Martin ist kein James Bond, und ich tauge nicht zu dessen Gespielin. Wir haben auch noch nie einen Gangsterboss aus dem Weg geräumt. Sondern nur einen Anlass zu unnötigem Streit. Aber das immerhin nicht nur im Film, sondern im ganz realen Leben. Also da, wo es wirklich von Bedeutung ist.
Diagnose
Oktober 1993
„Mami, Mami, was wäre dir lieber: Ein Loch in meinem Kopf oder ein Loch in meiner Hose?“
„Ein Loch in der Hose natürlich!“
„Na dann ist ja alles gut. Ich bin nämlich grade vom Baum gefallen und hab mir meine neue Hose zerrissen.“
Der Witz ist weder besonders neu noch sonderlich originell.
Aber manchmal ist er gar nicht so weit entfernt von der Realität.
Beispielsweise in den letzten Tagen für mich.
Ein neuer Abschnitt unseres Ehelebens steht an: Wir stecken mitten im Umzug nach Duisburg für Martins Vikariat. Ausgerechnet da meldet sich mein Körper zu Wort. Angefangen hat das Ganze vor einigen Wochen mit einem pelzigen, tauben Gefühl auf dem rechten Oberschenkel. Als die Stelle sich immer mehr wie dauerhaft eingeschlafene Füße anfühlte, bin ich doch zum Arzt gegangen. Der schickte mich gleich weiter zum Neurologen. Dieser wiederum zeichnete zielsicher mit dem Finger einen Bogen genau um die fragliche Stelle und wusste Bescheid: Da hatte sich ein Hautnerv eingeklemmt. Nicht weiter schlimm, der „entklemmt“ sich auch wieder. Der Neurologe behielt Recht, bald fühlte sich alles wieder ganz normal an. Als sich die Geschichte am linken Bein wiederholte, wusste ich ja schon Bescheid: Das „entklemmt“ sich wieder. Dem war auch so. Erst, als das taube Gefühl den rechten Unterschenkel im Griff hatte, wollte sich das „Entklemmen“ nicht mehr so schnell einstellen. Der Nerv verklemmte sich spürbar so weit, dass ich Probleme beim Laufen bekam. Also noch einmal zum Neurologen. Der zieht die Stirn kurz in Falten, dann greift er zum Telefon und fragt in einer Röntgenpraxis nach einem „MRT“-Termin für mich.
„Übermorgen Abend um halb zehn?“
„Geht nicht, da haben wir einen Termin in der Gemeinde, der ist dann bestimmt noch nicht zu Ende.“
Dem Arzt klappt die Kinnlade herunter. Allein die Uhrzeit, und spätestens der Gesichtsausdruck des Neurologen hätten mich stutzig machen müssen. Aber ich hatte bis dato ja keine Ahnung, was sich hinter den drei Buchstaben „MRT“ verbirgt, und dass es in ganz Wuppertal ein einziges ambulantes dieser High-Tech-Geräte gab.
„Andere Patienten warten monatelang auf einen Termin. Also, wollen Sie oder wollen Sie nicht?“
Doch, doch, natürlich will ich.
Und so schiebt mich eine Röntgenschwester zwei Tage später in eine enge Röhre. Es knackst und knattert von allen Seiten, ich halte brav meinen Kopf still und habe nach wie vor keine Ahnung, was die Ärzte da eigentlich suchen. Von dieser Ahnungslosigkeit hat wiederum der Radiologe keine Ahnung. Routinemäßig drückt er mir einen riesigen grünen Umschlag mit den Aufnahmen für den Neurologen in die Hand, schreibt einen kurzen Begleitbrief und teilt mir lapidar mit: „Für eine eindeutige Diagnose muss man das natürlich noch klinisch abklären. Aber für mich sieht es eindeutig nach Multipler Sklerose aus.“
Multiple Sklerose auf lateinisch, abgekürzt MS, auf deutsch Muskelschwund.
Über zwei Ecken weiß ich von einer jungen Frau, die seit ihrer Kindheit an Muskelschwund leidet. Sie sitzt inzwischen im Rollstuhl und wird ihren vierzigsten Geburtstag aller Voraussicht nach nicht mehr erleben. Habe ich eine andere Variante der Krankheit? Im Sommer noch bin ich auf der Jugendfreizeit in den französischen Alpen durch Wildbäche geklettert, immer in der Gruppe der Vordersten und Abenteuerlustigsten. Läuft die Krankheit bei mir also wesentlich langsamer ab? Oder ab jetzt besonders schnell? Im Grunde genommen ist das egal. Nach allem, was ich über Muskelschwund weiß, verliert irgendwann auch der Herzmuskel seine Kraft. Diese Krankheit ist tödlich. Immer.
Ein absolutes Ohnmachtsgefühl, wie es nach einer solchen Diagnose eigentlich normal wäre, will sich trotzdem nicht einstellen. Martin sitzt am folgenden Morgen wie erschlagen an meinem Bett. Da legt ihm jemand die Hand auf die Schulter und sagt leise: „Mach dir keine Sorgen, es wird alles gut.“ Außer seiner schlafenden Ehefrau und ihm selbst ist niemand in der Wohnung. Und trotzdem ist noch jemand da. Jemand, dessen Anwesenheit keine Überwachungskamera und kein Tonbandgerät registriert hätten. Jemand, der mit zwei Sätzen schwere Gedanken schneller und dauerhafter verscheuchen kann als jede Psychotherapie. Jemand, der mit einer simplen Berührung mehr Sicherheit und Zuversicht schenkt als eine ganze Armada von Ärzten.
Danke, Jesus.
Bei mir ist es eher eine Art Trotzreaktion, aus der heraus ich meinen Kolleginnen am Telefon verkünde: „Mag sein, ich überlebe euch alle.“
Es muss ja nur die U-Bahn entgleisen, in der sie zufällig sitzen.
Sie könnten auch bei Grün die Straße überqueren, während ein betrunkener Autofahrer seine rote Ampel übersieht.
Oder sie könnten sich Meningokokken einfangen.
Oder, oder, oder.
Wir können es drehen und wenden, wie wir wollen: Wir haben unser Leben nicht in der Hand. Irgendwie und irgendwann sterben wir alle.
Diese Erkenntnis ist weder besonders neu noch sonderlich originell.
Aber nie ist sie mir so nahe wie in diesen Tagen. Und wirkt dabei nicht einmal besonders brutal, sondern eher tröstlich: Ich bin nicht die einzige, die irgendwann sterben wird. Das wird allen anderen auch passieren.
Mag sein, dass diese Trotzreaktion in meinem Kopf mich erst einmal schützt vor allen weiteren grausigen Überlegungen, die Martin und ich jetzt eigentlich anstellen müssten. Ganz bestimmt wären diese bald unausweichlich geworden. Doch bevor es so weit kommt, schickt mir meine Mutter ein medizinisches Fachbuch über Multiple Sklerose. Interessiert lese ich, dass bei dieser Krankheit das eigene Immunsystem die Nervenbahnen angreift, dass diese Schübe mit Cortison gestoppt werden können. Dass die Krankheit bislang unheilbar ist, aber nicht unbedingt im Rollstuhl enden muss. Von Muskelschwäche, von Herzversagen, von tödlichem Ausgang lese ich nichts.
Und ganz allmählich dämmert es mir: „MS“ ist die Abkürzung für „Multiple Sklerose“. „Muskelschwund“ dagegen ist eine völlig andere Krankheit. Eine Krankheit, die ich nicht habe. Ich kann durchaus vierzig Jahre alt werden, vielleicht auch achtzig. Ich kann sogar Kinder bekommen.
Ich habe keinen Muskelschwund, sondern nur Multiple Sklerose.
Ich habe kein Loch im Kopf, sondern nur ein Loch in der Hose.
Der Witz ist wirklich nicht besonders originell. Aber plötzlich sehr real. Und er hat eine beglückende Pointe.
Weiterleben
Oktober 1993
Zur endgültigen Absicherung der Diagnose muss ich ins Krankenhaus. Während Martin den Umzug nach Duisburg alleine meistert, fahre ich im Rollstuhl zu verschiedenen weiteren Untersuchungen. Deren Ergebnis überrascht eigentlich niemanden mehr: Ja, ich habe wirklich Multiple Sklerose.
Was kann man dagegen machen? Bei akuten Schüben Cortisontabletten nehmen, Krankengymnastik, und sich generell nicht überlasten. Mehr Möglichkeiten, die bislang unheilbare Krankheit abzuschwächen, gibt es nicht.
Oder doch?
Von allen Seiten stürzen in den folgenden Wochen Ratschläge auf mich ein: Meine Schwiegermutter schickt einen Zeitungsartikel, der Fischölkapseln empfiehlt. Eine Nachbarin meiner Schwiegermutter leiht mir ein Buch, das die erstaunlichen Erfolge eines Verzichts auf tierische Produkte und alles Gekochte schildert. Eine Freundin der Nachbarin meiner Schwiegermutter lässt mir eine Broschüre überbringen, in der mehrere MS-Patienten eine deutliche Besserung dank einer Stimulierung der Selbstheilungskräfte durch Yogaübungen und positives Denken schildern. Der Schwager der Freundin der Nachbarin der Schwiegermutter lässt mir ausrichten, dass ich ab jetzt Weißmehl und Industriezucker meiden soll. Zum Glück verzichtet wenigstens der Tankwart des Schwagers der Freundin der Nachbarin der Schwiegermutter darauf, mir ein weiteres Erfolgsrezept vorzuschlagen.
Schließlich weiß ich inzwischen, dass es bei MS völlig unterschiedliche Krankheitsverläufe gibt, vom Rest des Lebens im Rollstuhl bis zu einem dauerhaft fast unbeschwerten Leben. Deshalb kann man niemals eine konkrete Prognose für eine bestimmte Person abgeben. Was wiederum heißt, dass niemand sagen kann, ob bei einem der Patienten aus den Diät-Broschüren die geschilderten Besserungen auch ohne diese radikalen Essenseinschränkungen eingetreten wären. Auf alle MS-Patienten anwendbar wären diese Erfolgsrezepte nur, wenn von tausend MS-Kranken über 900 die gleichen Erfahrungen gemacht hätten. Wenn das der Fall wäre, dann wüsste auch mein Neurologe davon. Beglückt stelle ich fest, dass ich also alle diese Wunderdiäten getrost vergessen kann. Ich muss nicht auf meine geliebte Schokolade verzichten, ich darf mir weiterhin ab und zu ein Spiegelei braten. Den letzten Rest eines schlechten Gewissens meiner Gesundheit gegenüber vertreibt der Grundsatz, den ich in dem Buch von meiner Mutter finde: „Meiden Sie Stress – und bedenken Sie, dass auch allzu rigide Essens-Vorschriften Stress bedeuten.“ Ich kann ja trotzdem das tun, was der Neurologe mir rät: Überlastung vermeiden, mehrfach ungesättigte Fettsäuren bevorzugen, gelegentlich Fischölkapseln schlucken.
Als ich das Krankenhaus verlassen und in unsere neue Wohnung einziehen kann, hat das Cortison bereits Wirkung gezeigt: Als Gehhilfe für längere Strecken brauche ich nur noch den Krückstock von Martins Großmutter, das Taubheitsgefühl beschränkt sich auf die Füße. Wenige Wochen später kann ich den Stock weglassen. Nur meine Füße fühlen sich dauerhaft an wie „eingeschlafen“. Außerdem braucht ein Nervenimpuls vom Fuß ein paar Millisekunden länger als üblich, bis er ins Gehirn gelangt; dessen Rückmeldung „Fuß anheben“ verliert unterwegs wieder einige Millisekunden Zeit. Zusammen sorgen diese kaum messbaren Verzögerungen dafür, dass ich schneller als andere Menschen stolpere. Zum Glück läuft die Nachrichtenübertragung in meinen Nerven noch schnell genug, um den Stolperer aufzufangen, bevor er zum Hinfaller wird.
Das Einzige, worauf ich künftig wohl verzichten muss, sind offene Schuhe. Für die Hochzeit von Freunden habe ich, passend zum Kleid, Slipper angezogen. Und habe plötzlich das Gefühl, auf ungleich langen Beinen zu laufen. Verwundert sehe ich nach unten – und stelle fest, dass mein Gefühl mich an diesem Punkt nicht getrogen hat. Das rechte Bein ist tatsächlich kürzer: Denn am untersten Ende fehlt der Schuh. Der steht einsam und verlassen zehn Meter hinter mir. Dass ich ihn einfach verloren habe, haben meine lädierten Nerven mir nicht mitgeteilt. Aber was soll’s, ich trage ohnehin lieber fest sitzende Schuhe. Und für festliche Anlässe finde ich schnell ein Paar schicke Schnürstiefelchen. Mit diesen kleinen Ausfällen kann man durchaus gut leben.
Und ich beschließe, wirklich gut zu leben.
Sprich: Auf meine Krankheit Rücksicht nehmen, wo es unabdingbar ist, aber mein Leben nicht von ihr bestimmen lassen. Mein erster Gedanke morgens und mein letzter vor dem Einschlafen sollen ganz gewiss nicht der Frage gelten, ob sich das Taubheitsgefühl in den Füßen verstärkt hat oder nicht. Ich will weiterhin „Sabine Zinkernagel“ sein, später auch „die Pfarrfrau“ oder „die Mama von xy“. Meine Umwelt soll mich als ehrliche Christin, als Ehefrau und Mutter und vieles mehr wahrnehmen, und nur höchstens irgendwann am Rande als „MS-Kranke“.
Als eine Bekannte fragt: „Ich habe gehört, du leidest an MS! Stimmt das wirklich?“, antworte ich wahrheitsgemäß mit „Nein“.
Und setze hinzu: „Ich leide nicht an MS. Ich habe sie nur.“
Meine Bekannte starrt mich erst verständnislos, dann entsetzt an. Wenn ich MS habe, müsse ich doch daran leiden, das dürfe ich doch nicht so einfach auf die leichte Schulter nehmen … Mein Neurologe sieht das zum Glück anders. Er erklärt mir sogar, dass Patienten mit meiner Einstellung größere Chancen auf einen milden Verlauf der Krankheit haben. Einfach deshalb, weil sie sich nicht selbst verrückt machen.
Zwei Zugeständnisse mache ich der MS aber doch: Ich reduziere meine Arbeitszeit auf eine Dreiviertel-Stelle und sage eine geplante Dienstreise nach Äthiopien ab. Die für Februar geplante Urlaubsreise nach Rom treten Martin und ich aber an. Sie wird zum Beweis dafür, dass ich immer noch die alte Sabine bin. Sechs Tage lang durchstreifen wir die Überbleibsel der antiken Weltstadt, steigen hinauf auf den Palatin und hinunter in die Katakomben. Nur zum Mittagessen legen wir eine kurze Pause ein; ansonsten gibt es viel zu viel Faszinierendes zu entdecken. Irgendwann stehen wir unten an der Spanischen Treppe. Ich inspiziere sie mit einem skeptischen Blick. Hoch ist sie, und steil. Viel zu steil gebaut für eine bequem begehbare Treppe. Kann ich mir das wirklich zutrauen? Ich will es wenigstens versuchen. Also kommandiere ich: „Auf die Plätze – fertig – los“, und dann rennen Martin und ich los, die viel zu hohen Stufen hinauf. Martin ist schneller oben als ich, aber auch ich schaffe es ohne Pause bis ganz nach oben. Es geht also noch, oder besser gesagt: wieder.
Trotzdem ist es gut, dass ich die Dienstreise im Juni nicht antrete. Denn wie sich kurze Zeit später herausstellt, bin ich da bereits schwanger.
Mein Leben, unser Leben geht weiter. Ich habe einen Mann, einen Beruf, demnächst ein Kind. Und eben irgendwo weit hinten in meinen Gedanken ein M und ein S mehr als andere Menschen.
Briefe an Jacob
10. November 1994
Lieber Jacob,
seit drei Tagen wissen wir nun, dass du ein Junge bist. So können wir dich schon mit deinem Namen anreden.
Allerdings wissen wir seitdem auch, dass mit dir nicht alles so ist wie bei anderen Babys. Du hast zu viel Nervenwasser im Kopf; das kann deinem kleinen, empfindlichen Gehirn Schaden zufügen. Woher dieser „Wasserkopf“ kommt, wissen wir noch nicht.
Um das genauer zu untersuchen, haben die Ärzte ein klein wenig Blut aus deiner Nabelschnur geholt. Das ist nicht ganz ungefährlich, aber du hast es wohl gut überstanden. Da hat Jesus schon mal gut auf dich aufgepasst.
An deinem Blut können die Ärzte unter anderem erkennen, ob du eine ganz seltene Krankheit hast, mit der du deine Geburt nur um wenige Stunden überleben würdest. Sie haben uns vorgeschlagen, in diesem Fall eine Ausschabung zu machen, um mir die Anstrengungen einer normalen Geburt zu ersparen. Aber dein Papa und ich waren uns sofort einig: Das werden wir nicht zulassen.
Denn wir haben dein Leben in meinem Bauch nicht selbst gemacht, das hat dir Gott geschenkt. Deshalb, finden wir, haben wir auch kein Recht, über dein Leben zu entscheiden. Wenn du kurz nach deiner Geburt sterben solltest – dann soll auch das alleine Gottes Angelegenheit sein. Wir werden uns jedenfalls nicht daran beteiligen. Das versprechen wir dir hiermit.
Aber wie gesagt, diese eine so schlimme Krankheit ist sehr, sehr selten. Viel häufiger hat ein Wasserkopf ganz andere Gründe. Wir haben also alle drei genug Grund für die Hoffnung, dass du leben und groß werden wirst.
Allerdings war es ein seltsames Gefühl, deine künftigen Kinderzimmermöbel auszusuchen. Denn im schlimmsten Fall wirst du sie niemals benutzen. Wir haben sie trotzdem bestellt. Das mussten wir jetzt schon machen, damit sie rechtzeitig zu deiner Geburt da sind.
Dein schönstes Möbelstück steht schon in unserem Schlafzimmer: Eine Wiege, die dein Opa selbst gezimmert hat. Die Oma hat die Bezüge und die Bettwäsche dazu genäht. Deine andere Oma näht noch an einem Wandteppich, mit dem du später die Geschichte von Noahs Arche nachspielen kannst. Du siehst also, es freuen sich eine ganze Menge Menschen sehr auf dich.
Deine Mama
10. Dezember 1994
Lieber Jacob,
es gibt gute Nachrichten für uns alle: Die eine schlimme Krankheit, nach der die Ärzte gesucht haben, hast du nicht. Du wirst also leben. Das ist doch eigentlich die beste Nachricht, die es geben kann, nicht wahr?
Woher das Zuviel an Nervenwasser in deinem Kopf kommt, haben die Ärzte nicht herausgefunden. Aber das ist nicht ungewöhnlich.

