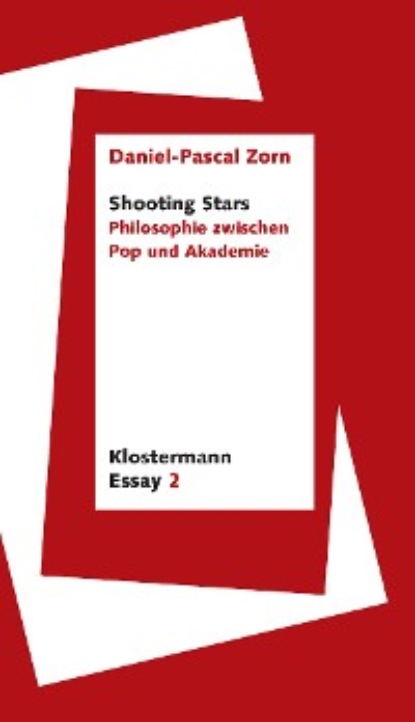- -
- 100%
- +

Daniel-Pascal Zorn
Shooting Stars
Philosophie zwischen
Pop und Akademie
Klostermann Essay 2
Bibliographische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliographie; detaillierte bibliographische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
© Vittorio Klostermann GmbH · Frankfurt am Main · 2019
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere die des Nachdrucks und der Übersetzung. Ohne Genehmigung des Verlages ist es nicht gestattet, dieses Werk oder Teile in einem photomechanischen oder sonstigen Reproduktionsverfahren oder unter Verwendung elektronischer Systeme zu verarbeiten, zu vervielfältigen und zu verbreiten.
Gedruckt auf alterungsbeständigem Papier.
Satz: Marion Juhas, Frankfurt am Main
E-Book-Herstellung: Zeilenwert GmbH
ISSN 2626-5532
ISBN 978-3-465-24398-4
Cover
Titel
Impressum
Einleitung
Die neuen Philosophen
Populärphilosophie: eine Problemstellung
Philosophie – aber ohne große Anstrengung
Das Dilemma der Radikalität
Der Segen der Popularität
Die Lehre der Philosophie
Die Welt verlieren, um die Welt zu gewinnen
Der Weg aus der Höhle
Mit Geduld und Spucke
Problematische Kategorien: Populärphilosophie und akademische Philosophie
Ist und Soll
Was ist gute akademische Philosophie?
Was ist gute Populärphilosophie?
Einleitung
Der vorliegende Text ist eine Kritik der Populärphilosophie. Das bedeutet zunächst, dass er die Selbstdarstellung einiger Populärphilosophen in Frage stellt und zum Problem macht. Ihr stellt er die Schwierigkeit der Philosophie gegenüber, sich einem Publikum mitzuteilen, das gerade die Voraussetzungen schon akzeptiert hat, um deren Infragestellung es der Philosophie geht.
Der Streit um die Populärphilosophie bewegt sich aber für gewöhnlich in genau diesen Bahnen: Einem selbstbewussten Bild der Populärphilosophie wird ein ideales Bild der Philosophie gegenübergestellt. Genau das kritisieren aber viele Populärphilosophen. Ihr Gegner ist also nicht die Philosophie, sondern die akademische Philosophie, der sie bescheinigen, unverständliche und hochtrabende oder voraussetzungsreiche und hochspezialisierte Texte zu verfassen. Sie sei deswegen für die große Masse der Leser irrelevant geworden.
Hier wird der Versuch unternommen, dem unproduktiven Streit zwischen Populärphilosophie und akademischer Philosophie eine dritte Position vorzuschlagen. Der Streit gerät deswegen unproduktiv, weil beide Parteien sich hochgerüstet gegenübertreten: die Populärphilosophie mit der Autorität des Publikums und die akademische Philosophie mit der Autorität der Wissenschaft. Aus Sicht der Populärphilosophie ist jede Erwiderung der akademischen Philosophie auf ihre Kritik nur eine Bestätigung dieser Kritik. Und ebenso ist jede Erwiderung der Populärphilosophie auf die Kritik der akademischen Philosophie für diese Ausweis einer generellen Inkompetenz dieser Philosophie.
Um diesem unproduktiven Kreislauf zu entkommen, muss man die Sache einerseits etwas vereinfachen. So erscheinen Populärphilosophie und akademische Philosophie in diesem Essay als wenig sympathische Idealtypen. Das soll dazu dienen, im Leser eine kritische Haltung gegenüber beiden wachzurufen. Da es dabei um die Populärphilosophie geht, spielt außerdem die akademische Philosophie nur eine Nebenrolle. Der unproduktive Zirkel gewinnt dadurch in der Darstellung eine populärphilosophische Schlagseite. Das ist, neben dem Thema, auch der Form des Essays geschuldet – eine Kritik, die Populärphilosophie und akademische Philosophie in gleicher Weise umfasste, hätte zu letzterer eine ganze Menge mehr zu sagen.
Andererseits musste die Sache, ganz entgegen dem Einfachheits- und Verständlichkeitsdrang der Populärphilosophie, etwas komplizierter gemacht werden. Kompliziert ist etwa das Problem, mit dem es die Philosophie zu tun bekommt, wenn sie andere Menschen Philosophie lehren will. Es ist auch deswegen so kompliziert, weil die radikale Haltung der Philosophie darin besteht, jegliche Autorität, die von anderen akzeptiert wird, in Frage zu stellen – sei es diejenige der eigenen, festgehaltenen Meinung, diejenige der etablierten Wissenschaften oder diejenige der applaudierenden Menge.
Dennoch tritt die Philosophie hier der Populärphilosophie und der akademischen Philosophie nicht wie ein dritter, von ihnen unabhängiger Mitspieler gegenüber. Ihre dritte Position besteht vielmehr darin, dass Populärphilosophie und akademische Philosophie auf jeweils ihre eigene Weise mit dem Problem zu tun bekommen, mit dem es die Philosophie zu tun bekommt, wenn sie Philosophie lehren soll oder will. Beide haben dieses Problem wiederum auf jeweils ihre eigene Weise gelöst – die akademische Philosophie durch Verwissenschaftlichung, die Populärphilosophie durch Popularisierung der Philosophie.
Eine Kritik der Populärphilosophie kann, wenn sie selbst die radikale Haltung der Philosophie bewahren will, nicht bei einer Gegenüberstellung von Populärphilosophie und akademischer Philosophie stehenbleiben. Sie muss vielmehr diese Kategorien selbst noch einmal kritisch befragen, die Voraussetzungen ihrer Beschreibung sind. Auch hier wird das, was am Anfang des Essays einfach klingt, im weiteren Verlauf komplizierter: Die Populärphilosophie erscheint dort als ein wesentlicher Teil der philosophischen Tradition, auf die die akademische Philosophie sich beruft. Umgekehrt erscheint die akademische Philosophie – historisch betrachtet – als ein junges Ideal, das sich nicht zuletzt einer Situation verdankt, in der Philosophen für ihre Forschungen – zumindest in manchen Ländern und Landschaften dieser Welt – nicht mehr mit dem Tode bedroht werden.1
Nur wenn Populärphilosophie und akademische Philosophie einsehen, dass das Dritte, das sie miteinander vermittelt, die Philosophie ist, können sie aus ihrem unproduktiven Zirkel herausfinden. Und nur wenn sie verstehen, dass »die Philosophie« zunächst keine Ansammlung von Weisheiten, Inhalten, Themen und Methoden ist, sondern eine Haltung, eine Praxis und ein aus dieser Haltung entstehendes radikales Problem ihrer Weitergabe, können sie einen Weg finden, der sie von Gegnern zu Partnern werden lässt. Diese Partnerschaft wird hier nicht als Eintracht oder absolute Harmonie vorgestellt. Sondern als eine Bereitschaft, die Philosophie als Frage zu akzeptieren, ohne dabei schon die Wissenschaft oder das Publikum als selbstverständlichen Horizont vorauszusetzen.
Wenn hier also von »der Philosophie« die Rede ist, ist damit keine irgendwie schon ausgeformte Disziplin gemeint. Was »die Philosophie« ist, ist ein philosophisches Problem. Weil er dieses Problem gesehen hat und nicht, weil er eine Lehrautorität darstellt, greife ich vor allem auf Platon zurück. Bei ihm gewinnt »die Philosophie« einen Ausdruck, der das Problem der Lehrbarkeit der Philosophie reflektiert und Lösungen vorschlägt.
Dass diese Lösungen selbst nicht verfangen haben, zeigt die Tatsache, dass es nach Platon eine umfassende philosophische Tradition gibt, die nach Ansicht manches Philosophen nur eine »Fußnote zu Platon« darstellt. Dass Platons Lösungsvorschläge dennoch für die gegenwärtige Philosophie relevant sein können, versucht dieser Essay anzudeuten. Zumindest der akademischen Philosophie und der Populärphilosophie könnten sie einen Anhaltspunkt bieten, inwiefern ihre jeweilige Selbstdarstellung gerade das verhindert, was sie zu tun beanspruchen: die Philosophie anderen Menschen zu vermitteln.
Ein Essay ist keine Abhandlung und beansprucht auch keine Vollständigkeit in der Darstellung. Er gibt einen Anstoß, oft aus einem bewusst perspektivischen Blickwinkel heraus. Dass man die Möglichkeit einer perspektivischen oder partikulären Darstellung heutzutage betonen muss, zeigt vielleicht, wie weit das Problem um sich greift, das akademisches und populäres Philosophieren erfasst hat. Zugleich ist der hier eingenommene Blickwinkel selbst ein Prüfstein für die Haltung, die er zumindest indirekt zu lehren beansprucht.
Die neuen Philosophen
Die Populärphilosophie ist auf dem Vormarsch. Während noch in den Instituten und Seminaren, die Augen fest vor der Realität verschlossen, die Bedeutung des Hegelschen Spätwerks diskutiert wird, schicken sich junge, gutaussehende, dynamische und meinungsstarke Ex-Akademiker an, der Philosophie ein neues Gesicht zu geben. Sie verlassen die Bibliothek und gehen auf die Straße, in die Zeitungen, ins Fernsehen, zu den Menschen, öffnen sich für die Welt.
Anstatt sich in staubigen Kolloquien jedes Wort im Mund herumdrehen zu lassen, stellen sie die Fragen, die wichtig sind, weil sie relevant sind und uns betreffen. Deswegen hören die Menschen ihnen zu und kaufen ihre Bücher. Die Populärphilosophen vermitteln das, was andere jahrelang studieren, auf verständliche Weise, scheiden das Interessante vom Überflüssigen und tragen so zur Zukunft der Philosophie bei, die sonst drohte, in den Abgründen des akademischen Vernünftelns zu verschwinden.
So oder so ähnlich sieht das Bild aus, das manche Populärphilosophen von der Populärphilosophie zeichnen. Sie wirbt mit Relevanz und Praxisbezug und grenzt sich ab vom akademischen Elfenbeinturm. Sie geht auf die Straße oder setzt sich in Talkshows. Sie erklärt philosophische Fragestellungen mit leichter Hand und ist nie um eine Antwort verlegen. Sie versteht sich als Philosophie, die deswegen populär ist, weil sie den Menschen zeigt, wozu sie zu gebrauchen ist.
Von diesem Kriterium aus versteht sie die Philosophie. Relevant ist, was der Gegenwart nützlich ist. Und deswegen ist das, was der Gegenwart nicht nützlich ist, irrelevant. Natürlich wird die Populärphilosophie immer wieder von akademischen Philosophen kritisiert. Weil das aber diejenigen sind, die sich in ihren Instituten und Seminaren verstecken und jahrelang über Problemen brüten, die außer ihnen keiner versteht, erscheint die Motivation dieser Kritik allzu durchsichtig: Die akademischen Philosophen sind neidisch.
Sie gönnen der Populärphilosophie den Erfolg nicht, nicht die Bestseller und nicht die Talkshows. Sie verteidigen eine vergangene Form des Philosophierens, eine elitäre und undemokratische oder sogar ideologische Form, die künstliche Barrieren aufstellt, um sich selbst den Anschein von Tiefsinn zu verleihen. Dabei müssten sie nur verständlicher formulieren, sich dem Publikum öffnen und es dort abholen, wo es steht. Dann würde sich der Erfolg auch bei ihnen einstellen.
Für die Populärphilosophie ist die Frage nach Verständlichkeit oder Unverständlichkeit eine Sache der Vermittlung. Mit dem Wesen von Philosophie selbst hat sie nichts zu tun. Dasselbe gilt für die Nützlichkeit der Philosophie. Wenn man nicht mehr deutlich machen kann, wozu ein philosophischer Gedanke heutzutage zu gebrauchen ist, dann kann man ihn auch weglassen. Die Erwartungshaltung des Publikums ist der Maßstab, sonst nichts. Und wenn das Publikum etwas unverständlich, nicht relevant oder zu kompliziert findet, dann ist es eben auch philosophisch nicht zu gebrauchen. Denn was soll man mit einer Philosophie, die keiner verstehen kann?
Wer heutzutage Philosophie treiben will, der muss akzeptieren, dass sie eine Teilnehmerin an einem Markt ist. Thomas Vašek, Chefredakteur der Zeitschrift Hohe Luft, schreibt dazu: »Wir brauchen keine geschützten Denkwerkstätten, sondern eine lebendige Philosophie, die mitten im Leben steht, statt sich von der Gesellschaft abzukoppeln. Dazu gehört auch, die ökonomischen Regeln zu akzeptieren, denen wir alle unterliegen.«2
Auch Wolfram Eilenberger, ehemaliger Chefredakteur des Philosophie Magazins, misst den »desolaten Zustand« der akademischen deutschen Philosophie am Publikumserfolg der Populärphilosophie: »Wie konnte es im Lande von Leibniz und Kant, Hegel und Schopenhauer, Nietzsche und Arendt nur dazu kommen? Vor allem in einer Zeit, da das öffentliche Interesse an philosophischer Reflexion geradezu explodiert und sich als Folge ein ganzes Gattungsbündel vermittelnder Formate erfolgreich am freien Markt etabliert.«3 Dieser Erfolg, an dem Eilenberger sich selbst einen nicht unmaßgeblichen Anteil bescheinigt, wird von ihm mit Absatzzahlen belegt: »Philosophische Monatsmagazine wie Hohe Luft oder das Philosophie Magazin, dessen Chefredakteur ich war, erreichen eine Auflage von 60.000 Exemplaren; Festivals wie die phil.cologne locken binnen einer Woche mehr als 10 .000 Menschen. Die Sachbuch-Bestsellerlisten zeigen sich seit Jahren populärphilosophisch dominiert.«
Andere Populärphilosophen wie Richard David Precht betonen den Lifestyle-Aspekt der Philosophie: »Ich würde sagen: es ist eine Tätigkeit, die einen erfüllt, einen beschwingt, einen weiter bringt, einem ein gutes Gefühl gibt. Das ist die Hauptfunktion von Philosophie und nicht, Probleme zu lösen.«4 Auch Ronja von Rönne, Moderatorin des ARTE-Formats Streetphilosophy, geht es darum, dass das Publikum sich gut fühlt: »Ich will niemanden langweilen. In Artikel knalle ich deshalb alle zwei Zeilen Pointen rein. […] Ich versuche Gesprächssituationen herzustellen, die auch für Zuschauer interessant sind, die mich nicht kennen.«5
Für Svenja Flaßpöhler, gegenwärtige Chefredakteurin des Philosophie Magazins, gibt die Philosophie vor allem Orientierung in schwierigen Zeiten: »Gerade in extrem komplexen Zeiten wie diesen suchen die Menschen nach Orientierung. Da die Religion diese Orientierung für viele nicht mehr zu geben vermag, ist die Philosophie gewissermaßen an deren Stelle getreten.«6 Bei alledem ist es allerdings wichtig, auf dem Boden zu bleiben. Flaßpöhler stellt deswegen klar, dass die Philosophie, anders als die Religionen, nicht nach einfachen Antworten sucht. »Das Hinterfragen ist das Urgeschäft der Philosophie. Ob sie gewollt wird oder nicht, sie ist wichtig. Nur durch Erschütterung können verhärtete Fronten zu bröckeln beginnen. Nur so kann Neues entstehen.«
Wie dieses Neue aussehen kann, zeigen die Konferenzen Beyond Knowledge und Beyond Good, die von einem Format ausgerichtet werden, das sich ebenfalls Street-Philosophy (mit Bindestrich) nennt.
Einer der Stargäste ist Richard David Precht. »Mit Beyond Knowledge möchten wir den Rahmen bieten querzudenken, weiterzudenken, anders zu denken, in die Tiefe und in die Breite zu denken, kritisch zu denken und gleichzeitig offen und wohlwollend zu sein.«7 Nina Schmid, eine der Macherinnen von Street-Philosophy, bietet in diesem Sinne auch einen Glück.Workshop an: »Wie erreicht man nachhaltig und auf lange Sicht ein hohes Niveau an Erfüllung und ganzheitlichen Erfolg?«8 Gemeinsam mit ihrer Mutter Julia Kalmund, der anderen Gründerin von Street-Philosophy, zeigt sie sich auf der Seite geldheldinnen.de überzeugt, »dass eine gesunde Einstellung zum Geld einen großen Einfluss auf die Lebensqualität hat«.9
Populärphilosophie: eine Problemstellung
Populärphilosophie, so scheint es, will dem Menschen etwas Gutes tun. Sie will die Weisheit der Jahrhunderte verständlich machen und so die Philosophie für die Menschen öffnen. Deswegen leuchtet Thomas Vašek auch »nicht ein, warum sich Philosophen nicht bemühen sollten, die Relevanz ihres Fachs auch einer breiteren Öffentlichkeit zu vermitteln – und damit womöglich sogar etwas Geld zu verdienen«.10 Eine Win-Win-Situation, so scheint es. Der Populärphilosoph tut etwas Gutes und verdient dabei sogar etwas Geld. Und das Publikum bekommt wichtige Anregungen und Hilfestellungen, Orientierung und bequem zugängliches kulturelles Kapital.
Dieses System kann aber nur sich selbst erhalten, wenn der Vorgang wiederholbar ist, das öffentliche Interesse, das nach Eilenberger »explodiert« und auf das die Populärphilosophie mit ihren Angeboten antwortet, weiter bestehen bleibt. Da trifft es sich gut, dass man genau die richtige Mischung von Antworten und Fragen, Wissen und Unwissen zur Verfügung stellen kann. Die Populärphilosophie folgt darin der Logik des Abonnements, nicht nur in der Form von Zeitschriften und Büchern, sondern auch über den Inhalt der Texte und Beiträge. Es gibt ja immer noch etwas zu wissen, immer noch etwas zu fragen, immer noch mehr, was man entdecken kann.
Deswegen liebt die Populärphilosophie den Streit, die Kontroverse und die Provokation. Diese Diskursarten garantieren, dass die Philosophie – für die Populärphilosophen wie für das Publikum – prinzipiell unabschließbar ist. Dabei darf man nicht vergessen, dass die Philosophie für die Menschen, die man erreichen will, keine Hauptbeschäftigung ist. Sie ist ein Freizeitvergnügen. Sie gehört zum weiten Bereich der »Kultur« und des »kulturellen Angebots«. Man war letzte Woche im Theater, geht nächste Woche in die Oper und diese Woche auf ein Philosophie-Festival. Street-Food, Street-Art, Street-Philosophy. Authentisch, nah am Leben und gut geeignet, um im Vorbeigehen das eine oder andere Häppchen mitzunehmen.
Was soll daran schlecht sein? Wenn jeder zufrieden ist, ist doch alles gut, oder? Natürlich weiß der Populärphilosoph mehr als das Publikum, das ist ja der Witz. Richard David Precht kann zu allem etwas sagen und weiß, dass er ein »Generalist« ist.11 Er gibt den Menschen etwas und sie geben ihm dafür etwas zurück. Seine Philosophiegeschichte, so freut er sich zeitgemäß in Jugendsprache, »ist jetzt schon die dritterfolgreichste Philosophiegeschichte ever, dabei gibt es sie noch gar nicht so lange«.12 Und auch seine Leserschaft nötigt ihm Respekt ab: »Das ich jetzt mit dem ersten Band 80.000 Leser erreicht habe, die im Grunde genommen wenn sie das lesen ein Vollstudium absolvieren, das freut mich zutiefst.« Precht, so scheint es, bietet in seinen Büchern »im Grunde genommen … ein Vollstudium«, nur ohne die ganzen lästigen Prüfungsbestimmungen und Seminare, die an der Universität üblich sind.
Noch einmal: Was soll daran schlecht sein? Die Populärphilosophen gehen ja offen damit um, dass sie nicht alles erklären können. Sie können auch nicht alles »hinterfragen«. Manche Voraussetzungen muss man schlicht akzeptieren. »Die Philosophie schafft sich dann ab, wenn sie irrelevant wird. Wenn sie nichts mehr zu sagen hat, was die Menschen interessiert.« So sieht es Thomas Vašek. »Selbstverständlich entscheidet der Markt nicht, was gute Philosophie ist. Aber der Markt entscheidet, was sich bei den Lesern durchsetzt.« Der Markt entscheidet, was die Menschen so interessiert, dass es sich bei ihnen durchsetzt. Und deswegen muss man eben »die ökonomischen Regeln akzeptieren, denen wir alle unterliegen«.13 Die Entscheidung des Marktes kann ja auch die der Leser sein. Und warum auch nicht?
Das vermeintliche Manko, keine akademische Philosophie zu sein, macht die Populärphilosophie damit wett, dass alles in Ordnung ist, wenn alle mitmachen, weil alle mitmachen. Das zum Problem zu machen, führt nicht weiter. »Das Problem der ›Popularisierung der Philosophie‹ ist ein philosophisches Scheinproblem, das am Ende wiederum nur die Philosophen interessiert.«14 Es gibt einfach kein Problem, wenn man das, was man nicht ändern kann, akzeptiert. »Wenn Macht freiwillig von denen angenommen wird, über die sie ausgeübt wird«, sagt Ronja von Rönne, »dann ist sie aufrichtig und wahr und nicht schädlich.«15
Philosophie – aber ohne große Anstrengung
Was ist von dieser Selbstdarstellung der Populärphilosophie zu halten? Ist es überhaupt sinnvoll, diese Frage zu stellen? Die Antworten sind doch längst gegeben. Aus Sicht der akademischen Philosophie handelt es sich um Quacksalberei. Homöopathische Dosen philosophischer Tradition werden in literweise Werberhetorik aufgelöst und heraus kommt etwas, was sich zwar gut verkauft, mit Philosophie aber nicht viel zu tun hat. Aus Sicht der Populärphilosophie ist diese Reaktion der akademischen Philosophie Ausdruck eines tiefsitzenden Neides derjenigen, die unfähig zum verständlichen Ausdruck sind. Gefangen in einem verstaubten, selbstreferentiellen System verachten die Aristokraten des Gedankens die Demokratisierung des Denkens.
Das, so erkennt das Publikum, ist eben der alte Streit der Philosophen. Die aristokratisch Gesinnten schlagen sich dann auf die Seite der Akademiker und lesen griechische Philosophie. Und die demokratisch Gesinnten kaufen sich den neuen Bestseller von Richard David Precht und fühlen, wie die Philosophie sie mit frischer Lebenskraft durchströmt. Die einen absolvieren ein Studium im Elfenbeinturm, mit vielen Texten, vielen Perspektiven, vielen Autoren. Die anderen absolvieren ein Studium in der Straßenbahn mit einem einzigen Buch – von einem einzigen Autor.
Die Populärphilosophen appellieren an das Selbstverständliche. Die Welt, den Markt, das Leben. Sie appellieren an Konzepte und Erfahrungen, mit denen jeder etwas anfangen kann und zu denen jeder etwas sagen kann. Konzepte und Erfahrungen, die aber zugleich so allgemein sind, dass man sie nie abschließend beurteilen kann. Das Selbstverständliche, behaupten die Populärphilosophen, ist das, was die Philosophie erst relevant macht: unsere Gegenwart, unsere Orientierungslosigkeit, unser Interesse.
Philosophie, die keine Leser hat, wird irrelevant. Also muss sie dafür sorgen, möglichst viele Leser zu haben. Akademische Philosophie, so scheint es der Populärphilosophie, hält sich mit dem Unnötigen auf: mit unnötig komplizierten Formulierungen in unnötig langen Texten mit einer unnötig selbstbezüglichen Forschung. Im Grunde machen beide dasselbe, die akademische Philosophie und die Populärphilosophie, nur die Populärphilosophie macht es besser. Sie formuliert verständlicher, näher am Leben, antwortet auf Fragen, die die Menschen wirklich bewegen.
Wie Karikaturen stehen sie sich gegenüber: Auf der einen Seite die unfruchtbare, in die Jahre gekommene akademische Philosophie mit den dicken Brillengläsern und der linkischen Art, unfähig, sich in sozialen Kontexten nicht lächerlich zu machen. Und auf der anderen Seite die schicke, dynamische und weltoffene Lifestyle-Populärphilosophie, am beschleunigten Puls der Zeit, immer eine Pointe zur Hand, um das Publikum nicht zu langweilen.
Um zu verstehen, wie dieses Bild zustande kommt, könnte man überlegen, wie jemand die Philosophie wahrnimmt, der bisher mit ihr nichts zu tun hatte. Die Vorstellungen, die sich Nichtphilosophen von der Philosophie machen, sind geprägt durch das Wissen und die Erfahrungen, die sie bisher gesammelt haben und auf die sie sich verlassen können. Philosophie ist für sie ein Thema unter anderen, und so wird es auch behandelt.
Diese Konvention macht sich die Populärphilosophie zunutze. Sie akzeptiert einige oder sogar die meisten Voraussetzungen, die das Publikum mitbringt. Das hat den angenehmen Effekt, dass die Zuschauer, Zuhörer oder Leser nicht übermäßig irritiert sind, wenn man damit beginnt, Fragen zu stellen. Je nachdem, welches Risiko man eingehen will, kann man die Fragen sehr allgemein oder aber provokativ stellen. Zu den allgemeinen Fragen gehören z. B. Fragen nach dem Leben, dem Tod, der Welt, dem Menschen, dem Universum oder Gott. Bei solchen Fragen kann jeder mitdiskutieren, ohne viel riskieren zu müssen. Und am Ende kann man immer noch sagen, dass eine abschließende Antwort unmöglich oder schwierig ist, dass man sie auf jeden Fall jetzt (noch) nicht geben kann.
Daneben kann man auch mit Fragen oder Thesen provozieren. Das beginnt bei Buchtiteln wie Wer bin ich, und wenn ja, wieviele? und endet noch lange nicht beim Versuch, das gesamte Bildungssystem oder die gesamte Entwicklung des menschlichen Denkens aus einem Wurf zu erklären. Populärphilosophen streben nicht nur danach, die Philosophie populärer zu machen. Sie streben auch danach, dass sie selbst populärer werden. Populärphilosophie ist angelegt als Kampf um Aufmerksamkeit. Und dafür muss man Themen bedienen, die gerade »heiß« sind oder die als Dauerbrenner immer wieder neu aufgelegt werden. Wer sich noch nie mit Philosophie befasst hat, kann so die Populärphilosophen als Intellektuelle wahrnehmen, die sich mit Fragen auseinandersetzen, die einen selbst beschäftigen. Worin sie populär sind, zeigt sich dann in verschiedenen Aspekten.