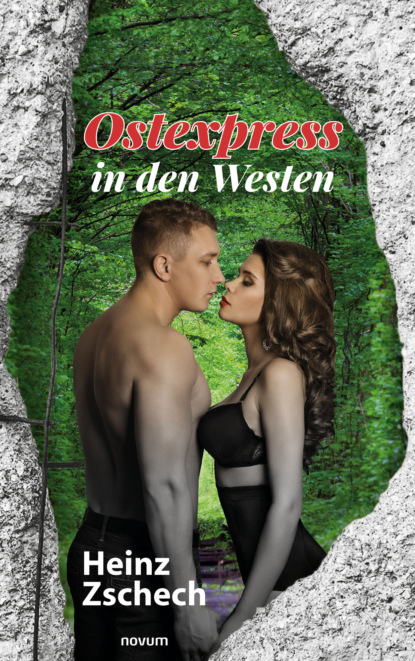- -
- 100%
- +
Dafür lernt er die Flüche, die mütterlichen, die Gesten, die unanständigen, nicht vernünftigen Worte, die die Launen nachzeichnen, die Stimmungen, welche weichstimmen, welche Lücken füllen und das Nichtweitergewusst, die Schmus sind für Ohren und für empfindliche Augen ohne Geschmack, schmutzig, ein „So-etwas-sagt-man-doch-nicht“! Erinnerungen sind sie von gestern, dass wider Erziehung noch strotzte oder vielleicht auch hauchende Nachwehen von Kindheit, von Kindheit-an-sich. Das wäre dann Freisinn, zwanglos, ohne Gepäck, ohne Kleider. – Zuerst wurde Sarodnick rot von den Fladen, unsicher, und er lenkte vorüber, sprach „schlafen“ und „mögen“, und der Anstand stand ihm dabei ganz gut. Er reckte in Sprachdisziplin und bog sich weg vom „Beim-Namen-Genannt“. – „So biegt sich das Deutsche ins Licht“‚ pflegte er es persönlich zu nennen. „Die Sprache ist voll von Dingen im Kopf, zeigt Denken im Namen, Hirnstriche, Reflexionen. Was aber spielt sich darunter? Wozu ist der Körper gesetzt? – Wir haben lateinische Formeln anstelle.“ Ein paar kluge, zensurfreundliche, für niemanden bissig. Wie drückt man Zärtlichkeit aus? Schon Niedlichkeiten sind träge, Verkleinerungsformen werden gemieden. Jeder spricht gleich. Sarodnick hört in die Graduierungen hinein, in das Beleben der toten Welt, der Natur. Und der Mensch tritt mit seiner Beziehung dazu. Ein Bund wird mit der Schöpfung gesiegelt, und das Wort gibt dem Menschen sein Bild.
Als Sarodnick gehen lernt sprachlich, und Samwel – Semjon, Sjoma, Samweltschik, Sjomotschka – ihn in das Fluchen einweiht, wird er nicht fahrig, wechselt nicht weg, sondern scheint Gefallen daran. Es ist ein Jenseits vom Wert, von klassischer Bildung und Klassen, geschöpft aus Vorkrieg und Vorrevolution, wo es Aborte und Fleckenwasser nicht gab.
3
Sie ist Turkmenin vom Kaspischen Meer, andererseits, jenseitig, zu Asien kaum oder gerade noch zugehörig und an Europa allenfalls grenzend. Ihr Volk ist eine Wurzel der Steppe, eine ziehende Horde mit Legenden auf Pferden, ein See zu den Bergen und mit Mädchen im Schlaf. Zu diesem noch aber hängt sich Europa und ein wenig Zivilisation, die Sippe versprengend, die Armut, die Wehr.
Sie hat noch nicht die klaren asiatischen Formen, diese Bewegung, das Lächeln, das Nicht-Ausdruckgenaue. Maja ist groß, aus weichem Ton farben, aus Früchten und Brüsten, aus Augen wie Kirschen im nachweiligen Sommer, dunkel und fallend: „Berührt sind sie noch nicht.“ Etwas Nachtschönes geht in sie ein, ein Lösen im Dunkel, zudem ihre Haare den Hals als Schatten bedecken, dessen Haut vom Meere entstieg, sonnengetrunken im Bad. Sie ist inmitten von Pferden gekommen, vom Zelt auf der Weide, dann sesshaft gemacht, den Schleier zerrissen, das Messer der Freier verworfen. Manchmal aber keimt es noch auf, fiebrig, kristallen wie Schnee und geblendet – ein Sturm, eine Braut, die wirbt und nicht gibt, nur den Zorn und die Klage. Maja ist da, schön, diamanten – ein Rohdiamant ohne Fassung am Ring, ein Preis in den Bergen, zur Erde gefallen und tot. Jedoch Maja möchte die Haltung, will den Schliff und die Stellung. Sie wünscht Europa zu sich, möchte die Freiheit, hat aber noch keine Übung darin. Die Männer begehren sie, fachen sie an wie das Feuer, sie aber will nur die Flamme, die Glut, die nicht löscht, ist rechtlos im Geben, im Wunsch, in ihren Gefühlen, und es verfliegt diese Gier vorschnell, vergebens.
Kennengelernt hat Sarodnick sie über Peter – ein Sohn der DDR-Nomenklatura – welcher Russisch beherrscht wie sein Vater das Amt, das seinen Sohn rettet vor Rettung, die freilich unsinnig ist. Denn Peter ist hier nicht am Platze, ist fehltrittig, hingeschoben nur von dem Vater. Es juckt wie auf Zwecken in ihm. Er ist ohne Ruder und Willen: Zehn Jahre Moskau haben in ihm ein Leck eingefressen. Nach jeder durchgefallenen Prüfung kommt eine Mitarbeiterin seines Vaters aus der Botschaft zur Schule und spricht – vier Augen – hinter Türen zur Traute. Man traut ihm über den Weg über den gestandenen Vater, der eine Seele von Mensch und unmenschlich, wie es das Regime so verlangt. Peters Freundin wohnt mit Maja zusammen, und Sarodnick verliebte sich allda, wie Blitze es tun: unangemeldet und heftig. Gemüter reißen Spalten auf in Lawinen, und man heilt, was gut ist, was jedermanns Sache, gut für tausend Jahre und mehr. Maja zerrt sich von der Innenwelt ab, die aus den Fugen geraten – Sippe, Eigentum, Patriarchat. Sie zerbricht an diesem danach, dem Epilog in dem Märchen, trägt sich selbst fort zu den Kindern, zu den Buchstaben und geschriebenen Bildern. Sie wird zum Leser gedruckt, schmilzt zu einfachen Zeilen und schweigt. Manchmal noch blättert sie von der Literaturgeschichte ins Leben zurück, aber ihre Siegel sind bar. Maja vergisst. Sie kann sich nicht mehr erinnern. Das Gestern ist vormals und weit und gelb wie abgestandene Molke. Ihre eigene Sprache hat sie lange verlernt, spricht Russisch, gibt sich europäisch, will frei sein, und kann es bloß nicht. Der Sprung geht in Jahre, und die sind zu viel.
Ausgelassen feiert sie sich, liebt die Abende mit der Musik, die Dämmerung, den Wein und die Tänze, sie liebt neue Gesichter, neue Gedanken, neue Kulturen. Dahinter aber birgt sich die Furcht vor Bewährung und Bleiben. – So ein neues Gesicht ist allenfalls Sarodnick auch –, sitzt ihr in den Augen und traut sich nicht, nicht seinen Augen. Fesseln möchte er sie, zielen, seine Spielregeln geltend machen für sie. – Maja kocht Reis, Hammel mit vielen Gewürzen. Die Becher klingen mit Wein zu der Musik, und man richtet sich ein in dem Zimmer mit den drei Betten. Martin tastet sich vor, befühlt Taten, sucht Gedanken zu setzen, ungesagt bislang in der Sprache. Doch die Ideen versumpfen, verwischen, wirren und treffen sie nicht. Wer kennt schon seine aufgezählten Namen, die Sprüche, die geklopften Zitate? „Novalis schrieb Lasker-Schüler und Conrad Ferdinand Meyer …“
„Bitte? Ich verstehe dich nicht. Geht man von Achmatowa aus, schließt der Ring um Block mit der Zwetajewa ab.“ – Die reden vorbei. Sarodnick kann es nicht nennen, sein Bedürfnis sticht nicht und verleitet, er ist an eine Mauer gestoßen, ein Inkommensurabel, eine Unlänge, die nicht ausdrückt genug. Wörterbücher nur brechen den Rhythmus, kalten, lassen schal, und Peter setzt ein wie ein Mittler, als Überbringer von Botschaften, die keine mehr sind. Man spricht aus seinem Graben heraus. Peter ist mühsam, schön und gut, aber ihm fehlt die Deutung, die eigene Soße, der Faden, der ködert. Man redet und redet – verschieden, verschiedene Welten – und ohne Händel dabei. Goethe ist ihnen nicht heilig, Kant nicht unbedingt Ausgangspunkt. Wo könnte Sarodnick ansetzen, Bezugspunkte gleiten?
„Fische, die liegen zu lange und riechen“, sagt er und lässt sich selbst im Trockenen stehen.
„Sandburgen!“, lacht Maja, „auf Sandkuchen gebaut.“
„Nehmen wir Hegel …“
„Nehmen wir die Bylinen“, schäkert sie.
„Und wenn Hölderlin in den Oden an Gott nebenging von der Erde …“
„Hast du Puschkin gelesen?“, stört sie ihn, und Martin weiß weiße Stellen, zeigt auf freie Rhythmen beim Schreiben.
„Das ‚weiße‘ Gedicht heißt freilich nicht reimen“, ist sie sich sicher dabei. „In Russland galt es lange verpönt solchermaßen zu dichten.“
„Die Deutschen schrieben derweil schon in Prosa.“
„Na und?“ – Ausgequetscht, saftarm, Unbeweise im Schwindel. Holt Martin einfach zu viel? Ihn stört das Atemholen in Sätzen, das Mischen mit Hammel und Wein:
„Zwischen zwei Bissen kann man nicht Kierkegaard klären.“
„Tanzt du mit mir?“ – Sie drückt seine Unzufriedenheit fest in den Griff und gibt ihren Mund: „Entschuldige bitte.“
Peter derweil lächelt betrunken: „Das alte Lied.“ – Seine Freundin holt ihre abgedroschene Platte aus dem Regal. Allein, Martin glaubt an sein Glück. Köpfe drehen und wenden, unwichtig ist das andere jetzt, lächerlich, laut.
„Küss mich und leg meine Haare um deinen Mund.“
„Um die Finger.“ – Wie leicht sagt man, was man gar nicht gelernt. Tausend und eines Gedicht.
„Die Lippen …“ Er fängt sich darin, lauscht auf den Atem.
„Ich möchte allein sein mit dir“, flüstert er kühn, sagt es ohne Gewissen, denn er ahnt, dass sie nie käme: Zu sehr liebt sie das Spiel, liebt den Flirt mehr als den Flirter.
„Ich verbrenne mich nicht“, flüstert sie und tanzt in die Nacht.
„Ich habe Verlangen nach dir.“
„Vor meiner eigenen Schwäche habe ich Angst.“ – Sie haben beide gelogen. Eine Katze. Man tut, als würde man sein.
„Wir sind an Oberflächen gewöhnt.“ – Sie können nicht lieben. „Du schläfst nicht mit mir.“
„Woher willst du das wissen?“
„Beide wissen wir es.“ – Die beiden küssen, ohne zu fragen, ohne Herzklopfen, küssen die Hülle ohne den Kern.
„Wir treiben sie aus.“
„Was?“
„Triebe.“ – Beide könnten es sagen.
„Zutreiben über die Schwelle.“
„Ungetrieben davon.“ – Wie schön zu sagen: „Ich möchte dich haben“, nach dem Verzicht.
„Wir sind sicher im Gehen.“
„Wir tun, als wäre das Gegenteil von.“
„Wovon?“
„Von dem Zauber.“ – Sie bezaubern sich roh, und sie lässt ihren Körper verwundern, befühlen: „Wie schön bin ich so.“
„Du bist ein Wunder für sich.“ – Ein glückliches Paar, ein Plakat, buchstabenlos scheinbar, aber gekonnt. Sie verstreichen den Abend, und Sarodnick legt sich beruhigt ungestillt hin. Er hat sich verliebt, hat Maja in den Schlaf eingewiegt und ihr etwas von Glück, von Freude erzählt. Ungewichtig ist er und gleich, und er schreibt einen Brief sich nach Hause, schreibt von Sehnsucht, die sich gut sieht auf dem Papier, von den Tagen, die kommen, die sich begegnen, und schreibt an Petra in Leipzig.
Gern liest Petra die Briefe, die Tränen, den Wink aus dem Zug, den Brunnen der Zeit. Sie sitzt in der Mensa alsdann, daselbst, wo er einmal gesessen, gegessen ohne Gabel und Messer – und in der Rechten ständig ein abgegriffenes Buch. In sich fraß er hinein, haarstrebend aß er Seiten und Töpfe. „Ein Tier!“, hätte ihr Vater bemerkt oder „so einen“ gar nicht gemerkt. Aber Sarodnick war dies egal, ein langer Weg stand bevor, ein Hunger für sich. Das Mädchen dawider ist Tochter, ist an Wochenenden daheim bei den Lieben, beim Vater, bei sich. Alther stammte das Geschlecht und die Sippschaft, hatte nach allen Kriegen gewonnen und in die vollen Hände gefüllt. Sie überleben, leben lang, und der Staat ist auch nur ein Lied mit einigen Strophen. Alsdann ist der Alltag, und für Habenichtse gibt es nur noch Akkorde – im Tempo bremst sich die Zeit.
Petra gefiel dieser Junge dort zehn Meter weiter. Das Fremde stach sie, zündete sie, das, was sie zu Hause immer verachten, das sie einfach nicht sahen. Zu „erzogen“ war sie jedoch, um ihm dies zu beweisen, um eine Deutung ihm zu gewähren, und nur über „Ecken“ erfuhr Sarodnick es, aus einer halbseidigen Quelle im „Tempel“ von Nerus, der ihm unter dem Dach zuflüsterte: „Unter einer Bedingung!“ Er hatte das doppelte Alter vom Jungen, und er stieg von seiner Zinne über die Straßen, in die Cafés, in die Toiletten vom Park. Seine Haare waren wie Atlas gekämmt, und er puderte sich rosa, zog seine Brauen zum Strich. Hochauf balancierte er dann, fuhr von dem Bahnhof zur Großen Oper und strich die Bedingungen ein. Dies gefiel Sarodnick gut – wie er selbst gerne gefiel –, und er duldete gern sich zu einem Becher zu laden, zu einem Schmaus, ließ unterhalten, ließ es befühlen. Nerus verehrte die Seide, schenkte mit offenem Arm, und reichte Wäsche zum Kleiden, zum Anziehen, aber „sofort!“ – Sarodnick zog in die Hose, über das Hemd und zeigte, was frei war an ihm. „Wenn der mich anfasst, haue ich drauf!“, hielt er sich offen und stand nur in Mode, ging auf den Steg, den Körper vom Dache geneigt.
„Du bist sehr schön“, sagte ihm Nerus, rieb an den Fingern von Martin und ließ sich dann hinter dem Vorhang ins Bett, in dem ein anderer Junge einlag. Sarodnick hörte sie kichern, sah die Schatten kippen im Stoff und packte sich zu, sagte: „Danke. Glückauf!“
„Einen schönen Gruß auch von Petra“, hielt ihm die Stimme vom Jungen hinter dem Store auf, „ich studiere mit ihr.“ – Und dann quiekten sie wieder. Mit Petra in dem Salut ging Sarodnick fort. Er wägte, er zirkelte ab: „Sollte er den beiden da glauben?“ Und er entschied sich für den Versuch.
Sarodnick steigt in die Kantine, nimmt sich die ranzige Butter vom Brot und gießt den Joghurt in die Gedanken. Dann streckt er alle vier zufrieden ins Glas, kauft eine dicke Zigarre und schenkt sie dem alten Wächter am Eingang: „Wenn Monika kommt, lass sie passieren. Das ist diese Blonde mit dem Zeisiggesicht?“
„Wie sieht ein Zeisig denn aus?“
„Sehr fein und sehr blass.“ Der Alte pafft den Qualm durch die Nase: „Ein wenig dick ist sie schon.“
„Kannst du durch die Ohren ausrauchen?“
„Kann ich, aber das Kraut ist zu schwer, es bleibt hängen im Schädel.“
„Das nächste Mal schenk ich dir eine aus Kuba.“
„Oh, Kuba! Das ist eine saubere Sache.“
„Mit Schleife am Bauch.“
„Schleifen sind nicht mehr in Mode.“
„Wieso?“
„So.“
„Ich wollte mich eigentlich baden.“
„Das solltest du öfters noch tun. Die Dusche ist unten im Keller.“ – Sarodnick schlägt das Handtuch gegen den Rauch und bläst seinen Atem gegen die Treppe zum Keller. Leichtherzig verliert er das Hemd und die Hose und hüpft singend und pfeifend aus dem Käfig ins Bad. Dampfwolken stehen im Wege, und er sieht sein Nacktes nicht vor den Augen. Aus dem Brodem steigen Gekicher. Sarodnick nimmt den Nebel als Nebel und zwitschert aufs Horn – er sucht eine freie Kabine.
„Besetzt“, sagt eine sehr hohe Stimme, und Martin erkennt an den Linien die Frau. Nun ist der Dampf bei ihm runter, und die Schwaden klären sich auf. Ein Mädchen ist wie das andere hübsch, und sind dazu noch alle ganz nackt. Sie johlen und jaulen vor Freude: „Ein Mann hat sich verirrt, hat in den süßen Apfel gebissen.“ – Aber Martin ist nicht zumute nach Spaß. Er zieht seinen Mann zwischen die Beine und rennt, was das Zeug hält, durch den Feix und die Äste zum Biegen. Beinahe hätte man ihm ein Loch in den Bauch mit der Schleife gelacht, beinahe wäre alles schiefgegangen in ihm. Jetzt ist er gerettet im Hemd.
„Wieso, was ist los?“, fragt er den Alten mit dem großrunden Stummel in der Hand. „Zieht schlecht, zu feucht.“
„Ich war in der Dusche.“
„Erkälte dich nicht.“
„Da sind Mädchen in ihr.“
„Glück muss der Mensch haben.“ – Aber Sarodnick hat das Glück von der anderen Seite – er hat sich die Finger verbrannt.
„Verdammt heiß!“
„Warum sind die Mädchen da drin?“
„Warte, was ist heute für Tag?“, fragt der Pförtner und die weißmehlige Asche rollt ihm aufs Jackett.
„Dienstag.“
„Dienstag. Natürlich, da baden die Mädchen.“
„Aber du hast doch gesagt …“
„Morgen ihr, übermorgen wieder die Mädchen, Freitag ihr …“
„Und Sonntag?“
„Sonntag sind die Läden dicht und geschlossen. Sonnabend die Mädchen, Montag ihr …“
„Weshalb überhaupt Sonnabend?“, ärgert sich Sarodnick laut. „Weshalb Samstag die Mädchen, weshalb wir Montag, weshalb dieser Scheiß?“
„Die Frau badet vorher, der Mann nachher. Ganz einfach.“ – Und der Alte zieht an dem Rest seiner Zigarre.
4
Die arbeitswillig Gemachten kehren zurück, fröhlich gebräunt mit selbstgebrannten Sprit und alten Ikonen als Dank von den Bauern. Zum ersten Mal begegnet Sarodnick beidem, und er trinkt den Sprit auf den Brettern, die schwarz glänzen und deren aufgemalte Gesichter aussehen wie ein und dasselbe. Wladimir lagert sie verpackt unter das Bett wie einen Schatz, und wenn Martin bittet: „Ich möchte sie sehen“, verachtet ihn Wowa von seinem Estrich herab: „Da. Aber für eine Sekunde. Was verstehst du schon davon!“ – Sarodnick ist verblüfft:
„Ich kenne doch die Heiligen wie du aus der Kirche.“
„Aus eurer Kirche. Es ist nicht die unsere. Die unsere ist gereinigt, sie hat das Bild umgestürzt.“
„Das Bild?“
„Die ewige Form. Bei euch ist es die menschliche Grenze, das Unheilig-Gemachte, die Frau von der Straße. Die Sixtinische steigt herab und nicht in den Himmel, ab zu Fleischmüttern und zu Sybillen. Ihre Heimat ist das florentinische Waschhaus, die Gerberei, und der Vater isst dazu in der Kneipe zu Mittag, in der gleichen Spelunke, in der Winkelmann sich wälzte im Blut.“
„Gott ist zum Menschen geworden“, sagt Sarodnick nur.
„Der Mensch ist sterblich“‚ erwidert Wolodja, „aus seinem Leichnam formt sich die Welt. Auf seinen Schädeln geht der Mensch in die Irre und zerstört die Illusion von dem Ich. Der Mensch hat seine Endform erreicht, er ist bloß ein Elend, und zurückbleibt das Bild.“
„Unseres Bildes, nicht wahr, und es hat …“
„Hat den Menschen vergöttert. Der Unhold trat an die Stelle von Kunst.“
„Er trat aus der Geschichte, aus dem Gemeinen.“
„Du sagst es: aus der Gemeinschaft. Der Dieb ersetzte die Kunst. Wir hingegen in Russland gingen andere Wege. Das Einzige wurde das Werk, das Bleibende, entblättert vom Zufall, vom Ein-Fall. Wir setzten die Messe zum Sakrileg, setzten ins Rituale, ins Zeitlose ein und verklärten.“
Sarodnick ist gelähmt, unfähig zu streiten, kann kein Gegengewicht auf die Waage ihm legen, und er sagt nur: „Und Lenin?“
„Als ob es der Mensch wäre, den man vergöttert! Es ist der Träger einer Idee, wie Johannes für seine Taufe, wie Myschkin bei Dostojewski fürs russische Volk. Steingewordene Schrift ist es, ein Mosaik in dem Chor. Die Symbole aber sind gleich dem Baum Jesse, ein Ausrufezeichen – sie sind Metaphysik.“
„Jedoch gab es die Revolution.“
„Das Volk hat Russland erlöst, nicht das Gewehr, nicht die Schalmei. Unsere Musik ist die Offenbarung, sind die Ketten vom Manifest, sind seine Messer.“
„Es ist wie ein Leitmotiv“‚ schwankt Martin in den Gedanken, „eine Leitmutter, Das Leben an-sich.“
„Neu leben“, erwidert Wladimir nickend, „ein Gedicht für die Taten. Als hätte Lenin ein Menschenantlitz! Das hat er spätestens auf dem Panzerwagen auf dem Finnischen Bahnhof im April 1917 verloren. Er hat es selber zu Grabe getragen, er hat Uljanow zu den Akten gelegt.“
„Und ist in die Geschichte getreten.“
„Aus ihr“, antwortet Wowa‚ „und wir stehen wieder am Anfang: ‚Verehrung des Gottes‘ oder wieder ‚Image‘?“
„Der Anfang vom Bild.“
„Der Anfang von Gott.“
„Steckt eure Ärsche gefälligst unter den Altar! Ich kann das eigene Wort nicht mehr hören“, flucht Samwel darein und wirft die Ikonen Sarodnick auf die Matratze. „Verfeuere sie, Fritz, dann sabberst du wenigstens nicht mehr so dämlich herum.“
„Mit dem 8.Thermidor muss man wieder beginnen“‚ will Wiadimir noch ergänzen, doch Sjoma schreit: „Schnauze!“
„Ich habe gar nichts gesagt“, rechtfertigt sich Martin.
„Dann glotz nicht so hinterfotzig genial!“
„Ich? Ach lass mich!“
„Ich lasse euch beide gleich über meinen Sack springen! Und deine Großmutter kann ihre Gräten auch schon breitmachen.“
Samwel spricht mit einem kaukasischen Sang, voluminös, weit in die Kehle gezogen, und er lässt die Vokale rund auf der Zunge zergehen, bevor sie herausfliegen, behauen, kraftvoll wie Exkremente. „Kellersprache“, denkt Sarodnick‚ „armenisches Ghetto, der Kampf um Behauptung, gegen Verachtung, gegen das Muss des Minderheitseins. Da konnte man nicht zimperlich sein.“
Sjoma besuchte die georgische Schule und lernte Russisch nur als Fremdsprache. Zuhause sprach er armenisch, auf der Straße georgisch und in den Ferienlagern russisch zuweilen. Indes, keine der drei Sprachen beherrscht Samwel gleich, keine perfekt, keine aus vollem Gemüt. Er schreibt grusinisch – spricht aber schlecht, spricht armenisch – schreibt jedoch schlecht, er denkt manchmal russisch und schreibt grusinisch armenische Träume. „Russisch ist unwirklich“, meint er, „Amtssprache nur, eine Verbindung, eine Notwendigkeit.“ – Aus ganzen Rohren wurde Sjoma diese Sprache erst in der Armee beigelernt, bei der Marine: fluchen über dem Bord, ins Wasser spucken und staunen darüber, was es in seiner Haussprache nicht gab. Und der Fluch wurde heilig für ihn.
„Du lästerst wie die Mongolen“, sagt Wolodja schmähend, „die haben uns diese Scheißwörter gebracht, brannten uns ihre Flüche ins Fleisch, und wir latschen sie heute noch aus.“
„Diese Tartarenmongolen haben deine Russen von hinten gefickt!“, winkt der Armenier bloß ab. Er liebt nicht die großen Gespräche, die Ausstellung des Geistes, und er verachtet Sarodnick vor allem dafür. „Ich erschlage ihn tot!“, meint den Deutschen, und Wowa hebt nur abwehrend den Arm. So meidet Sarodnick dieses Zimmer, kehrt sehr spät meist zurück und freundet sich an mit Mais, einem Mann mit Schnurrbart aus Baku, der die Armenier hasst von ganzem Herzen und die Kohle schürt in Sarodnicks Grund:
„Unruhestifter! Alles Kulturemigranten, diese Zucht. Die verschlucken sich noch an ihrer Zivilisation. Immer sind sie auf ihre krummen Riecher gestürzt und haben trotzdem niemals genug. Wohin sind sie denn letzten Endes gekommen? Nach Baku. Stalin hat doch bei uns seine Millionen geklaut und damit die Parteikasse der Bolschewiken gefüllt. Ganz Armenien ist nur eine jämmerliche Provinz.“ Mais ist der Sohn des Ministers für Leichtindustrie Aserbaidschans und hat im vorletzten Studienjahr seinen Platz im Filmstudio von Baku schon sicher. Liebselig warm ist er und gleicht Peter auf Schritt, nennt diesen „meinen Bruder“ und vertrinkt auch die Abende freudig mit ihm. – Eines Abends trifft Sarodnick den Aserbaidschaner wieder bei Peter. Der Wodka brennt in den Augen, und Mais läuft über in Klagen, in Unmut, gräbt eine Herzgrube sich.
„Diese kaukasischen Juden!“, droht er erbärmlich, „meine Freunde beleidigen! Ich werde es ihm schon zeigen!“ – Schwach ist Mais, ziemlich klein in den Beinen: „Die denken, sie wären besser als wir.“ – Die drei trinken sich voll, küssen sich Busengetreue, lieben Maja mit Tränen und fangen von vorn wieder an: „Du bist gut. Der liebe Gott ist ‚einen guten Mann lassen‘.“ – Sarodnick trottet nach Hause.
„Warst du schon wieder bei deinem räudigen Hund?“, stichelt Sjoma und spuckt auf den Teppich. Doch Martin schläft schon friedlich den Rausch aus. An der Tür aber schlägt es: Der Gevatter aus Baku steht auf einem Bein hinter.
„Dein Faschist pennt“, mault Semjon ihn an, „und wacht hoffentlich nie wieder auf. Nacht!“ Indes, Mais hält den Schuh in den Spalt.
„Soll ich dir das Bein aus deinem türkischen Dreckarsche zerren?“, fragt der Armenier und hebt Mais in den Korridor raus.
„Scheißkerl!“, weht der Aserbaidschaner dagegen und krakelt. Ein anderer Junge stellt sich dazwischen:
„Streiten könnt ihr woanders, nicht vor der Tür!“
– „Wichskopp!“ – Mais rennt wutentbrannt gegen die Mauer, zielt mit einem Messer auf Sjoma, stolpert … und trifft nur den Falschen, sticht den vergeblichen Schlichter ins Herz.
Der „Falsche“ verstirbt im Krankenhaus später. Sehr gut war Mais, zu gut für das Leben. Er soll für 10 Jahre in den Knast. Aber … aber sein Vater war doch schließlich Minister. So strich der Vater die Frist und Mais verbrachte nur einige Monate in der Zelle.
Dem Deutschen aber schwimmt seine letzte Hoffnung im Blut, und seine Felle laufen ihm fluchtartig weg durch das Bammeln. Doch unerwartet – ganz über Tag – wirft ein anderer Deutscher den Ring: Werner Kletters, ein Berliner mit blondspeckigem Haupt, hat die Partei am Hemd stecken und studiert im dritten Jahr Dokumentarfilmregie. „Du hättest dich längst schon an mich wenden … gemusst.“
„Ja.“
„Ich werde dir helfen.“ –
Kletters weiß, was er sagt, „auf dem Posten“ ist er allesamt, alleweil, mit Hinz und Kunz informiert und mit Absprachen gesegnet. Er diskutiert nicht lange, er fackelt – Werner Kletters ist Leiter der Gruppe 5 Moskau, für Deutsche. – „Du wohnst vorläufig bei mir in dem Zimmer“, gibt er seine Empfehlung zum Schlechten, und Sarodnick sieht Samwel vorläufig nicht mehr. „Ich überleg’ mir da noch einen Trick, etwas Besonderes für dich“‚ spricht Kletters in Rätseln und rät und verrät wie ein Sieb, das in die Abtritte leert an öffentlichen Gebäuden. Neugierig, aber nicht aufdringlich ist er, hat Ohren wie Ringe und ein Gedächtnis für morgen, für die Stelle anbei. Als Assistent in den Studios von DEFA wusste er schon sehr früh, was man dachte, und wusste auch, was zu denken anstand. Einmal wird er Wissen vermitteln, wisssagen, wissmachen, Wissen befehlen. Im Institut sammelt er auf schickt an, schickt sich zu und füllt das Leben in Akten. Er ist delegiert – assistentenlegiert – von der Nadel der Brust und bewährt sich wie der Nagel im Heu: unmerklich, auf den Kopf zugesagt. Er währt lange und gut.