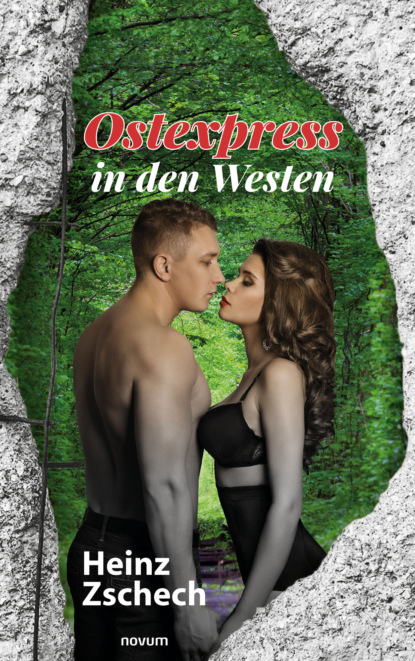- -
- 100%
- +
Kletters ist verliebt über seine großen rosigen Ohren, verliebt in das Unglück, das er in Wodka vergießt. Die halbmondäne Kira braucht Kosmetik und Wäsche aus Deutschland, und Kletters bringt sie in Haufen, bekommt dafür die Hand, selten eine Nacht auch als Gabe, und so sind seine Nächte grüblerisch kalt. Er verdammt die Liebe und Kira, die irgendwo einem anderen Mann ihre deutsche Unterkleidung gerade und geradeaus vorführt. Aufgeschlossen hört Sarodnick diesen täglichen Jammer, verbraucht mit Werner Leid und Trug und er erklärt dem falschen Freunde die deutsche Romantik, das Platonische in einer Beziehung:
„Die Liebe der nutzlosen Träumer, der großen Romantiker verwirklicht, mündet einfach bei Strindberg. Man ist mit den Frauen glücklich – allein.“ – Kletters stöhnt, und Sarodnick zeigt ihm vom Institut einen Brief: „Sie können nicht einfach da wohnen, wo es ihnen so passt.“ – Sollte er womöglich zu Sjoma zurück? „Muss ich alleine mit meinen Problemen mich plagen?“, denkt Werner und setzt sein eigenes Schreiben entgegen: „Im Namen von Sarodnick Martin erkläre ich, dass der noch schlecht schreibende Sarodnick hier bleiben muss, weil ihn ansonsten seine ehemaligen Zimmergenossen stetig beleidigen und bedrohen.“ – Und er ergänzt unter dem Strich, unterstrichen: „Und außerdem ihn mit ‚krummen Geschäften‘ bedrängen.“ – Dieses eingestrichene Wort kann mit Sicherheit alles Mögliche wohl bedeuten: Es steht für vieles – für Stiefel, für Kleider, Rasierwasser und Seife im Kern – verkauft, verhökert, verschoben. Das Wort duftet nach Nebel und Nacht und hat etwas Verbotenes pappen. Sarodnick freilich schnuppert nur dran und setzt naiv seinen Namen dahinter.
„Mach schnell, ich hab’ keine Zeit. Alles wird, wie ich will.“ – Alles.
Wladimir und Samwel erhalten eine Verwarnung: Der Direktor warnt und droht ihnen scharf mit dem Rausschmiss! – Martin aber muss trotzdem zurück in das Zimmer, ins Feuer, zurück in die Hölle. In der Botschaft indes notiert Kletters minuziös diesen Fall:
„Sarodnick handelt mit suspekten Leuten suspekte Ware.“ – So hat Martin einen Minuspunkt sich gehandelt, und Kletters unkte ihn aus.
5
Glattleck, ohne Portal mit einem Blendbogen wie eine Fest-Halle geschmiedet, blickt die Filmhochschule aus etwas zu breiten Fenstern auf die Gärten der Volkswirtschaftsausstellung. Innen verschließt sich ein Foyer mit einer kurzen Barriere, an der der Pförtner seinen guten Tag hockt. Dahinter ist Ende, nur für Eingeweihte betretbar, vom Wächter geprüft, bis klar wird „dieser gehört hier wohl zu“.
„Ihren Ausweis?“ – Martin kramt in der Tasche. „Der nächste!“ –
Er kann nicht verstehen. Der Wächter steht auf, legt die Hand auf die Sperre, um sie dann handlich verlängern zu können: „Sie wollten wohl einfach so durchschlüpfen?“
„Ich studiere doch hier“, erklärt Sarodnick, prallt aber ohne Mitleid auf einen abgewandten Rücken: Durch zu viele Bitten hat der Pförtner die Rührung verlernt.
„Vorschrift“, sagt er nur zäh. – Durchhalten, anhören, abweisen. „Fragen sind dort am Fenster zu klären. Zwei Meter weiter zurück!“
„Aber Sie kennen mich ja.“
„Na und?“
„Ich gehöre hierher.“
„Ich weiß.“
„Also.“
„Dein Ausweis!“
„Ich habe ihn im Internat liegenlassen, habe heute Morgen eine falsche Jacke übergezogen.“
„Ist die gefüttert, Martin?“ –
„Ja, es ist heuer kälter geworden.“
„Bei euch ist es um diese Zeit bestimmt noch warm?“
„Und ob.“ – Sarodnick drückt sich vor die Barriere.
„Deinen Ausweis!“
„Aber ich …“ Martin schaut in das Fenster dahinter: „Guten Tag!“
„Ach, der Deutsche! Wie geht’s?“
„Ich habe mein Büchlein vergessen.“
„Und ich dachte, die Deutschen vergessen nie.“
„Ausnahmeweise“, stellt er sich traurig.
„Geh nach Hause und hol ihn“‚ rät sie ihm freundlich.
„Zum Platzen!“, rutscht es ihm aus dem Mund, erinnert sich aber geschwind: zwei Kilometer hin und zwei wieder her. „Bitte!“, ist er erbärmlich und schön. Die Frau schaut aus ihrem Kiosk, greift zum Hörer und telefoniert. Irgendwann steigt die Sekretärin herab:
„Alle gesund? Wie bist du gestern nach Hause gekommen?“ – Die Schalterdame bedankt sich und erzählt ihre Geschichte. Sarodnick hüstelt dazwischen, die Frau starrt, erinnert sich später und fragt: „Kennst du diesen Jungen?“
„Ja.“
„Studiert er bei uns?“
„Natürlich.“
„Gut. Ihren Namen?“
„Aber …! Martin Sarodnick.“
„Fakultät?“
„Regie.“
„Hier! Ihren Passierschein.“ – Sarodnick nimmt den Zettel und gibt ihn dem Pförtner. Der überprüft und trägt ihn wieder zum Glashaus.
„Alles in Ordnung.“ – Sarodnick steht vor der Barriere.
An der Garderobe grüßt er fünfmal fünf Frauen: „Was stricken Sie heut?“
„Wie geht’s in Berlin?“ –
„War das eine Freundin von dir gestern im GUM?“
„Nur so.“
„Na!“
„Meine Jacke.“
„Ist die von euch?“
„Ja, – meine Jacke!“
„Swetlana ist dran.“
„Nein“‚ streitet Swetlana, „ich habe doch den vorvorletzten Mantel gehängt.“
„Unmöglich!“
„Meine Jacke.“
„Nina, du!
„Wieso?“ –
„Und Ludmila, die schläft.“ – Sarodnick ist es egal, er legt die Jacke über den Tisch:
„Die Marke hole ich mir später.“
Altvertraut-heimisch präsentiert sich das Institut, bringt die Schulzeit ins Gedächtnis zurück und beschützt seine Kinder wie eine langgestrichelte Pute. Jeder einzelne Wurf rückt eng miteinander zusammen, kennt aus- und inwendig sich, arbeitet und verbringt auch die Freizeit gemeinsam. Die Vorlesungen bezeichnen sich so nur, sind in Wirklichkeit Seminare, Unterrichtsstunden mit Partnern, und das Lesen ist Unterhalten, Schöpfen im Spaß. Eine Linie folgt sich befreit, angerissen gekappt, und die Fragen gehen dazwischen, lenken ins Wasser, ins Lose: „Wo waren wir eigentlich stehengeblieben?“ – aber der Unterricht ist schon vorbei. „Lesen Sie selbst nach!“ – Die Stunde ging ein. „Geklärt.“ –
Der Stoff füllt sich – nicht trockenvöllig zur Rampe –, die Zeit wird gesäumt und gedacht.
Sarodnick schaut auf den Mund, schreibt jede Bewegung der Lippen und versteht jede dritte davon. Erstrangig sitzt er, die Sicht nach hinten verlegt zu den anderen Mitkommilitonen, die nie vollzählig, besonders am Morgen, die Distanz halten auf Dauer und dort mehr sehen als er. Vorbild und bildend lauscht er auf seiner Bank, bildet sich ein alles zu hören und hört seine Nachbarn sich streiten. „Pst!“ – ganz hinten träumen Schauspielstudentinnen. Sarodnick lässt sich alles vorlesen, notiert, lernt russisch einschreiben, den Kopf russisch verschmelzen, und er schmilzt mählich ins Land. Manche Studenten sind freigestellt von den Unterrichtsstunden, sie haben schon früher Fächer abgeschlossen und Zweige und haben Diplome im Lohn. Andere wieder kommen frisch von der Schule und backen noch dran. Das Land schüttet mit Formen, die ausgliedernd sind. Man studiert, lernt, wenn es beliebt, und was angetan ist. Jeder beschließt seine zehn Klassen und öffnet sich damit einheitlich gleich – gleich bis zum gleichen Gericht.
Eifrig aber eilt Sarodnick alle Vorlesungen ab. Ihm gefällt das Verschieden im Interpretieren, die Würze in Lücken, der Klang, das asymmetrisch Verdrehte. –
„Die Geschichte unserer Partei …“, Grigorenko atmet eine längere Pause, „ist uns nicht Rednerpult nur.“ – „Die Revolution handelt verschwiegen“, schreibt Sarodnick auf, und er macht ein Sternchen ins Heft: „Wurde da Stalin zitiert?“ Unvorsichtig und wiederholt wird in den alten Schriften gekramt, kleinlaut, verständlich.
„Die Zeit überlebt.“ – Grigorenko legt die wenigen Haare nach hinten. „Ich will Namen nicht nennen.“ – Das Halleluja des Gewissens beginnt. „Sie ist immer einen Abschnitt voraus, eine Walze, die überfährt, über und über – manchmal gar auch den Fahrer.“ Er lächelt verschmitzt. „Frieden bedeutet Umwege gehen – wie der Sieg und die Chance. Die Revolution rettet sich selbst. – Wir können nicht vor Gewehren nur stehen, wir vertuen im Kleinen. Natürlich gab es Rapallo, gab es leise Beziehungen zum Westen, lebten Versprechen. Wir aber mussten uns mausern, häuten. Ein Maul wollte zu fressen, und das Land lag im Brach, der Lehrling stand ohne Meister, das Geld machte sich rar. Bei uns blieb der Letzte zurück. Der Bruder schlug den Bruder und wurde aus dem Paradiese gejagt.“ – Der Professor hält fest und rückt einen Schritt vor, mehr gedämpft: „Man konnte nicht ewig auf Mitziehen warten, auf Nachkünfte, auf neugeborene Erben.
Trotzki musste sterben, wenn man weiterleben hier wollte. Auch schiefe Bahnen sind gerade, und es musste laufen, koste es, was es solle, sei es selbst im Zurückpfeifen, im Zurückschießen der ewig Morgigen, die den Zeitgeist verspielten, die den Karren umstießen und einen neuen haben wollten anstelle. Sicher: Nicht in Gute und Schlechte sondert die Welt, nicht Pfähle werden gepflockt an den Gittern. Erde funktioniert nur als Ganzes, und das Glück als Flucht bricht sich das Genick. Indes, wird nicht der gute Wille aufgesogen von dem Unwill der erschreckt Stehengebliebenen in den ach so klügeren Staaten des Westens?“
Sarodnick zählt die Zeilen, nummeriert das Blatt und findet schwer den geeigneten Platz, ist sich nicht sicher, ob er begriff oder ob er daneben nur hört, und die Logik Grigorenkos bloß mit der seinen vertauscht. Er legt die Feder zur Bank, versucht, sich zu konzentrieren, zu ermessen, was der Professor – kaltmienig fast, ohne die Wimpern – zum Fenster ausspricht. Jedoch irgendetwas hemmt ihn da bei, als traut er sich nicht, als fehlte der Mut.
„Ergo erschoss sich Majakowski, um die Front zu verkürzen, den Ausgleich wider den Kleinhandel, die Kleinlichkeit, den Kleinmut in die Waage zu werfen; ergo schmiss Lunatscharski den Hut, damit die Bildung gedeihe auf Teufel komm raus; ergo blühte der Realismus von Gorki, dem LEF und dem Proletkult zum Trotz. – Wir brauchen die Erde, und wenn es nur für die Brotsamen wäre. Wir müssen suchen, sammeln, zählen wie einst im Mai – was ist da schon ein Oktober? Reden sollen andere, die langen Worte mit dem kurzen Sinn sind zu Ende. Es normt sich derzeit, plant im Namen des Bestehenden, des Bestehens gegen die Welt und mit ihr. Wir wollen so werden wie sie, ja, ein wenig noch besser.“ – Der Professor sieht auf. „Gut, diese Freiheit! Die sitzt in den Köpfen wie Spuk. Wie aber hätte man wirtschaften sollen ohne die Wirtschaft? Diese vielsagende Freiheit ist nichts, die nur erhebt, die nicht einmal weiß, was sie wert ist, nicht wiegt.“ – Draußen klingelt es. Grigorenko dreht sich halb zu der Tür: „Ich hasse Leute, die den Ausgang der Geschichte nicht kennen.“ – Und der Lektor geht rasch raus ohne Gruß.
Sarodnick malt ein Dreieck aufs Blatt. Wie unklar ist doch alles für ihn, wie flau. Mit wem sollte er reden darüber? Die Zunge hat er noch nicht, die Winke, die Gänge. Und so schreibt er Briefe nach Hause, erklärt sich Petra, verklärt in den Seiten an sie. Ein Heimweh fordert ihn ab, eine Unruhe, eine Einsamkeit zehrt. Im Internat stößt er auf volle Räume, findet Briefe von Petra zu spät, findet Monika, die ihn drängt, die für ihn konzipiert, projektiert und hilft, wo es nicht hilft. Und er findet in seiner Stube ein kaltes Bett und ein sauberes Laken darauf. Sarodnick stolziert in das Tun, tut, als wäre er beschäftigt, macht die Zeit rar und rarer, hastet vom Institut zum Internat. Ein Hörgang ist es für ihn, ein Gang in das Nutzen, und lästig wird es ihm bei, zu Lasten geht es, und er besucht nur den Trott, das andere Sich. Die Einzige, die neben ihm wandelt – geduldet – ist Monika noch. Kurzbleibig zwar – der Weg ist lang von der Bahn bis zur letzten –, ist ein welliges Sitzen, ein Blick, eine Frage; dann ist sie wieder vorbei. Martin braucht sie, schöpft wie im Brunnen in ihr, und er wünscht, dass sie ihren Ursprung preisgibt in dieser Sprache, dass sie ihm zuhört, wie er deutsch mit ihr spricht.
„Dein fehlender Ausdruck ist es, der leidet“, sagt sie ihm, und er gibt ihr bloß Recht:
„Ein spröder Stein in dem Mund, und dazu Idiome.“
Monika hält hin, lässt ihn glänzen, der so viel Glanz schon verlor neben anderem Geist. „Ich muss Dampf ablassen“, entschuldigt er sich, „mir fehlt das Glatte, ich zimmere grob.“
„Nicht doch!“, rückt Monika auf. Sie ist müde geworden, möchte einlenken und ablenken: „Fahren wir doch morgen einfach irgendwo hin.“
„Warum?“
„Ich kann es nicht schaffen immer zwischen Bereitschaft und Pflicht.“ – Er will sie hinaushetzen, sich eingraben und heulen, doch küsst er sie zag – wie ein volles Zimmer ihm es erlaubt.
„Mein Anspruch ist zu gesteckt, zum Fassen ganz fern.“
„Ein Geständnis?“, fragt sie.
„Mehr resignativ“, wehrt er ab, „ein Rauschen und manchmal ein Sich-fallenlassen-Wollen, aber wohin?“
„Nicht gut ist es“‚ gibt Monika zu bedenken, „es ist das Nicht-mehr-gut-Zumachende, seinen Hut nehmen oder seinen Schuh stehenlassen und gehen.“
„Ich weiß“, ist Sarodnick selbst überrascht, „der letzte Hinweis, die Spur, und weiter kann keiner mehr folgen – bis zu der Stelle, der Marke, dem Zeichen, dem Fuß in dem Felsen.“
„Ein Pferdefuß ist es, ob Ölberg oder Felsenmoschee.“
„Aber ein Zeichen.“
„Walpurgisnacht“‚ lacht Monika auf. „Du hast’s mit den Hexen, ich sagte es doch.“ –
Die Zweischneidigkeit, dieses Ungewisse lockte Martin, verführte ihn hin bis zur Gefahr. „Ist es das Böse? Die Lästerung? Oder nur nichts?“, fragt er sich jetzt.
„Ein zugeschütteter Abgrund“, wirft Monika ein. „Was sind wir denn sonst?“
„Nein“, widerspricht Martin. „Wir sind mehr – mehr oder minder. Wir sind Ausgang, Übergang, ein Präludium zum großen Stück Wunder, eine Saaltür am Eintritt, ein Torbogen. – Erinnerst du dich? Halle.“
„Natürlich, mein Lieber.“
„Dahinter war nichts. Das Schloss war im Kriege geblieben.“
Sarodnicks Kindheit schaute in die Ruinen hinein. Dieses Noch-nicht-Vollendete, das Nie-Vollendbare geisterte, begeisterte ihn. Ganz egal war ihm die Frage: „Wird es ein Haus oder war es mal eins?“ Um das Weder-Noch, das Zwischendrin-Sein ging es ihm doch, das Halbe im Ganzen, die Trümmer als Werk. Sehr traurig konnte er werden, wenn sie plötzlich geräumt waren, irgendwann nach der Zeit. Gestern standen sie noch, waren beendet und rein, als wären sie ewig, und heuer Enttäuschung, das fertige Haus, an dem Martin das Kribbelige seiner Leitidee misste: „Und möglicherweise ist es gar keins?“ – Er hasste Baustellen, das Fertigstellen, die Schlüsselübergabe. Mit dem Richtfest starb für ihn das Interesse, der Bund und das Eins. Wie traurig war es für ihn, als man in Leipzig die Universitätskirche sprengte. Fremdprotestierend stand er am Platze, an der Sperre vor der Oper da. Auswärtig fern, unsolidarisch drängte er mit der Masse, die Restaurierung wünschte statt Abriss, Kirche statt Mensa, Bewahrung statt Revolution.
Sorgfältig mied er das Ganze. Es zog ihn nach Paulinzella, in die Ruinen zwischen Mauern zu Säulen, die den Himmel abstützten, und wo auf den Altar der Regen jetzt schlug. An der Hand der Großmutter spazierte Martin durch Dresden, und sie erzählte vom Krieg, von diesem Februar 45. Nichts explizierte sie, sagte nicht: „Dies war das gewesen“ und „So sah jenes mal aus“. Sie schwieg, zeigte das Nichtgesichtete nur, das Hinter-Dem, das, was noch stand: die Keller, der offene Stall, die geworfenen Steine. „Von Gott ist es nicht“‚ bemerkte sie und ergänzte: „Es ist für die Ewigkeit da.“ – Für Sarodnick war es vollkommen, aus einem Guss, war Andeutung, unbrauchbar unnütz, war eine Nachhalligkeit. „Kunst“‚ staunte er‚ „außerhalb der Vernichtung und doch nahe daran.“
Das Fast-Fertige, Nie-Fertiggewordene war es, ein „Beinah-Nichtzerstörtes und doch Zerstörtes“, das versteckte Chaos, das nicht geordnete Wachsen – ein babylonischer Turm. Es war das fragmentarische „Fort und fort“, das nicht zu Ende gesprochene Wort, das Sarodnick anzog, das er pries und himmelhoch hob. „Nicht der Goethe, der noch einmal entsiegelt und ändert“‚ sagte er einmal, „sondern der Urfaust, die Marienbader Elegie, die hilflos vollendet, geworfen als letzter Gruß und nicht aus letztem Erdenken, nicht Wilhelm Meister, sondern Mignon, nicht Iphigenie, sondern das Exil dort in Rom.“ – Das Demetrius-Fragment feierte er als Schillers „göttlichstes Werk“, als „Nur-Plan“, der planlos mündet in Tod. „Erst der hingeschlachtete Zarewitsch war der ideale Herrscher geworden, der Große, der Retter am Volk. Und kam Schillers Reife nicht selbst auch kurz vor dem Tod oder gar ein wenig danach?“ – War Martin gesund? Steckte da nicht vielmehr auch seine Angst vor der Steigerung, vor der Ruhe? Erregte er sich nicht in dem Kuss und wich doch der Zärtlichkeit aus? Oder war es kein Ausweichen, war nur ein Unvermögen aus dem Anfang zu kommen und den Schlussstein zu setzen? Häufig war es freilich das andere auch, die Heftigkeit, das Wollen ohne die führende Hand, ohne Verflechtung und Dialog – ein Ausrutschen, ein Erschlaffen, ein Absacken, eine zerstörte Berührung, die den Guss antizipiert ohne Wert, ohne Erlösung. – Und das Spiel mit Petra? Lief es nicht aus den gleichen Bahnen heraus? Ging es nicht aus von den Sinnen, von der Bereitschaft, um jäh abzuknicken, wegzutreten ohne Vollenden? Und trotz des Drängens, des Gärens in ihm, ließ ihm das „Sich-verströmen-Bevor“, vor dem eigentlichen
Ineinandergeflossen, traurig zurückfahren zu sich – in den Schlaf. Auch Monika ist ihm Fragment, abgeschlossen in seiner Latenz und seinem angedeuteten Alles. Unbeholfen genau spürt Sarodnick, dass alles so bleibt und bleiben wird für die Jahre ohne Hoffnung auf Wachsen. Auch möchte er nicht, setzt auf das Nichts, ja, es behagt ihm gar so in der Haut. Und möglichenfalls waren alle seine Beziehungen lediglich ein Torso gewesen, ein steckengebliebener Anfang, der einen miserablen und damit vergessen Sturz in ihm birgt? Möglicherweise. – Martin blickt sich nach Monika um. „Sie ist schon gegangen“, denkt er. „Sie wird gehen und kommen.“ –
Monika ist gerne gesehen, und zuerst und vor allem heizt sich Samwel an ihr, kann „auf Solche“ und „Solche“, „auf Norden“ und „Weiß wie der Schaum und das Sperma“, und in Worten kleidet er sie aus bis zum Grunde: „Meine stehende Angebetete springt mir ins Auge, ins Glied. Komm, leg dich zu mir!“ – Monika zupft an den Lippen und schweigt:
Zu nichtssagend ist ihr der Sturm, das mütterliche Liebeserklären: „Ich muss zwischen deine Beine hinein …!“ – Doch Sarodnick kommt es entgegen, ist ihm gelegen. Monika ist wie vorgeschoben für ihn, ist ein Treppchen zu Samwel vorab, ein Versuch, ein Lockvogel, um ihn für sich zu gewinnen. Und eines Tages ist es dann auch so weit an der Zeit: Der Armenier spricht Sarodnick an. Mit abgewandtem Rücken redet er zu ihm, ohne Schnörkel und Floskel: „Jeder von uns muss etwas spielen, ein Stück von einem Stück. Wir könnten doch zusammen das machen.“ –
„Wir?“ – Doch diese Frage stellte sich nicht. Heimliche Freude, Schaden-Freude erfasst Sarodnick, und darin liegt auch ein wenig von Furcht. „Was sollte es sein?“
„Brecht.“
„Brecht?“ – Die beiden entscheiden, den Hatelmaberg zu besteigen – „Herr Puntila und sein Knecht Matti.“
6
Wochen probieren sich zähe, und ein Problem stellt sich für Samwel und Martin: einsteigen oder dabeistehen? Äußerung oder Selbstäußerung? Wie muss man den Dramatiker spielen? Darf man ihn überhaupt heute noch spielen?
„Spiel ist Trieb – wie eine Frau besteigen“, sagt Sjoma. „Brecht ist die Erklärung dazu“, kontert Sarodnick.
„Hängengeblieben beim Vögeln.“
„Soll man den Herzschlag nehmen oder das zwischen zwei Schlägen?“
„Handeln will ich, nicht quatschen!“, lärmt der Armenier dazwischen, „wie Hamlet am Schluss.“
„Verwerflich“, denkt Martin. „Ist nicht jedes Handeln verwerflich, wenn es vom Einzelnen kommt? – . Brecht ist keine Methode für euch“, sagt er laut. „Weder im Institut noch in Moskau.“
„Keine Mode.“
„Kein Stanislawski.“ Sarodnick ist sich bewusst, dass es mit Hauruck hier nicht geht.
„Klugscheißer“‚ spottet Semjon. Wen aber meinte er damit? Die Sinne begehrt er, den Witz, die Freude dabei, möchte gestikulieren, laut lachen und schmausen, während der Deutsche stoppt, den Knüppel in den Weg wirft und interpunktiert:
„Zäsuren!“, kommandiert er. „Du bemerkst nichts hinter der Nische.“
„Ich pinkele drauf.“
„Prima! Wir markieren die Ecken.“
„Den Schädel rasieren, damit man ihn sieht“‚ grölt Samwel.
„Hier muss ich stoßen, und du haust mit Vergnügen dazu.“ –
„Und rein, rein und wieder rein!“ – Sie lachen gemeinsam, und der Armenier freut sich darüber: „Siehst du wohl selber jetzt, als ob man jedes Lachen erklären kann! Man lacht, wie man’s versteht.“
„Dass man’s versteht.“
„Darauf wichs ich mir einen! Entweder kommt’s oder kommt’s nicht.“
„Und wenn’s kommt?“
„Feix ich.“
„Warum?“
„Arsch! Weils eben kommt.“
„Und warum kommt’s?“
„Weil ich feix .Ach, geh mir nicht auf die Eier!“ –
Samwel spielt Matti, Martin den Herrn. Der Herr ist gut, wenn er trinkt, und er ist, wie er ist, wenn er nüchtern geworden, ist, wie er sein muss – ein Herr. Ein Herz hat er nur, wenn er säuft, denn sonst wäre er doch kein Herr. Man kann nicht gut sein, wo die Dinge nicht gut, und sie sind es nun einmal nicht.
„Es gibt einstige Knechte, die sind nicht mal besoffen human“, konstatiert Martin.
„Einen Dreck hat es sich heute geändert“, brummt Sjoma, „das heißt: Nur die ehemaligen Wichsköpfe sind besser geworden. Ein Hungerleider ist immer ne Jungfer und fickst du sie, tritt sie dir hinterher in den Sack.“
Semjon spielt den „Noch bin ich Knecht“ mit Verwarnung, will er doch werden wie Puntila selbst. – So reicht er die Stühle, die Tische, die Schränke zum Berg, bis es ausreicht zum Haufen und man rechtzeitig nüchtern wird drauf. Sarodnick aber wittert die Nase: Er könnte sein „Herr sein“ versaufen. Ausgelassen schreit er ihm seine Gutmütigkeit ins Gesicht:
„Die Wiese dort ist meine geworden. Der Stall, die Pferde, die Knechte, – der Knecht. Du bist mein!“
„Ja, mein Herr, trinken Sie weiter.“ – Und dies könnte dem Knecht auch so passen, es wird seine Stunde bald kommen.
Jede Nacht ist das Klavierzimmer voll. Sarodnick klebt sich den Text in den Schädel und das oft mit Gewalt, fühlt er doch nicht jedes der Worte, schwingt es nicht so wie im Deutschen für ihn. „Auswendiglernen! Nach dem hundertsten Mal sitzt’s – wie der Nagel in den eigenen Knochen“‚ instruiert Sjoma und korrigiert ihn manchmal falsch: Die Betonung liegt auf Armenisch, und das ist Tausende Kilometer daneben. Martin indes spricht mit Brecht, lernt ihn noch einmal, so wie er Tschechow auswendig lernt, und er holt so manchen Satz aus dem Kasten an unrichtiger Stelle. Wie schön sind schöne Worte getan, Brecht mit Tschechow vertauscht, und am Abend in der Kantine mit den Kameraden darüber sich streiten: „Zum Brechen und Tschechen.“ – Aber Sarodnick möchte ja reden. Und klug reden kann er nur durch Imitation. Im eigenen Kopf ist keine Ordnung gemacht – wie sollte er auch sein Chaos denn übersetzen? Also redet er wie gelesen, und die Mädchen sagen: „Faselt der blöd!“, und: „Er ziert sich wie eine Kanne.“ – So gießt er seinen Inhalt nicht aus und ist ein gehaltener Bursche. Womöglich ist er deshalb Brecht auf der Ferse: Er interpretiert die Gefühle. Und lange noch wird er zu Tschechow nicht finden. – Er trainiert im Heim „Puntila und sein Knecht Matti“, und Semjon langt alle Möbel hinauf. Das Internat steht ihm Kopf, die Stühle sind bereits alle auf der Szene gesetzt. Aber man lacht: „Nur etwas lauter noch, Martin!“ – und Sarodnick hält Hitlers Rede zum ersten Mal. Wie eine Ebbe ist sie, wie ein Zögern die Scham, wie ein Knecht ist der Redner, der sich anbiedert und urplötzlich ausbricht dann als Vulkan, die Stühle zerschmetternd im Steigen. Der Schrei, der Herrenschrei drückt die Faust in den Nacken, ist zur Geste offen unter dem Tisch. – „Dieser Herr hat sich niemals besoffen.“
„Bravo!“, macht Sjoma. „Man könnte sich aufreißen lassen. Ohne Kommas gesprochen, die Zeichen woanders gesetzt, und Millionen Deutsche grölten Sieg Heil! – Ohne Kommas gesprochen?“ – Puntila röhrt nur im Trunk, er hat’s noch nicht nötig, die Umstände sind noch nicht nötig, die Faust sitzt noch unausgesprochen gehorsam. „Die Knechte sind einfach klüger geworden“, weiß Sjoma, „die Knechte spielen Theater.“ –