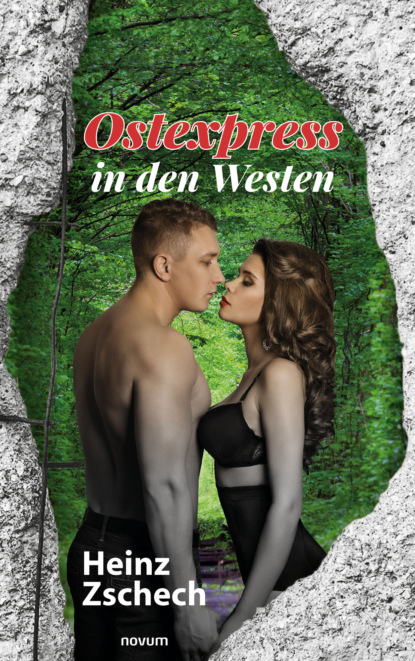- -
- 100%
- +
„Von dort fahren die Schiffe ab über die Moskwa zur Wolga. – Hier an diesem Bahnhof bin ich angekommen mit dem Zug, damals im Sommer.“ – Petra streichelt die Hand:
„Ich bin sehr glücklich bei dir.“
Sarodnick schläft im Hotel Bukarest an dem Fluss, und die beiden sind froh, sich wiederzusehen, wieder zu spüren nach so langer Zeit. „Wann habe ich bloß das letzte Mal im Hotel …? Habe ich überhaupt im Hotel …?“ Im Hotel ist alles inklusive: die Wäsche, die Liebe, das Wasser im Bad. „Wie lange haben wir uns nicht mehr gefasst?“
„Es ist wie …“
„Du.“ – Ein Hauch weht über die Lippen.
„Hast du etwas bemerkt?“
„Nein. Das ist Moskau, über dem Fluss.“
Sie fahren mit der reisenden Gruppe im Bus, und Sarodnick erlebt die Stadt zum ersten Mal als ein Tourist.
„Ist die aber groß!“
„Da kannst du mal sehen.“
„Jeder Pavillon war früher unseren fünfzehn Sowjetrepubliken gewidmet“, erklärt Wolodja in der Volkswirtschaftsausstellung. „Man kann die Konturen und Buchstaben von den vormaligen Losungen noch erkennen: Stalin und Stalin und Stalin … – Lissitzky hatte dem Bau die Hand anlegen wollen. Als wäre man noch bei 1920 gewesen!“ Im Panoramakino kugeln sich die drei fast ihren Kopf aus für hundert Kopeken, als seien sie mitten dabei. Und sie ducken sich von den Schmerzen im Rücken.
„Das ist die Zukunft des Films“, erläutert ihnen Wladimir. –
„Das ist Semjon-Sjoma, das ist Ljuba, das ist Jura – ein Film-Ökonom“, stellt Martin seine Freunde ihr vor.
„Zum Einfließen schön ist deine Petra“, sagt Samwel, und geniert öffnet Wladimir die Flasche mit Wodka. „Ich tuckel nur Wein“, bemerkt der Armenier, und Wladimir gesteht:
„Ich trinke eigentlich nicht.“ – Galant ausgeschwungen spricht er zu Petra, aber das Mädchen kann nicht schwingen mit ihm – sie lässt es sich übersetzen, unübersetzt.
„Dieses mit den Kanonen vor der Blende über dem Tor …– haben Sie es schon visitiert?“ Petra lacht über den Ton.
„Das ist das Museum der Revolution!“ Sie entschuldigt sich rasch: „Bei meinen paar Tagen! Ich kann nicht alles besuchen.“
„Schade. Sehr schade. Einmal war es der englische Club, und man speiste dort ein Menü à la Zar – extravagant und superb.“
Jura hat für Samwel Portwein für einen Rubel zwanzig besorgt.
„Auf ihrer ersten Voyage in unserem Land!“, prostet Wowa und hebt das Glas. Rasch hat der Ökonom, der Ukrainer aus Kiew, den Klaren aus dem Auge verloren, und er lacht nur noch aus Spaß.
„Das kann heiter noch enden!“ –
„Auf Deutschland. Prost!“
„Ihr Vater war in Russland gewesen?“
„Keine Geschichten!“, ermahnt Samwel den Ukrainer.
„Dort in der Passage hat sich Majakowski erschossen.“
„Dann wollen wir nicht mehr stören“, rüstet die schüchterne Ljuba zum Abgang. Doch die Getroffenen bleiben stumm und stumpf in den Sesseln. Nur Wladimir weiß, was sich gehört, und er küsst die Hand der „Deutschen Madame“: „Auf Wiedersehen! Es war mir eine sehr große Ehre, mit einer solchen Dame zu konversieren.“ – Wolodja und Ljuba verlassen das Paar. Die anderen aber prusten, lallen und lecken den mickerigen Rest aus den Flaschen.
„Du musst nämlich wissen, Wowa, der spinnt“‚ wird der Armenier sehr deutlich. Für Petra aber ist alles prima und „nett“: „nette Leute“, „netter Abend“, „nettes Gespräch“. „So viel habe ich lange schon nicht mehr getrunken!“
Ein normaler gewöhnlicher Tag: Alle besaufen sich, umarmen sich, schlecken sich ab und finden – „welch ein Wunder!“ – hinterher noch ihre Betten. Am nächsten Morgen kommt man natürlich zu spät zu den Seminaren, und der Kopf brüllt zum Schreien: „War ich gestern voll leerem Stroh!“ – Jetzt aber spielt es keine Geige, die Saiten sind vollzählig, sind mit Seife geschmiert, und es rutscht wie in den besten Konzerten. „Auf unser schönes deutsches Mädchen!“ – Und man prostet die ganze Familie und lässt sie in Toasten und Trinksprüchen hochleben. Es bleiben die Toten noch über: „Tränke man bis zum Jüngsten Gericht …!“ „Um die Ecke, zur Neglinnaja hin, war einst der deutsche Bezirk“‚ weist Samwel ausschweifend breit aus und lässt noch einmal sich nachschenken. „1914 wurde er reif zum Prügeln und Massakrieren geschlagen.“
„Was konnten denn die armen Leute dafür, für den Krieg?“, fragt Petra.
„Wer konnte dafür? Pogrome sind Abwehr. Das geht weit ins Abstrakte“, antwortet Jura.
„Einige wurden sogar selbst von den eigenen Leuten inszeniert und dann an die große Glocke gehängt. Siehe Odessa“, erinnert der Armenier.
„Stimmt! Wie im Film.“
„Bloß die Ausländer hatten die Genehmigung mit Wodka zu handeln.“
„In Russland! Stellst du dir das mal vor? Das Trinken kommt hier noch vor dem Saufen.“ –
Sehr spät löst man das Häufchen auf in dem Glück. Man hat sich getroffen. Halb fallend stützen sich Jura und Samwel in die wartende Taxe.
Martin schläft sich bei Petra, hält inne, überlegt: „Ist es Zeit? – Noch ein Weilchen. Es ist so gut, nahe zu sein.“ – Er küsst ihre Zähne, wechselt den Takt und verendet im Nabel: „Es ist kummervoll, sich trennen zu müssen.“
Auf dem Flugplatz, am Arm, ist Petra wieder sehr traurig. Der Koffer, die Souvenirs, der Sekt … „Wann seh’ ich dich wieder?“
„Im Sommer. Du organisierst ihn wie immer für mich?“
„Martin.“ Sie küsst ihn und schaut noch einmal über die Barriere vom Zoll, schaut prüfend, streichelnd, ein klein wenig jedoch höher auf seine Stirn, da wo die Augenbrauen beginnen.
„Wie ihr Vater damals, als er uns zum Bahnhof gefahren“‚ fällt es – wie die Schuppen vom Haar – Sarodnick ein.
Martin hatte sich damals mit Petra im Hecksitz versteckt, brav, ängstlich: Der Vater führte vorn auf dem Bock. Ihre Finger berührten sich keusch, und der „Fahrer“ sagte den Weg über kein Wort, hatte die Hände, die durch lederne, kleinlöchrige Handschuhe mattfarben schimmerten, spielend auf das Lenkrad gelegt. Ordentlich hielt er das Wagenfenster geschlossen, wegen der Hitze draußen und auch der Haare schon wegen, die im Fahrtwinde ihre Fasson einbüßen könnten und selbst ihren pomadigen Glanz. Er blickte nicht in die Seite, und er fuhr sehr schnell durch die Stadt. „Hat er es eilig? Oder ist er nervös?“, überlegte Martin. Petra hatte ihm doch bestätigt, dass der Vater nicht dagegen war, dass sie verreiste mit ihm. – Der Handschuh fingerte an dem Spiegel, und der Blick des Vaters in ihm fiel auf den Jungen. Der stahl sich hinaus, wich diesem Blickfeld, drehte zum Fenster sich ab, kam zurück, zu Petra, knöpfte am Hemd. Der Blick aber spiegelte ihn. „Was begafft er mich wie einen Esel“, fragte er sich und wurde sesshaft, standhaft, heftete sein Auge ins andere Auge, ins Auge im Spiegel: „Na und?!“ – Der frierende Guck wurde weicher, vom „Lang-Sehen“ weich, streifend-streichelnd. Und abweit verschleierte er sich in den Brauen des Jungen. Wieder und wieder spiegelte Martin – eine Wand, eine Fläche, ein See. „Es kann mich sehen, wer will!“ – Plötzlich stieß sein Kinn hart gegen die Lehne des Vordersitzes auf. Er rieb es, schaute auf: Der Rückspiegel war ein Hochhinaus-Spiegel geworden, abgedreht in den siebenten Himmel, mit mattem Gesicht – ein Stückchen Plastik und Glas.
Der Vater chauffierte langsamer nun, bremste alsdann, streifte den rechten Handschuh vom Arm und reichte der Tochter die Hand: „Und keine Dummheiten, hörst du!“ Und er ließ sich die Wange küssen von ihr. Mit dem löchernden Handschuh aber klopfte er Sarodnick auf die Schulter: „Seien Sie vor-sichtig!“, mahnte er leicht, vorbeischauend am Haar. Er dehnte das „vor“, als würde er es verschluckt haben in irgendwelcher starken Erregung. –
Drei Wochen später wurde Petras Vater verhaftet. Er hatte in seinem Betrieb einen Lehrling verführt. Nach dem 12. Verhör verstarb er plötzlich. „Herzinfarkt“ war die offizielle Version. Obwohl er in seinem Leben schon ganz andere Verhöre erlebt und überlebt hatte. Das war damals nach Stalingrad, als er in die russische Kriegsgefangenschaft kam und als hoher Wehrmachtsoffizier so manches Märchen zu erzählen hatte. Die einfachen Landser dagegen wühlten inzwischen in der sibirischen Taiga im Morast, fällten ausgehungert bis zum Umfallen riesige Bäume und krepierten dabei wie das Ungeziefer in den löchrigen Decken und die Ratten in den winddurchlässigen schiefen Baracken. Die höheren Grade indes, hochgradig schuldig und mit viel Dreck an den Knochen, schliefen tatenlos ihren vierjährigen Totentanz auf weicheren Eisenmatratzen und aßen Doppelportionen vom Schwarzbrot, vom Magermilchbrei mit gelegentlich Fleischklößen dazu. Die dienten danach zum Aufwärmen, zum Reinbeißen, Reiben, Lecken und Striegeln der Offiziere, um kraftspendend an die Reserven, ans frische Fleisch der ehemaligen Kriegskameraden gehen, besser liegen zu können – bis zum Absprung und verbotenen Abspritzmanschetten. Die Rangordnung – die strammsten und wuchtigsten Mit-Glieder – bestimmte das Untergestelle dabei.
Petra hat darüber geschwiegen, auch vom Erfurter Gefängnis wollte sie nicht reden, von dem bezaubernden Lehrling mit dem Besenstil von seinem Meister im Griff seiner Faust. Das war alles ein Schandfleck für sie, ein Stoß in die falsche Richtung, ein Schiss in die Hose oder einfach nur ein Fauxpas, der letztlich nach hinten losging.
15
„Mein Katerchen, du musst deine Träume verlegen“‚ hält Ljuba die Hand ihres Freundes unter der Decke. „Hast du gut geschlafen? – Guten Morgen, Semjon? Guten Morgen, Wasili! Guten Morgen, Martin!“
„Hm.“
„Petra ist wirklich sympathisch.“
„Allen ist sie sympathisch“, antwortet Martin.
„Mit größtem Vergnügen würde ich sie von hinten vernageln.“ „Semjon!“, mahnt Ljuba vergeblich.
„Was ist? Sind kleine Kinder im Raum?“, fragt Sjoma und dreht sich verwundert um. „Ach so! Wowa. Ich habe vergessen.“
Ljuba streicht Wolodja die Haare aus seiner Stirn: „Zieh dich jetzt an, Wowotschka, mein Sternchen, mein Katerchen, ich warte auf dich in der Diele“, zirpt sie und geht aus dem Zimmer.
„Ich hatte mal eine Mieze, die hat beim Vögeln immer wie eine Biene gesummt“, rollt Samwels Satz gegen die eingezogene Tür.
Sehr musikalisch ist Ljuba. Sie hat Musikpädagogik studiert und danach in der Schule Gesang unterrichtet. Sie kennt alle Volks- und Kinderlieder im Kopf – hat nur diese Lieder dort oben. Ihr Mann ist zu Hause geblieben. Rotborstig, mit einer grobhornigen Sechser-Brille auf der russischen Nase, ist er einmal bescheiden nach Moskau besuchsweise gekommen. Wer hätte ihn da schon bemerkt, wenn Ljuba nicht jedem Einzelnen ausdrücklich gesagt hätte: „Mein Mann!“ Er hatte höflich gegrüßt, nach rechts und nach oben – das Filminstitut ist für die Leute in Woronesch eine ganz hohe und ernstzunehmende Sache. Beim Abschied dann hatte er bewegt Ljubas Hand gefasst und ihren kurzen Mund durch seine dick gläserne Brille gesucht.
„Das war mein Gatte. Und nach meinem ersten Film wollen wir Kinder haben. Bestimmt fünf“, sagte sie ausgesprochen melodisch. Ljuba greift immer in Dur: ausgeglichen, allfreundlich, mit den Pädagogen lehrerbezogen. „Mein Pfötchen, es ist jetzt an der Zeit!“ – Wladimir belässt unter der Bettdecke die Hand in der ihren – mehr lässt er ihr nie. „Es ist angenehm, unter einer Frau zu erwachen“, stöhnt er vor Glück. Ljuba indessen sendet „Die Grundlagen der Filmregie“ an ihren Mann: „Viele Grüße von Semjon, Martin und Wladimir.“
In dem Buch steht eine persönliche Widmung von Lew Kuleschow, und sie legt eine Pelzmütze mit hinein ins Paket, die ihr Venka aus Bulgarien mitgebracht hat: „Für dich, liebes Hündchen. – In Bulgarien ist es viel wärmer als in Woronesch. Dafür aber gibt es in Sofia Mützen aus echtem Fell.“
Venka bekommt den Mund nicht ganz zu voller Zähne, und ihre obere Lippe versucht verzweifelt, verspannt dieses Weißgelb zu decken. „Wie ein Hauch. Eine zweite Sarah Bernhardt“, soll der Professor über sie einmal gesagt haben – hat jedenfalls Tretin behauptet. Schließlich hatte er die Bernhardt persönlich gekannt. Und mündig ironisch spitzen die Dilettanten im Kurs ihren Mund: „Venka, das Stummfilmidol.“
„Sie darf beim Rezitieren bloß nicht den Rachen aufsperren“, meint Sjoma. „Dann kann sie sein, wer sie will.“ – Nach der ihr zugeflüsterten Eloge des Meisters gibt sich Venka sehr schön und lässt sich nicht zwei Mal nur bitten. „Sarah-Venka!“, ruft man ihr nach, und ihr Kiefer fällt vor Stolz beinah auf die Treppe. Unten steht Martin und krabbt ihn fast in den Keller: „Der rollt!“ – Hat er nicht mit ihr schon sieben Worte gewechselt? „Ich war noch nie in Bulgarien gewesen.“ – Sie hätte nicht laut lachen gesollt! So ist alles verdorben – die Treppe hinunter. Hinterher wird gesagt, Martin hat sie gestoßen. „Wenn ich doch unten gestanden habe in diesem Moment! Oben stand doch zu diesem Zeitpunkt gerade Kim-Lan.“
Wer weiß genau, wie alt sie ist, wie viel Jahre sie hinter sich hatte? Dreißig? Fünfunddreißig? Noch älter? Altlos, weit an der russischen Sprache vorbei, ist Kim-Lan ein Geheimnis, ein Kriegsgeschenk aus Hanoi. In Dutzenden Filmen hat sie bereits bei sich zu Hause gespielt und wurde ein Ur-Stern über dem Wald, eine vietnamesische Diva. Jetzt wird die Schauspielerin zur Regisseurin geformt, denn der Krieg in Vietnam hat Akteure genug. Unter den Bomben sind die Studios zu Pulver, und das Geld für das Kino wird in die Gewehre gesteckt. Wer aber filmt die Taten der Toten? – Kim-Lan wird einmal Spielfilme drehen. Ihr Mann jedoch bleibt als Flieger am Himmel, den Amerikanern zum Fraß: Wer hat die besten Kanonen? Stets, wenn ein Flugzeug über den Moskauer Himmel pfeift, senkt Kim-Lan ihre unendlichen Haare – sie denkt an ihn, an den Krieg: „Die Ausländer können uns mal!“ – eine leise Unruhe ist dann auf ihrer leicht faltigen Stirne zu lesen, und sie kann darin sogar ein wenig erstarren.
Zwei Jahre ist sie nicht zu Hause gewesen – „Ob es noch geht?“ – und sie hanoit lautlos über die Flure. „Kim-Lan!“ – Wie aus Scham biegt sie den Hals. Sehr schön war sie sicher einmal gewesen – und ist es immer noch heute. Das wenige, welches sie spricht, was sie überträgt aus den sechsgestrichenen Ton-Leitern ihrer eigenen Sprache, will sie nicht sprechen, singt sie, möchte nicht singen, bleibt hängen in ihrem Hals. Eine dunkle Ader läuft dort ihr
darüber, und kleinschrittig huscht Kim-Lan hinaus aus dem Saal: Sie kann keine Kriegsfilme mehr sehen und ist zur Toilette geeilt. Dorthin verfolgen sie die infernalen Sirenen im Sinn. „Du bist traurig, Kim-Lan?“
„No.“ – Sie ergreift die Finger von Martin, beißt sich in sie, so dass er aufschreit, und seine Stimme fast die Höhe der ihren erklimmt. „Glücklich du bist, Martine?“, haucht sie, gibt sie nicht los und schiebt ihre Hand in den Ärmel.
„Ich … weißt du … Wie gefiel dir der Film?“, fragt er unpassend ungeschickt nicht am Platze und fühlt sich in den oberen Wolken, verblüfft.
Ihre Ader schlafft ab, entleert sich, und sie schaut ihn gleichgültig-achtlos nur von der Seite.
„Du bist nicht richtig hier – Damentoilette“, sagt sie in ihrem singenden Ton. – Eine Wunde bleibt Martin zurück, und er saugt sich fest an der Stimme:
„Entschuldige bitte!“ – Sie aber ist plötzlich wieder Kim-Lan, bloß wieder ein Rätsel.
„Ta-Scha, Ta-Scha“, verballhornt Dascha den Jungen, spült das Wasser im Klo und ordnet ihr Kleid.
„Dumme Gans!“, tut Martin verdrießt.
„Tumme Tascha“, macht sie sich her über seine Konsonanten, die weich sind wie schimmliges Obst. „Teine Sprache ist pfaul. Im Teutschen pist tu ein Schwuler mit so einem ‚Tu‘. – Alle Teutschen sint schwul. Tu aper pesonters!“
„Du spinnst! Als würde ich nicht Dascha sagen zu dir, wie die anderen auch.“ – Er reißt ihr wütend die Schleife vom Zopf: „Wenn du noch einmal …!“ – Sie prustet:
„Noch einmal!“, und ergänzt wonnig: „Rasum“ – russisch „Verstand“ – und rollt das „R“ wie eine Säge im Holz, so dass Sarodnick vor Neid sich die Zunge fast schneidend abbeißt. „Du Kind!“ – Sie ist blutneu, blutjung, blutunerfahren.
„Dtdtdascha!“, wiederholt sie ironisch. Ihr Vater hatte ihr die Filmhochschule vorgeschlagen, sie hat eingeschlagen ohne ein Wort: Er ist ein bekannter sowjetischer Filmregisseur. Alles bleibt in der Familie.
„Als wäre es so wichtig, welches ‚D‘ man sich wählt!“ – Wie ein Kreisel tanzt sie um ihn:
„Gehen wir Eis essen ins Café ‚Zu den zwei Rosen‘? – Schnell! Keine Furcht! Ich bezahle.“
„Du kleines Kind.“
„Mit dir bleibt man es natürlich bis in das Grab“, sagt sie und küsst ihn auf den Mund. „Tatjana wartet auf uns.“ – Tatjana studiert im Parallelkurs, und ihr Vater ist der stellvertretende Rektor vom Institut. „Ein Teutscher, ta!“, ruft ihr Dascha von weitem schon zu, „mit tunklen Augen und tunklem Haar – ganz wie der Führer.“ Ein Kind.
Helläugig, rotwangig ist sie, noch grün hinter den Ohren, mit einer kleinen knorpligen Nase; und die vollen Brüste sind auffällig rundbäckig prall schon für ihre kaum sechzehn ein halb. „Die wird mal ein ganz schönes Kaliber!“ – Aber noch – Gott sei gelobt! – ist sie ja ein frischer Kuchen zum Schleckern und Naschen, und Martin folgt ihrem Hintern wie blinde Kuh: „Dascha! Das Eis!“
„Tasch-Eis“, schlenkert sie ihm die Brüste entgegen, und Martin stolpert vor Wut: „Blöde Pute! Geht doch allein. – Was ist schon daran!“ –
Vier Mädchen studieren mit Martin – vier von zwanzig im Kurs. „Man sollte sich vielleicht was Besseres besorgen!“, reflektiert sinnig Sarodnick. „Vier verschiedene – und wer ist die Beste davon? – Bestimmt nicht, bestimmt. Man müsste probieren.“ – Venka ist von der Treppe geschlittert, und wie Sarah Bernhardt steht Kim-Lan stummtaub – ein Dschungel – daneben, als Ljuba am Flügel die Lieder begleitet. Dascha aber ist in den Zirkus gegangen. Sie braucht eine Hand. Die vier Mädchen reichen sich beide.
„Was ist los nur mit Martin?“ – „Alleine nur träumt er davon. Mit den Mädchen ist dies etwas ganz andres.“ – Klein bei geht er zurück in die Probe. Der Professor müsste heute persönlich erscheinen – eine Erscheinung trügt Schein. Die Schüler hoffen mit den Assistenten und die mit der Frau Kuleschows.
„Erst einmal Pause!“
„Mein Mann wird bald wieder gesund.“ – Der neunte Monat ist schon im Gange. Ljuba liest persönlich den Text von dem Mann vor:
„Die Arbeiten meiner Gruppe …“ – Eine fernere Gruppe ist sie, und im Bett urteiltest sich leicht.
„Wir werden ihn morgen besuchen!“
16
„Ich hab es geahnt“, sagt Kletters wagehalsig und flüstert dem Botschaftsrat etwas ins abgestandene Ohr. „Wie viel Male waren Sie schon zu Hause“, rät nun der Mann im Halbdunkel rum.
„Zweimal“, untertreibt Sarodnick seine Antwort. „Das erste Mal und das zweite.“
„Wir haben aber andere Informationen bekommen“, hat die Botschaft gehört.
„Es muss ein Missverständnis vorliegen“, legt Sarodnick nach. „Die andere Zeit war ich krank.“
„Krank?“
„Ja. Eine Verstauchung.“
„Genosse Kletters, was meinst du dazu?“
„Ich? Ja, der Sarodnick … Wir sind gute Freunde“, redet Kletters um Martin herum. „Das Weitere steht im Bericht.“
„Geben Sie mir Ihren Pass!“, verlangt der Botschaftsrat von dem Heimfahrer.
„Den habe ich verloren“‚ rutscht es Sarodnick wie aus der Tasche.
„Was?“ Schreiend erhebt der Mann sich in seiner Stellung. „Verrückt geworden! Da sind doch die ganzen Stempel gewesen.“ – Jeder Stempel ein Flug. „Los, geben Sie uns einmal Ihr Märchen zum Besten!“
Und Sarodnick zählt auf seine letzten Stunden im Leben: „Um 16 Uhr befahl mir Kletters, dass ich sofort mit dem Pass in der Botschaft erscheinen solle. Um 17 Uhr war ich schon auf dem Weg. Um 18 Uhr hab’ ich plötzlich Hunger bekommen, aß eine Kleinigkeit schnell, und um 19 Uhr bezahlte ich an der Kasse fürs Essen. Um 20 Uhr war ich dann bei Ihnen hier.“
„Eine miese Geschichte“, verdrießt der hohe Genosse sich rastlos und glotzt auf das Porträt von dem Ulbricht. „Weiter! Wo ist nun der Pass?“
„Irgendwo zwischen 16 und 20 Uhr.“
„Das können Sie in der Kneipe erzählen!“, schenkt der Mann redekarg aus, und Sarodnick gibt ihm voll Recht:
„Daran habe ich auch gleich gedacht, aber die Kassiererin hat nichts gesehen.“
„Die lügen doch alle hier wie die Reiher!“, vergisst der Mann sich im Land. „Eine Hand klaut die andere.“ Und er haut auf den Tisch. „Wir prüfen die Sache!“ Und zu Kletters gewandt: „Du hättest ihn niemals aus den Augen sollen lassen, Genosse!“
„Ich habe es nicht.“
„Und von 16 bis 20 Uhr? Was war da?“ – Kletters nickt, er hat seine Lücken begriffen.
17
Ein Sommer wie jeder andere. Ein Meer wie jedes. Ein Mädchen wie andere auch. Auf der Rückfahrt vom Sommer, vom Meer und von Petra macht Sarodnick eine Rast. Sie ist kurz und bescheiden, denn der Sommer wollte nicht enden, wie das Meer endet am Strand. Das Auto bleibt auf der Straße, es hat inzwischen das Motorrad ersetzt, hat die Gefahr ein Stück in die Wege gerückt, und die Rast steht vor dem Hause nun auf vier Beinen.
„Grüß dich!“
„Grüß dich!“
„Setz dich, mein Schatz!“
„Oh. Danke.“
„Erzähle von dir.“
„Das ist Petra.“
„Ich kenne sie schon von dem Bahnhof.“
„Petra ist eine Freundin von mir.“ – Monika zerrt an dem Mund: „Weiter, mein Schatz.“
„Wir sind von der Ostsee.“
„Das sehe ich wohl.“
„Wir fahren wieder nach Hause.“
Die Mutter stellt Kuchen: „Meine Tochter hat so viel von Ihnen berichtet.“
„Mutti!“
„Sie studieren also in Moskau?“
„Bitte!“
„Monika hat ja nun ihr Diplom absolviert.“
„Mutti, geh in die Küche!“ –
„Was wirst du jetzt tun?“, fragt Martin und sieht der Mutter hinterher zu der Tür.
„Ich möchte …“, Monika ziert sich zickig im Stuhl, „fotografieren.“
„Ist dies denn möglich?“, fragt Petra aus der hinteren Reihe, doch Monika hat die Frage gar nicht gesehen.
„Ich mache ein Buch.“
„Und worüber?“, staunt Martin.
„Nicht hier!“, flüstert Monika leicht und guckt wie durch die Wand in die Küche und durch Petra hindurch wieder zur Wand. „Wir reden unter vier Augen darüber. – Du hilfst mir dabei?“
„Klar!“, couragiert sie Martin lautstark.
„Ich komme noch öfters nach Moskau.“
„Schön.“ Martin verschluckt sich im Magen und dreht sich geniert zu Petra herum.
„Ich werde da schon aufpassen auf dich“, schäkert Monika, himmelblau in den Augen.
„Wieso aufpassen?“, stellt sich Sarodnick dumm.
„Na, na!“, zieht sie sich hoch. „Keine anderen Mädchen, mein Schatz!“ Und sie schmettert diesen Satz Petra ins Gesicht wie eine Fanfare.
Die Rast geht zu Ende. Jeder Abschied tut weh. Petra sitzt in dem Auto, und Sarodnick schnappt noch ein Foto vom Kuss, den er Monika gibt.
„Ciao! Auf Bälde.“
„Grüß Moskau von mir!“
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.