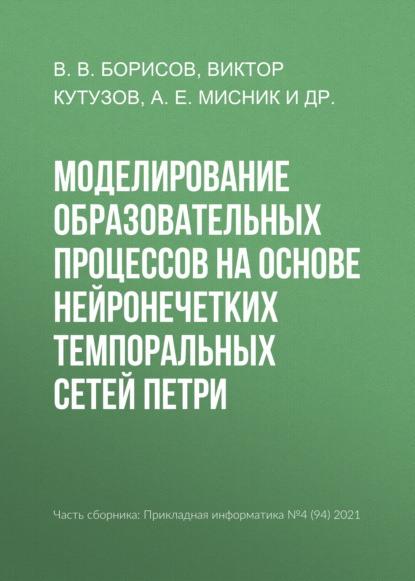- -
- 100%
- +
Osteraugen lassen sich aber auch leichter zudrücken. Sie sehen die eigenen Fehler und können deshalb über die Schwächen der Anderen gelassen hinwegsehen. Osteraugen sehen weiter. Sie bleiben nicht auf das Schwierige und Unsympathische fixiert, das uns an unseren Mitmenschen immer zuerst auffällt; sie bleiben nicht an Krankheit, Leid, Tod haften, sondern schauen hinter die Fassade des vordergründig Abstoßenden und entdecken den Anderen, so wie Gott ihn sich gedacht hat. Sie sehen einen Weg, wo vorher keiner war, und sie sehen im Ende schon wieder einen neuen Anfang. „Erlöster müssten die Christen aussehen, damit man an ihren Welterlöser glauben kann.“ Vielleicht hätte Friedrich Nietzsche diesen Vorwurf nicht formuliert, wenn er mehr Christen mit Osteraugen begegnet wäre.
Vielleicht könnten wir als Kirche gelassener sein, wenn immer mehr Christen – Geweihte und Laien – den Auferstandenen wirklich „im Blick“ hätten. Denn diese Perspektive wäre die heute so notwendige Neuevangelisierung! Die Mitte unseres Glaubens und unserer Kirche ist und bleibt dieser Auferstandene und unsere lebendige Beziehung zu ihm durch Gebet, Gottesdienst und tätige Nächstenliebe.
B wie BEICHTE
Oder: Was macht ein ausgedienter Kühlschrank im Wald?
Die Beichte ist in einer Gesellschaft der Selbstoptimierer sicher das unpopulärste aller Sakramente, aber angesichts des von Papst Franziskus für 2016 ausgerufenen „Jahres der Barmherzigkeit“ von großer Aktualität. Bischof Zsifkovics wird nicht müde, das „Sakrament der Versöhnung“ aus der Vergessenheit zu holen und es als befreienden Bestandteil menschlichen Lebensstils ins Bewusstsein zu rufen. Dass der Bischof den Beichtstuhl einmal als „Duschkabine für die Seele“ bezeichnet hat, zeigt sein praktisch-elementares Verständnis von Beichte, die er in einer Reihe mit gesellschaftlichen Praktiken wie Umweltschutz und Recycling sieht:
Jesus lädt uns Menschen zum Glauben an das Evangelium ein, sagt aber gleichzeitig: „Kehrt um!“ Glaube und persönliche Umkehr sind also aufeinander bezogene Forderungen Gottes an den Menschen. Die Beichte als das Sakrament der Versöhnung ist ein großartiges Geschenk des Auferstandenen an uns. Dennoch erweckt allein das Wort „Beichte“ in vielen Menschen unangenehme Gefühle. Sie reichen von totaler Ablehnung bis hin zu völliger Gleichgültigkeit. Von den einen abgelehnt, weil sie den Beichtstuhl vielleicht als Ort der Demütigung oder der Indiskretion erlebt haben, und von den anderen ahnungslos belächelt, weil sie nie erfahren durften, was für ein Geschenk die Beichte für den Menschen eigentlich ist. So ist dieses Sakrament zunehmend nicht nur zum ungeliebten und vergessenen, sondern auch zum unbekannten Sakrament geworden. Doch gerade darin liegt für unsere heutige, an Geist und Geistlichkeit so arme Zeit die große Chance, die befreiende und belebende Wirkung der Beichte neu zu entdecken.
Als Beichtvater wie als Sünder, der selbst zur Beichte geht und genau weiß, wie schwer dieser Schritt sein kann, bin ich überzeugt: der Beichtstuhl ist der Ort, an dem nicht nur der Einzelne, sondern die ganze Welt ihre größte Reparatur erfahren kann. Wie viele politische und soziale Programme, Expertentreffen, Arbeitsgruppen und Gesetzesbeschlüsse könnte eine gute Beichtpraxis überflüssig machen? Denn die Beichte verändert die Welt im Kern: beim Einzelnen selbst. Umkehr, Reue und die versöhnende, verzeihende Liebe, die Gott selbst dem Beichtenden schenkt, machen die Beichte zum Sakrament der Heilung. Hier erfährt der Mensch die Wiederherstellung zerbrochener Beziehungen: zu sich selbst, zu seinen Mitmenschen und dadurch letztlich zu Gott, der den innersten Kern unseres Menschseins darstellt. Ein Mensch, der sagt, dass er ohne Sünde sei, die Beichte nicht brauche und alles mit und für sich selbst regeln könne, belügt sich selbst – das sagte schon der Apostel Johannes.
Dieser Selbstbetrug kommt in der heutigen Zeit dennoch häufig vor. Wir alle trennen und entsorgen zwar unseren Haushaltsmüll und kennen die Bedeutung von Recycling für uns und unsere Umwelt, weil wir wissen, dass wir Menschen in einer sensiblen Beziehung zur Natur stehen, die unaufbereiteten Abfall auf uns selbst zurückfallen lässt. Die meisten von uns hätten zurecht ein schlechtes Gewissen, einen alten Kühlschrank im Wald zu entsorgen oder Frittierfett in den Ausguss zu schütten. Doch wie sieht es mit der seelischen Müllentsorgung aus?
Der Akt seelischer Versöhnung mit sich selbst wird offensichtlich weit zurückhaltender praktiziert als jener der Versöhnung mit der Umwelt. Wäre es anders, bräuchten wir mehr Beichtstühle in unseren Kirchen. Dabei ist Gott der Meister des wahren „Recyclings“: Er, der sich in den Kreislauf des Lebens hineinbegeben hat, indem er selbst Mensch wurde und in Leiden, Tod und Auferstehung alle Tiefen und Höhen des menschlichen Lebens durchgemacht hat; er, der in der Eucharistie Teil von uns selbst wird, kann sogar unsere schwersten Sünden in Gutes verwandeln. Aus dem Misthaufen unserer Fehler können Rosen wachsen, wenn wir unsere Schwächen erkennen und sie bewusst in Gottes gütige Hände legen.
Papst Franziskus sagt es ganz klar: „Es gibt keine Situation, die Gott nicht ändern kann, es gibt keine Sünde, die er nicht vergeben kann, wenn wir uns ihm öffnen.“ Gott will nicht, dass unsere Seele zu einer Deponie für Sondermüll verkommt. Er will nicht, dass unsere fehlerhaften Haltungen wie ranziges Öl unseren Zugang zur Welt und zu ihm verkleben und uns an unserer freien Entfaltung behindern! Gott ist unser Freund, er will unser Bestes, unser Heil und unsere Heilung.
Das führt zur entscheidenden Frage: Wie kann ich so beichten, dass es mir echte innere Heilung ermöglicht? Der bekannte Mailänder Kardinal Carlo Maria Martini hat drei Schritte aufgezeigt, wie das Sakrament der Versöhnung als echtes Geschenk erfahren werden kann, das dem Menschen Frieden, Befreiung und Lebensfreude bringt. Diese drei Schritte helfen auch mir persönlich bei der Beichte jedes Mal sehr und ich praktiziere sie als drei einfache Bekenntnisse. Diese Bekenntnisse sind Teil der Weisheit, die die Kirche über Jahrhunderte hinweg angesammelt hat und dem Menschen heute als Arznei für die Seele anbietet:
Erstens: Das Bekenntnis des Lobes (confessio laudis). Ich beginne die Beichte mit Positivem, nämlich mit einem Bekenntnis der Dinge, für die ich Gott loben und danken möchte. Ich nenne das viele Gute beim Namen, das Gott in meinem Leben gewirkt hat: Ereignisse, die mir viel bedeuten; Menschen, die ich liebe; Situationen, in denen mir geholfen wurde. Es wird wohl niemanden geben, dem nichts einfällt, wofür er dankbar sein müsste. Und indem ich dankbar Rückschau halte, wird mir umso mehr bewusst, dass ich mich des vielen Guten durch mein Verhalten nicht immer würdig gezeigt habe. Diese Einsicht kann einen Menschen tief bewegen und echte Reue bewirken. Denn oft sind, wie Papst Franziskus sagt, „in unserem Leben die Tränen die Brille, durch die wir Jesus sehen“.
Zweitens: Diese Reue führt mich zum Bekenntnis des Lebens (confessio vitae) – zum ehrlichen Bekenntnis der Dinge in meinem Leben, von denen ich vor Gott wünschte, dass sie besser nicht da wären. Das ist der Moment, die „alten Kühlschränke“ und anderen Sondermüll, den wir versteckt halten, offen anzuschauen. Es kommt hier nicht darauf an, nur seine Fehlhandlungen zu berichten bzw. sie anhand der Zehn Gebote abzuarbeiten. Ein solcher Automatismus führt meist nicht zu einer tiefgreifenden Veränderung in uns. Das Sakrament ist kein Zauberding, das uns von außen verwandelt wie der Zauberstab des Harry Potter. Graben wir daher tief hinein in unser Inneres und blicken wir – wenn es sein muss durch die Brille unserer Tränen! – auf die wunden Punkte, die Tiefenströmungen und negativen Haltungen, die uns immer wieder der Sünde ausliefern und die nicht gut sind für uns und unser Leben.
Zum Schluss der Beichte sollen wir ein drittes und letztes Bekenntnis, das Bekenntnis unseres christlichen Glaubens (professio fidei) sprechen. Wir bringen darin unseren Glauben zum Ausdruck, dass Gott die Macht und die Barmherzigkeit besitzt, all unsere Sünden zu vergeben und uns von Neid- und Rachegefühlen, von Verbitterung, Eifersucht, Machtstreben, Geltungssucht und anderen Ersatzgöttern zu befreien. Ihn bitten wir um Lossprechung. Danach sind wir mit Gott versöhnt und können im alltäglichen Leben auch Zeugen für die Aussöhnung mit unserem Nächsten sein.
Gönnen wir uns ab und zu die Zeit, um das eigene Leben etwas intensiver zu reflektieren, es in seinen dunklen Bereichen aufzuhellen, um ein Stück mehr mit sich selbst, mit den Mitmenschen und mit Gott ins Reine zu kommen! Jeder von uns weiß ziemlich genau, wo die unterbelichteten Stellen in der eigenen Biografie zu finden sind. Jenen, die regelmäßig beichten, wünsche ich dabei, dass das Sakrament nicht zur oberflächlichen Routine wird, sondern dass es immer wieder den Weg ins Innere finden kann. Und jenen, die schon längere Zeit nicht mehr beichten waren oder überhaupt noch nie einen Beichtstuhl von innen gesehen haben, möchte ich Mut machen: Nehmen Sie sich selbst so wichtig, wie Gott es tut! Verweigern Sie sich nicht dem wunderbaren Heilmittel der Versöhnung, das er für Sie bereithält! „Legt den alten Menschen ab und lebt als neue Menschen“, formulierte es der Apostel Paulus.
Dabei kommt den Priestern eine kaum zu überschätzende Rolle zu. Sie sind nicht nur gefordert, selbst zur Beichte zu gehen, sondern den Gläubigen eine gute Beichte zu ermöglichen und sie auf eine gute Beichte vorzubereiten – etwa durch geeignete Bußfeiern oder Abende der Barmherzigkeit. Solche Formen der Vorbereitung sind wichtig, sie ersetzen aber nicht die persönliche Beichte und dürfen auch nicht gegen die Beichte ausgespielt werden! Denn anders als in der pharmazeutischen Industrie ist das Sakrament der Buße und der Versöhnung ein Heilmittel, für das es keine billige Ersatzmedizin, kein Generikum und kein Placebo gibt.
B wie BILDUNG
Oder: „Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Und wo, verdammt, sind meine Schlüssel?“ (Billy Cristal)
Was ist Bildung? Dieser Frage ist Bischof Zsifkovics in einem offenen Gespräch mit Studierenden der Pädagogischen Hochschule Burgenland nachgegangen. In einer Zeit, in der Bildung vielfach mit Ausbildung gleichgesetzt wird, jungen Menschen vorgefertigte Antworten aufgepfropft und sie für das herrschende Wirtschaftssystem „gestreamt“ werden, während ihre Individualität und ihre Talente allzu oft nivelliert werden, plädiert er für eine Bildung hin zur Freiheit. Das Ziel: Zurechtzukommen mit den großen und kleinen Fragen des Lebens.
Die verschiedensten Bildungsinstitutionen verwenden gerne ein Wort, um das keiner von uns herumkommt: „Zukunft“ – und bieten „Zukunftsforen“, „Zukunftswerkstätten“ an, wollen „fit für die Zukunft“ machen und ähnliches. Dies nicht ganz zu Unrecht, denn das bedeutungsschwere Wort „Zukunft“ ist untrennbar gekoppelt an ein zweites Wort: „Bildung“. Ein gebildeter Mensch hat immer eine Zukunft – das ist meine tiefe Überzeugung. Aber wird die Zukunft unseres Landes, unseres Kontinents, unseres Kulturkreises auch über genügend gebildete Menschen verfügen? Ich habe hier manchmal meine Zweifel.
Was ist Bildung überhaupt? Das Wort ist ein sprachlich, kulturell und historisch bedingter Begriff. Seine Bedeutung ist mehr als komplex. Je nach persönlicher Ausrichtung, je nach individuellem Standpunkt und Interessenlage variieren die Ansichten darüber, was unter „Bildung“ verstanden werden sollte, erheblich. Dazu kommt, dass jede Aussage über den Begriff „Bildung“ unweigerlich vom Bildungsgrad dessen abhängt, der darüber spricht. Frei nach dem großen Monsignore Otto Mauer: „Kunst ist das, was gebildete Menschen dafür halten!“ So könnte man auch für die Bildung sagen: „Bildung ist das, was gebildete Leute dafür halten!“
Als Theologe und Kirchenmann möchte ich keinem vorenthalten, dass der schöne Begriff „Bildung“ von dem mittelalterlichen Denker und Mystiker Meister Eckhart in die deutsche Sprache eingeführt wurde. Bildung bedeutete für ihn das „Erlernen von Gelassenheit“; es war für ihn etwas, das den ganzen Menschen betrifft, und es wurde von ihm als „Gottessache“ angesehen, „damit der Mensch Gott ähnlich werde“ – so schrieb er wörtlich. Das nenne ich eine anspruchsvolle Bildungspolitik und einen anspruchsvollen Begriff von Bildung – nämlich ein Arbeiten an sich selbst, „damit der Mensch“, damit unsere Kinder, unsere Jugendlichen und wir selbst „Gott ähnlich“ werden.
Doch kommen wir zunächst wieder auf die Normalebene. Bildung ist ein Menschenrecht und die Grundlage für ein geglücktes Leben. Sie hilft uns Menschen, uns in einer sich ständig verändernden Welt zurechtzufinden und unseren Platz in der Gesellschaft zu finden. Aus der Perspektive eines christlichen Welt- und Menschenbildes geht es im Bereich Bildung und Schule um die Weitergabe von wesentlichem Wissen für eine erfüllte Lebensgestaltung und um die Entfaltung des ganzen Menschen. Die katholische Kirche investiert daher schon von ihrem Welt- und Menschenbild her in ganzheitliche Bildung der Menschen aller Altersstufen – und im Speziellen in die religiöse Bildung im Rahmen des Religionsunterrichts.
Die vielfältigen kirchlichen Formen dieses ganzheitlichen Bildungsinputs in die Gesellschaft allein in Österreich sind beachtlich: Etwa 70.000 Schülerinnen und Schüler besuchen in unserem Land eine konfessionelle Schule, 770.000 besuchen den katholischen Religionsunterricht und rund 900.000 Erwachsene nehmen jährlich die Angebote der Katholischen Erwachsenenbildung wahr. Rund 70 Prozent der konfessionellen Privatschulen sind Ordensschulen, die von knapp 50.000 Schülerinnen und Schülern besucht werden. Dazu kommen vier pädagogische Hochschulen der Kirche in Österreich, an denen insgesamt etwa 2100 Studierende ihre Erstausbildung absolvieren; weiters trägt die Kirche Mitverantwortung für die vier katholisch-theologischen Fakultäten in Wien, Graz, Innsbruck und Salzburg sowie für private theologische Universitäten und Hochschulen, an denen etwas mehr als 3000 Studierende inskribiert sind. Eine theologische „Breitenbildung“ wollen darüber hinaus österreichweit tätige Einrichtungen wie die „Theologischen Kurse“ vermitteln. In Kooperation mit dem „Forum katholischer Erwachsenenbildung“ und dem Unterrichtsministerium haben die „Theologischen Kurse“ etwa das äußerst erfolgreiche Programm „Basisinfo Christentum“ ins Leben gerufen, das für Christen, aber auch für Andersglaubende einen idealen Einstiegspunkt in die christliche Glaubenswelt bietet.
Man könnte nun vielleicht sagen, da würden überall spezifisch kirchliche Inhalte vermittelt, da werde sozusagen das eigene religiöse Propaganda-Programm gesendet. Doch das ist ein Irrtum. Zum Konzept allgemeiner Bildung gehört das Nachdenken über die Ziele und Zwecke individuellen und gesellschaftlichen Handelns, das Nachdenken über den Sinn des eigenen Lebens und über die Einheit der Wirklichkeit. Schon Kinder und Jugendliche stellen die großen Fragen der Menschheit wie „Was ist der Mensch?“, „Was ist Sinn und Ziel unseres Lebens?“, „Was ist gut und was ist böse?“, „Woher kommt das Leid?“, „Was ist der Weg zum wahren Glück?“, „Was kommt nach dem Tod?“ oder „Existiert Gott?“. In unserer pluralistischen Gesellschaft treffen unsere Kinder und Jugendlichen auf unterschiedlichste Antworten, auf religiöse und auf säkulare. Diese letzten Fragen, die zum Menschsein gehören, und die religiöse Pluralität der Antworten bilden eine pädagogische Herausforderung, der sich die Schule im Ganzen und auch die Kirche stellen müssen. Die Bedeutung religiöser Bildung wird ja gerade deshalb auch in der andauernden Debatte zur Schulreform allgemein und ohne ernstzunehmenden Widerspruch anerkannt. Denn die Religion eröffnet einen Zugang zur Wirklichkeit, der durch keinen anderen Modus der Welterfahrung ersetzt werden kann.
Für einen stabilen Menschen braucht es religiöse Bildung und der Ort religiöser Bildung an der Schule ist primär der Religionsunterricht. Die Antworten auf die letzten Fragen des Menschen kann und soll der säkulare und weltanschaulich neutrale Staat nicht selbst geben. Deshalb kooperiert er mit den Kirchen und Religionsgemeinschaften, die für die Ziele und Inhalte des Religionsunterrichts verantwortlich sind. Und er beschränkt sich darauf, für den Religionsunterricht wie für jedes andere ordentliche Lehrfach die erforderlichen rechtlichen und organisatorischen Rahmenbedingungen zu gewährleisten. So soll ein konfessionell-profilierter Religionsunterricht junge Menschen zu verantwortlichem Denken und Verhalten im Hinblick auf Religion und Glaube befähigen und ihnen die Entwicklung einer gesprächsfähigen Identität ermöglichen. Das schließt die Hinführung zu einer konkret erfahrbaren und anschaulichen religiösen Lebenswelt ebenso ein wie die Erziehung zu Kommunikationsfähigkeit über die eigene regionale Kultur hinaus und zu Anerkennung der Andersheit des anderen. Der konfessionelle Religionsunterricht will zur freien Entscheidung und Herausbildung eines eigenen Standpunktes befähigen und leistet damit etwas Essentielles für die ganze Gesellschaft: Er fördert automatisch auch die Anerkennung des Anderen. Denn tolerant kann nur sein, wer einen eigenen Standpunkt hat. Etwas, das von manchen gesellschaftlichen Gruppierungen gerne übersehen oder bewusst verschwiegen wird, wenn sie in meinungsterroristischer Weise „Toleranz“ für alles und jeden, aber in erster Linie für sich selbst einfordern. Die Weitergabe des christlichen Glaubens kann also wirkungsvoll nur im Dialog mit der vorherrschenden Kultur und in Auseinandersetzung mit aktuellen gesellschaftlichen Herausforderungen und Problemen erfolgen. Deshalb ist der Religionsunterricht in der Schule für die Kirche und für die Zukunft des christlichen Glaubens in unserer Gesellschaft von großer Bedeutung.
So wie ich mich aber in meinen Gedanken nicht darauf beschränkt habe, vom Wert des Religionsunterrichts für die Kirche selbst zu sprechen, sondern auf seine brennende Gesellschaftsrelevanz hingewiesen habe, lässt sich auch der jesuanische Auftrag keinesfalls auf pädagogisch Auszubildende und auf die Schule beschränken. Im Prinzip sind wir alle „Auszubildende“ in der Botschaft Jesu und ist unser ganzes Leben ein lebenslanges Lernen in Sachen Nächstenliebe. Wenn ich also von Schule, von Schülerinnen und Schülern und vom Religionsunterricht spreche, meine ich im Letzten uns alle, die wir noch zu lernen haben.
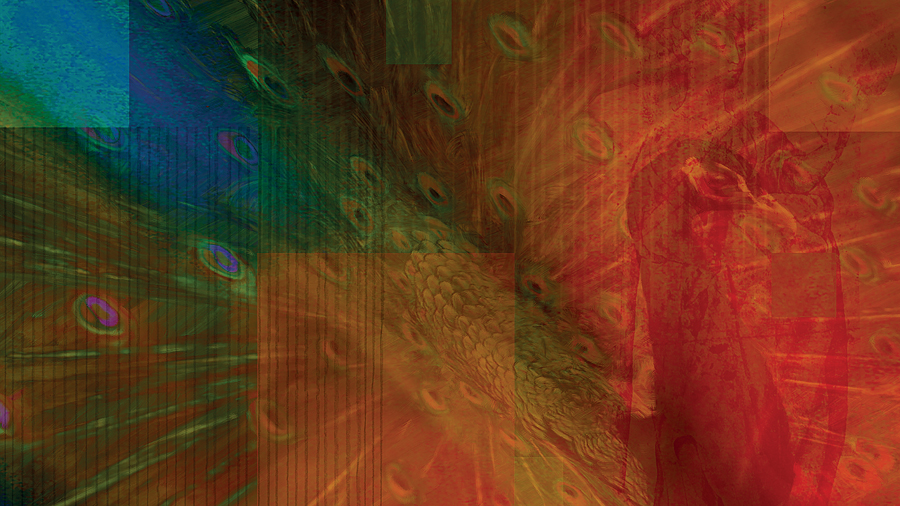
B wie BISCHOF
Oder: „Wonach es einen vorher gelüstet, davor darf es einem danach auch nicht grausen!“ (Gertrude Zsifkovics)
Bischöfe sind im Idealfall wie ein „Leatherman“ oder ein Schweizer Messer: multifunktionale Tools ihrer Kirche, die in einem Rund-umdie-Uhr-Job als Oberhirten, Seelsorger, Prediger, Lehrer, Gesetzgeber und Richter, Ombudsmänner und Mediatoren die ihnen überantworteten Diözesen leiten und damit das Gesicht der Kirche vor Ort darstellen. Am Vorbild des pannonischen Heiligen und Bischofs Martin von Tours erläutert Ägidius Zsifkovics die Rolle des Bischofs zwischen geistlichem Anspruch, kirchlicher Karriere und nüchternem Alltag – mit erstaunlichen Einblicken in die traditionelle Grundausstattung und Garderobe eines Oberhirten.
Der heilige Martin ist eine Gestalt, die viel über das Bischofsamt verrät. Das beginnt bereits bei seiner Bestellung zum Bischof. Der Legende nach haben ihn schnatternde Gänse verraten, als er sich in einem Stall versteckte, um der drohenden Ernennung zum Bischof von Tours zu entgehen. Eingedenk dieser Episode landen die Federtiere alljährlich zum Martinsfest gut gebraten auf den Festtafeln. Die Legende verweist auf zwei christliche Eigenschaften, die gerade einem Bischof nicht schlecht zu Gesicht stehen: Bescheidenheit und Demut. Wer weiß, vielleicht hätten andere in dieser Situation die Gänse getreten oder zumindest an den Schwanzfedern gezogen, damit sie ja ordentlich Lärm machen und das Volk Gottes auch ganz verlässlich zum „Besten aller Kandidaten“ führen. So wenig der kirchliche Leitungsdienst ohne Gestaltungswillen und ohne gesunden Ehrgeiz zu bewerkstelligen ist: Karrierismus ist im kirchlichen Bereich eine besonders problematische Erscheinungsform, die von Papst Franziskus zu Recht stark kritisiert wird. Der heilige Martin steht für eine andere Haltung!
Wie das bei mir war? Wenn ich mich als Kind überessen habe, hat meine Mutter immer gesagt: „Wonach’s dich zuerst gelüstet hat, davor braucht’s dir jetzt auch nicht zu grausen!“ Den Ruf in das Bischofsamt anzunehmen, entsprang ehrlich gesagt keiner „Lust“, aber er ging einher mit einem tief empfundenen Gefühl der Freude und der Dankbarkeit, dem eine schlaflose Nacht mit allen nur erdenklichen gedanklichen Anfechtungen vorausgegangen war. Ich hatte als bischöflicher Sekretär, als Ordinariatskanzler und als Generalsekretär der österreichischen Bischofskonferenz zu lange mit Bischöfen und ihren Amts- und Lebenswegen zu tun gehabt, um nicht zu wissen, dass sich unter der Mitra auch eine unsichtbare Dornenkrone befinden kann. Dass man als Bischof – noch mehr als der Priester – für den Rest seines Lebens einer Gemeinschaft gehört, mit der man in Gott verbunden ist und in der man für jeden Einzelnen sowie für alle zusammen persönliche Verantwortung trägt. Ein nach menschlichen Maßstäben unmöglich zu erfüllendes Unterfangen! Und doch habe ich diesen Dienst, den ich nie angestrebt habe, am Tag der Weihe mit großer innerer Zuversicht angenommen und mein Schicksal in Gottes Hände gelegt. Er hatte mich stets geführt und würde es wohl auch weiterhin tun, so mein Gebet und meine Hoffnung am Tag meiner Bischofsweihe, an dem mir auch meine Mutter ihren Segen gab. Bis jetzt habe ich mich nicht überessen.
Ein Bischof braucht Vorbilder – und das sollten keine Eintagsfliegen sein. Martinus, der pannonische Heilige und Bischof von Tours, der Mann der Aktion und der Kontemplation, ist ein Vorbild, das einen ein Leben lang begleiten kann. Ich mache mich selbst, aber auch meine Mitchristen immer wieder auf die Insignien des Heiligen aufmerksam: den Hirtenstab, den geteilten Mantel in der Hand und die Mitra auf dem Haupt – Attribute, Zeichen, die uns alle an diesen großen Europäer, Mann des Glaubens und der konkreten Tat erinnern. Und noch mehr daran, dass wir als Christen die Verbindung mit Jesus suchen und pflegen sowie das Evangelium im Alltag in die Tat umsetzen.
Der Hirtenstab ist ein Zeichen, dass jeder Bischof durch seine Weihe mit dem apostolischen Ursprung, mit Jesus Christus verbunden ist. Der Hirtenstab ist kein Spazierstock für den Alpintouristen, sondern ein Instrument, das dem Volk Gottes anzeigt, in welche Richtung es in der Nachfolge Jesu zu gehen hat. Der Hirtenstab ist ein Zeichen, die zerstreute Herde zu sammeln und zu verteidigen, Mutlose und Hilflose zu stärken, Suchenden, Irrenden den Weg zu weisen. Martinus mit dem Hirtenstab in der Hand tat dies damals in stürmischen Zeiten der Völkerwanderung, am Übergang von der Antike zum Mittelalter. Er erinnert uns daran, es ihm in den Herausforderungen unserer Tage nachzumachen und uns auf die richtige Richtung unseres Lebens zu besinnen.
Als ich mich nach meiner Ernennung zum Bischof mit den entsprechenden Insignien ausstatten musste, suchte ich in Rom einen traditionellen Anbieter für den geistlichen Berufsstand auf. Keine Sonderanfertigungen, sondern solide Konfektionsware, liturgisches „Pret à porter“. Der Seniorchef des Ausstattungshauses, ein gestandener Römer mit jahrzehntelanger Erfahrung und Menschenkenntnis, die er sich im Umgang mit Priestern und Bischöfen von Wladiwostok bis Tahiti, von Hammerfest bis Kapstadt erworben hatte, stand persönlich im Geschäft und beriet mich. Als wir in die Abteilung für Bischofsstäbe kamen, steuerte er auf ein bestimmtes, etwas massiv wirkendes Modell zu, zog es heraus und stellte es vor mir mit einem dumpfen Geräusch fest auf den Boden. „Eccellenza“, sagte er, „prenda un modello come questo – la curvatura piú grossa fa piú effetto nei casi difficili!“ – „Nehmen Sie ein Modell mit etwas breiterer Krumme – die zeigt bei den schweren Fällen mehr Wirkung!“ Und er schwang, mitten im Laden, den Bischofsstab mit einer Vierteldrehung nach unten, so als ob er jemandem damit eines über den Kopf geben wollte. Ein paar junge Priesterkandidaten hinter dem nächsten Regal, die sich gerade ihre ersten Kollarhemden kauften und die Szene beobachtet hatten, machten große Augen. Nachdem ich aus dem ersten Staunen herausgekommen war, wurde mir klar, dass der Mann eine schlichte Wahrheit – wenn auch etwas brachial – auf den Punkt gebracht hatte: Dass der Bischof jemand ist, der sich wie ein Hirte schützend vor die Herde stellen muss, wenn sie angegriffen wird. Unter allen Umständen. Egal gegen wen. Egal mit welchen Konsequenzen für den Hirten, seine Gesundheit und sein gesellschaftliches Ansehen. Aber der Bischof ist auch jemand, der den gekrümmten Hirtenstab benötigt, um die verlorengegangenen Schafe sanft einzufangen und in die Gemeinschaft zurückzuholen. Wenn das nicht auch die Bedeutung eines Bischofsstabes ist, dann verkommt er zum bloßen Fetisch kirchlich-religiöser Macht – ähnlich den prächtigen Stöcken und Wedeln von Schamanen ausgestorbener Kulte, die man im ethnologischen Museum besichtigen kann.