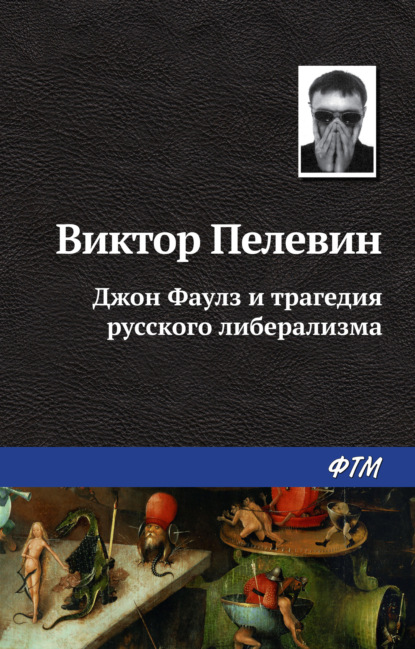- -
- 100%
- +
Zum heiligen Martin gehört aber auch der Mantel, den er mit dem frierenden Bettler teilte. Martinus wurden – im Traum, wie es heißt – die Augen dafür geöffnet, dass er nicht nur mit einem hilflosen Menschen, sondern mit Christus selbst seinen wärmenden Mantel geteilt hat, gemäß dessen Wort: „Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan.“ Der Mantel des Martinus ist daher zum Symbol der Gegenwart Christi in seiner Kirche geworden, nämlich durch den Dienst an den Mühseligen und Beladenen. Christen sind aufgerufen, ja verpflichtet, sich aus dem Glauben heraus liebevoll den Mitmenschen – den Armen, Kleinen und Schwachen – zuzuwenden, sich herabzubeugen, ihnen zu dienen und zu helfen. Denn Christus selbst wird gegenwärtig im Liebesdienst! Der heilige Martin mit dem halbierten Mantel ist ein Tatzeuge des Evangeliums – jede Zeit und jede Gesellschaft muss Platz haben für Arme, Alte und Kranke. Martinus mit dem geteilten Mantel erinnert die Bischöfe und alle Christen daran, das Evangelium in die Tat umzusetzen.
Der heilige Martin trägt darüber hinaus als Bischof die Mitra. Die Bischofsmütze ist nicht nur eine Zierde, sondern ein Signal. Ein Bischof hat gerade in Zeiten der Verfolgung, des Widerspruchs und der Feindschaft gegenüber dem christlichen Glauben nicht den Kopf einzuziehen, ganz im Gegenteil: Er hat seinen Kopf hinzuhalten, um für die Wahrheit Zeugnis zu geben, komme es ihm gelegen oder ungelegen. Das ist heute ein wichtiger, aber auch schwieriger Dienst. Gerade in unserem modernen Europa möchte man Christus ausbürgern, die Kirche in die Sakristei verbannen, den christlichen Glauben privatisieren und die christlichen Werte als nicht zeitgemäß und nicht mehr lebbar erklären. Hat es das alles nicht schon einmal in den Zeiten des Nationalsozialismus und des Kommunismus gegeben? Martinus als Bischof mit der Mitra auf dem Haupt erinnert uns Bischöfe, aber auch jeden anderen Christen daran, Zeugnis für Jesus und seine Kirche zu geben, sich nicht zu ducken, sondern im wahrsten Sinne des Wortes den Kopf für Jesus Christus hinzuhalten.
C wie CASH
Oder: Schon mal mit vollen Händen gebetet, geküsst, gesungen, gestreichelt oder getröstet?
Wenn Ägidius Zsifkovics als langjähriger Pfarrer von Wulkaprodersdorf für die Sanierung des Kirchendaches oder für andere pfarrliche Projekte die Leute um Spenden bat, pflegte er zu sagen: „Keine Angst! Geld für das Projekt ist ausreichend vorhanden. Es befindet sich derzeit allerdings noch in euren Taschen.“ Geburtsheilkunde und Palliativmedizin berichten, dass der Mensch ganz am Anfang und ganz am Ende seines Lebens die Arme in einer gebenden Geste weit ausstreckt – als ob er nichts für sich wolle. Dazwischen hat er eine Existenz zu bewältigen, in der es ohne Besitz und „Cash“ nicht zu gehen scheint. Der Bischof von Eisenstadt erinnert daran, dass der Reichtumsbegriff des Evangeliums nicht am Haben orientiert ist.
In unserer globalisierten Welt kommt es täglich vor, dass Unternehmen expandieren und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in andere Städte und Länder schicken, um dort neue Märkte zu erschließen. Stellen Sie sich vor, Sie würden dort hingeschickt; was würde sich Ihr Chef von Ihnen erwarten? Wohl alles das, was der kaufmännischen Logik von Konzernen entspricht: sicheres Auftreten, Verhandlungsgeschick, Führungsqualitäten, Menschenkenntnis, Durchsetzungsvermögen, exzellente Verkaufsstrategien, ein Netzwerk einflussreicher Leute, erfolgsorientierte Öffentlichkeitsarbeit usw. Auf diese Fähigkeiten wird gesetzt, wenn man Erfolg haben will. Sie entsprechen der Logik und Taktik einer Welt, die auf das Haben, auf Geld und Gewinn ausgerichtet ist.
Doch es gibt und gab zu allen Zeiten Menschen, die auf ein anderes Pferd setzten. Der Philosoph Ludwig Wittgenstein schrieb den einleuchtenden Satz, dass Reichtum eine Frage der inneren Einstellung sei. Und die Cree-Indianer hinterließen uns die Prophezeiung: „Erst wenn der letzte Baum gerodet, der letzte Fluss vergiftet, der letzte Fisch gefangen ist, werdet ihr merken, dass man Geld nicht essen kann.“ Eine alte Weissagung, die auf unserer vom globalen Raubbau so existentiell bedrohten Erde heute zum möglichen Szenario für die Gattung Mensch geworden ist.
Auch das Evangelium zeigt uns eine ganz andere Taktik als die des vollen Geldbeutels – es zeigt uns die Taktik Jesu. Jesus rief die Zwölf zu sich und gab ihnen die Kraft und die Vollmacht, „Dämonen auszutreiben und Kranke gesund zu machen“. Jesus sendet seine Jünger zu zweit voraus in die Dörfer und Städte der Umgebung. Sie sollen die Menschen mit seiner Botschaft in Berührung bringen, das Reich Gottes verkünden und Kranke heilen. „Sagt allen Menschen deutlich, dass Gott sie ohne Vorbedingung liebt!“, ist die Grundaussage des Auftrags. „Aber sagt es nur, wenn ihr gleichzeitig durch euer konkretes Handeln und Helfen zeigt, dass es wahr ist!“ Jesu Auftrag ist also herausfordernd und ganz konkret zugleich:
Wenn Menschen sich freuen, dann freue dich mit!
Wenn Menschen Sorgen haben, dann stehe ihnen bei!
Wenn Menschen es schwer haben, dann teile mit ihnen die Last!
Wenn Menschen in Not sind und Hilfe brauchen, dann sei zur Stelle!
Wenn Menschen allein sind, dann bleibe bei ihnen!
Wenn Menschen traurig sind, dann lass sie nicht allein in ihrer Trauer, sondern tröste sie!
Wenn Menschen den Glauben, die Hoffnung und die Liebe verloren haben, dann hilf ihnen, Wege zu Gott zu finden, und bete für sie!
Das ist die Taktik, die seelische Dämonen austreibt und Frieden schafft, die Krankes heilt, die Menschen verbindet, die auf Liebe setzt. Es ist eine Taktik, die etwas kostet – nämlich Einsatzbereitschaft, Opfer und Verzicht – und die manchmal etwas Ungewolltes hervorruft – nämlich Unverständnis, Spott und Ablehnung. Die Frage des abgebrühten Zeitgenossen lautet dazu: Was bringt diese Taktik mir persönlich, was bekomme ich dafür?
Die Lebensschule Jesu ist zugleich der Weg wahren inneren Reichtums. Es ist der im Menschen angelegte Weg, der ihn seine Isolierung überwinden lässt, indem er sich auf sein menschliches Gegenüber bezieht. Die Bereitschaft zu teilen, zu geben, Opfer zu bringen, ist eine in uns allen vorhandene Anlage, die jedoch auf mannigfache Weise verschüttet sein kann. Auf diesen Lebensweg der Zuwendung sendet Jesus seine Jünger aus, wohlwissend, dass sein Auftrag nicht leicht ist. Jesus beschönigt nichts, er sagt deutlich, worauf sich die Jünger einstellen müssen, wenn sie sein Kommen vorbereiten. Anders als die Gesandten multinationaler Konzerne sollen sie keine Businesspläne, Titel und Statussymbole, keinen Besitz, kein Geld, keinen Vorrat mit sich führen. Das Gottvertrauen, das sie anderen predigen, sollen sie selbst leben, glaubwürdig und ohne doppelten Boden. Mit ihren leeren Händen sollen sie das, was sie selbst von Gott empfangen haben, an andere weitergeben, großzügig und vorbehaltlos. Sie sind schutz- und mittellos auf die Güte und Großzügigkeit der Menschen angewiesen. Neben dem Gottvertrauen gilt es also auch, den Mitmenschen Gutes zuzutrauen – eine Herausforderung, die Mut abverlangt, aber von der Gottesbeziehung nicht zu trennen ist, wie Papst Franziskus uns unmissverständlich ins Gedächtnis ruft.
Im biblischen Bericht von der Aussendung der Jünger ist von der ganzen Menschheit die Rede, von jedem einzelnen Christen. Getaufte, Gefirmte und Geweihte sind heute die Jünger und Gesandten Jesu. Wir sollen heute die Botschaft Jesu, dass Gott alle Menschen liebt und ihnen nahe sein will, weitersagen und so leben, dass etwas davon für andere erfahrbar wird. Auf uns, unseren Beistand und unseren Trost warten traurige, einsame, notleidende, schmerzgeplagte, zweifelnde und verzweifelte, innerlich zerrissene oder überforderte Menschen – meist nicht weit weg, sondern ganz in unserer Nähe: oft in der eigenen Familie, im Freundeskreis, am Arbeitsplatz. Diesen Auftrag können wir jedoch nicht als Fachleute oder als Besserwisser erfüllen. Es gibt keinen akademischen Titel, der den innerlich freien Menschen ausweisen könnte. Frei aber muss man sein, um den von Jesus gezeigten Weg selbst gehen zu können. Dieser inneren Freiheit geht immer eine echte Selbstbekehrung voraus. Eine tiefgreifende seelische Wandlung, die bei einem selbst die Fixiertheit auf das Haben aufbricht und erleben lässt, dass es mitunter die wertvollsten und schönsten Dinge im Leben sind, die nicht mit vollen Händen zu bewerkstelligen sind – ob wir beten, jemanden umarmen, einem anderen eine Freude machen oder helfen, oder ob wir einfach nur aus freiem Herzen ein Lied singen. Immer dann bewahrheitet es sich, dass Geben seliger ist denn Nehmen, weil es Ausdruck von Liebe und höchster Produktivität ist. Es ist eine Haltung, die, wenn sie echt ist, auf andere ansteckend wirkt und die den tiefgreifenden politischen, ökonomischen und ökologischen Wandel möglich machen wird, den die Erde und unsere Welt so dringend benötigen. Es ist die Haltung, die der wahren Natur des Menschen entspricht.
D wie DINNER CANCELLING
Oder: „Vergelt’s Gott, Hochwürden, vergelt’s Gott, aber ich muss schon speiben!“
Das Angebot an Diätbüchern in den Buchläden ist auch Ausdruck einer Gesellschaft, die materiell im Überfluss lebt und ihre Sinnsuche in Gesundheits-, Schlankheits- und Schönheitskulte verlegt hat. Auch kirchliche Kost wird auf die Diätlisten der säkularisierten Gesellschaft verbannt. Was tun, wenn zum christlichen Gastmahl zwar alle eingeladen sind, aber keiner zum Essen erscheint? Ägidius Zsifkovics erinnert seine Amtskollegen bei einer Vollversammlung der Österreichischen Bischofskonferenz in Brüssel daran, dass das Evangelium nie ein Mastprogramm war, sondern die Anleitung, Salz im Teig des Lebens zu sein. Es ist das Gastmahl im größten aller Säle, der nie voll ist und in den immer irgendjemand eingeladen werden möchte. Voraussetzung: Gastgeber, die nicht nur einladen, sondern selbst einladend wirken.
Die Situation, in welcher der christliche Glaube, die Kirche, ihre Priester, Bischöfe und alle, die im Verkündigungsdienst stehen, sich heute befinden, könnte wohl kaum prägnanter auf den Punkt gebracht werden als mit dem Gleichnis vom Festmahl, das wir im Lukas-Evangelium finden. Darin ist die Rede von jemandem, der zu einem großen Festmahl einlädt und seinen Diener ausschickt, um die Einladung persönlich zu überbringen. Doch keiner der Geladenen folgt der Einladung. Alle haben eine Entschuldigung. Alle bleiben zu Hause.
Hier an diesem Ort, nahe bei den Institutionen der EU und den politischen Schaltstellen des Vereinten Europa, bekommen wir ein kontinentales Gefühl für die Enttäuschung des erfolglosen Dieners im Evangelium. Die Kirche in Österreich und in ganz Europa lädt ein – und immer mehr Menschen, auch wichtige gesellschaftliche Entscheidungsträger, folgen der Einladung nicht! Ohne Pathos und Wehleidigkeit können wir es sagen: So sehr das Christentum eine der Wurzeln Europas ist, so sehr erleben wir als Kirche täglich, wie es im politischen und gesellschaftlichen Kontext Österreichs, aber auch im europäischen Projekt zunehmend zum Fremdkörper zu werden scheint. Wir erleben eine Marginalisierung christlicher Identität, ja sogar regelrechte kirchliche Rückzugsgefechte in ethischen Fragen – seien es die skandalösen Methoden der Fortpflanzungsmedizin, die verbrauchende Embryonenforschung oder die rechtliche Gleichstellung homosexueller Partnerschaften mit der Ehe, die im christlichen Verständnis nun mal an Nachkommenschaft geknüpft ist und einen unveräußerlichen Wert als Keimzelle der Gesellschaft besitzt. Ja und es scheint sogar so, als ob nicht nur anderweitige Verpflichtungen die Geladenen abhalten würden, sondern ein kategorisches Unverständnis für das Festmahl an sich vorliege. Mehr und mehr wird den Christen in der europäischen Gesellschaft signalisiert: Eure Werte sind nicht unsere Werte!
Diese Situation erinnert mich ein wenig an den burgenländischen Mesner vom Land, dem sein Pfarrer eine echte Freude machen wollte und ihn zu einem Festschmaus in den Pfarrhof einlud. Der Pfarrer hat dem guten Mann immer wieder nachgelegt, eine Scheibe Schweinsbraten mit Krautsalat hier, eine Blunze dort, zuletzt noch die burgenländische Mehlspeis, bis sich der Mesner, der aus Gehorsam schon weit über den Hunger hinaus gegessen hatte, schließlich nicht mehr erwehren konnte und zum Pfarrer im Tonfall größter Ehrerbietung sagte: „Vergelt’s Gott, Hochwürden, vergelt’s Gott, aber ich muss schon speiben.“
Auch die Kirche will den Menschen zur Freude führen, jener Freude, die vor 2000 Jahren den Hirten auf den Feldern von Bethlehem verkündet wurde. Doch wir verkaufen kein Fast Food, sondern bieten den Menschen gewichtige Antworten auf existentielle Fragen an. Haben wir sie dabei überfordert? Sind wir mit unserem Speiseplan zu aufdringlich gewesen? Haben wir die anspruchsvolle Speise so schlecht zubereitet, dass die Menschen die hochwertige geistliche Nahrung des Evangeliums gar nicht in sich aufnehmen können? Haben wir als Institution wirklich so viel Wein getrunken, wie man uns gerne vorwirft, während wir den Menschen das Wasser gepredigt haben?
Vieles davon mag zutreffen. Und doch ist es nicht die volle Erklärung für die Ablehnung und die Gleichgültigkeit, die dem Christentum heute widerfährt. Waren nicht schon Jesus, seine Jünger, Petrus und Paulus und die ersten Gemeinden von all dem betroffen? Dass das Christentum später als Staatsreligion den Ehebund mit der weltlichen Macht eingegangen ist, die Christus zu ihrem Logo machte, hat den „Skandal“ des Christentums nur über Jahrhunderte hinweg zugedeckt. Das eigentliche Ärgernis des Christentums mit seinem „Wider die Welt!“ ist damals wie heute unverändert gegeben.
Wir kennen aber die Antwort des Hausherrn im Evangelium, die auf die Absage der Geladenen folgt: „Geh hinaus und führe die Armen, Verkrüppelten, Blinden und Lahmen herein!“ Der Herr selbst lehrt uns hier die Methode der Neuevangelisierung: Jesus schickt uns immer wieder aus, um zu seinem himmlischen Gastmahl einzuladen. Egal, wie ernüchternd die Absagen auch sein mögen. Die Säkularisierung verlangt von der Kirche, die eigene Präsenz in der Gesellschaft neu zu überdenken – und zu erkennen, dass die vielen und ständig neuen Formen der Armut der tätigen Nächstenliebe unbekannte Räume eröffnen! Die Authentizität der Neuevangelisierung trägt das Antlitz der Armen – auch und gerade in Europa! Darin liegt die Chance einer Entflechtung von alten gesellschaftlichen Mustern hin zum Ureigensten des Christentums: zum Evangelium!
„Es ist aber noch Raum da!“, sagt der Diener, nachdem er bereits die Armen und Kranken in den Festsaal geholt hat. Dieser sich festen Abmessungen entziehende Raum ist die Kirche selbst. Die Kirche ist, wie die Weltbischofssynode von 2012 festgehalten hat, „der Raum, den Christus in der Geschichte anbietet, um ihm begegnen zu können.“ Ihr hat er sein Wort und seine Sakramente anvertraut. In diesem Raum ist in besonderem Maße Platz auch für die, die draußen stehen, an den „Zäunen“, die Fernen, die wir wieder vermehrt zum Mahl rufen müssen – auch und gerade in Europa! Dabei soll uns bewusst sein, dass sich unser persönlicher Glaube als Christen und als Bischöfe ganz in der Beziehung entscheidet, die wir selbst mit der Person Christi aufbauen, der uns selbst als seinen Dienern als erster entgegengeht: Neuevangelisierung beginnt bei uns selber und bei der eigenen Bekehrung. Aus dieser eigenen Bekehrung heraus werden wir glaubhafte Gastgeber sein, denen die Menschen folgen und vertrauen können.
E wie EVOLUTION
Oder: Ein anderes Wort für Evangelium
In sechs Tagen schuf Gott die Welt – das erste Kapitel der Bibel sagt in wenigen bildhaften Worten, wofür Charles Darwin 377 Seiten brauchte, nämlich dass unsere Welt in Epochen und Perioden entstand und dass der evolutive Aufstieg dieser Welt im Grunde der darwinschen Lehre gleicht. Fernab von Sozialdarwinismus und Kreationismus richtet Ägidius Zsifkovics den Zeigestab auf den Stammbaum der Arten und entdeckt dabei – hoppala! – das lang gesuchte „missing link“.
In der wissenschaftlichen Diskussion wird heute glücklicherweise wieder sehr genau unterschieden zwischen der Evolutionstheorie als wissenschaftlicher Hypothese innerhalb eines bestimmten Forschungsgebietes – z. B. in der Physik oder der Biologie – und dem Evolutionismus, also dem Versuch einer Gesamterklärung der Wirklichkeit, wie es der Darwinismus des 19. Jahrhunderts war. Ein solcher Evolutionismus ist heute nicht mehr State-of-the-art. Die gegenwärtige wissenschaftliche Vernunft ist nicht mehr der Meinung, dass die Evolutionstheorie über die naturwissenschaftlichen Fragen hinaus auch alle metaphysischen und religiösen Fragen beantworten kann. Und selbst wenn es so wäre, bliebe immer noch die Frage nach der Herkunft der Evolutionsgesetze. Der Physiker Paul Davies sagt zu Recht, dass Gesetze erst einmal da sein müssen, damit das Universum entstehen kann. Diese „Begegnung mit dem Wunderbaren“ bleibt der Naturwissenschaft also nicht erspart. Führende Physiker des zwanzigsten Jahrhunderts haben sich zu diesem Transzendenzbezug bekannt: Niels Bohr, Albert Einstein, Werner Heisenberg, Arthur Eddington, Wolfgang Pauli, Max Planck, Erwin Schrödinger, Carl Friedrich von Weizsäcker, Hans-Peter Dürr und viele andere. Ähnliche Zeugnisse gibt es von renommierten Biologen wie etwa dem Genetiker Carsten Bresch.
Der christliche Glaube darf trotz dieser „Begegnung mit dem Wunderbaren“ seinerseits nicht den Anspruch stellen, Gott wissenschaftlich erklären zu wollen. Damit würde er nur das Wesen des Glaubens als existentielles Grundvertrauen in größere Zusammenhänge beschädigen und den beschränkten menschlichen Verstand zum Götzen erheben. Was der christliche Glaube jedoch zu leisten vermag, ist eine Weltdeutung, die nicht in beleidigendem Widerspruch zu wissenschaftlicher Erkenntnis steht. Eine Weltdeutung, die eine Weltgestaltung ermöglicht und ebenso kompatibel mit dem Schöpfungsbericht des Buches Genesis ist wie mit dem Urknall, der Evolutionstheorie, dem Elektronenmikroskop oder dem Teilchenbeschleuniger. Es ist immerhin ein und derselbe Hirnapparat, der in der Evolution des Menschen die wissenschaftliche Forschung ebenso hervorgebracht hat wie den religiösen Glauben oder die Fähigkeit künstlerischen Schaffens. Warum also nicht allen diesen großartigen menschlichen Erkenntnisweisen ihr Recht lassen?
Der Fingerzeig einer Evolution, deren Strukturgesetz die Einswerdung ist, die Atome durch Vereinigung zu Molekülen werden lässt, Moleküle durch Vereinigung zu Zellen und zu Leben, Lebewesen zu Menschen und Menschen zur Menschheit, findet aus christlicher Sicht ihren Brennpunkt in der Person des Jesus von Nazareth. Systematische, breit angelegte Gedanken über Nächstenliebe finden sich zwar schon bei den vorchristlichen Stoikern, so etwas wie Mitleid oder Empathie dürfte es bereits bei den ersten Menschen in Ansätzen gegeben haben. Doch erst in Jesus von Nazareth blicken wir in das Antlitz einer Menschheit, die sich ihrer Personalität voll bewusst geworden ist und das Gesetz der Liebe als das Entwicklungs- und Überlebensgesetz der Evolution erkannt hat. In einer solchen Menschheit wachsen ab nun der Sinn und das Verlangen für das Irreversible, für die zunehmende Einzigartigkeit, Unersetzlichkeit und Unzerstörbarkeit der Elemente des Universums je nach Höhe der Entwicklungsstufe. Es ist, theologisch ausgedrückt, der Moment der Menschwerdung Gottes in der Evolution, und er findet programmatischen Ausdruck im Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Aus diesem Gleichnis, das ins kollektive Gedächtnis der Menschheit, in ihre edelsten Kunstwerke eingegangen ist, lassen sich drei Leitsätze herauslesen:
Der erste Leitsatz: Nicht fertige Antworten, sondern weiterführende Fragen!
Jesus antwortet im Evangelium nicht sofort auf die Frage des Gesetzeslehrers: „Was muss ich tun, um das ewige Leben zu gewinnen?“ Jesus fragt zurück und lässt den Gesetzeslehrer erklären, woran er selbst sich bisher orientiert hat. Erst nach der zweiten Frage des Gesetzeslehrers, „Und wer ist mein Nächster?“, erzählt Jesus die Geschichte vom barmherzigen Samariter und will am Ende wissen, ob sein Gegenüber eine neue Erkenntnis daraus gewonnen hat. Jesus hilft damit dem Fragesteller, seine eigene Antwort zu finden.
So verstehe ich das Christsein und die gelingende Evolution des Menschen: Ich darf meinen eigenen Glaubensweg gehen. Jesus führt dabei auch mich durch seine Worte und Geschichten zu einer persönlichen Antwort auf die Frage: Wie gewinne ich ewiges Leben? – oder anders ausgedrückt: Wie bekommt mein Leben einen Sinn? Wie kann es gelingen und vor Gott bestehen? Und so stelle ich mir auch eine Kirche vor, die an Jesus Maß nimmt: Sie weiß nicht alles schon im Voraus, sie wiederholt nicht nur vorgegebene Antworten, die früher vielleicht einmal richtig waren, sondern sie lässt sich durch das Evangelium immer wieder neu anfragen und herausfordern. Sie regt uns alle zur beständigen Suche nach der Wahrheit an und ermutigt zu einem originellen Leben im Sinne Jesu. Nicht fertige Antworten, sondern weiterführende Fragen helfen dem Homo sapiens, das Christsein anzunehmen und es zu leben.
Der zweite Leitsatz: Nicht starre Gesetze, sondern situationsgerechte Entscheidungen!
Jesus sieht – wie auch der Gesetzeslehrer – im Liebesgebot den Schlüssel zu allen anderen Geboten und Verboten des jüdischen Gesetzes. Die Vorschriften haben nur dann einen Sinn, wenn sie der Liebe zum Durchbruch verhelfen; wenn sie Leben fördern und nicht einschränken; wenn sie die Freiheit des Einzelnen schützen und nicht behindern. Durch die Beispielsgeschichte will Jesus dem Gesetzeslehrer deutlich machen: Wer der Nächste ist, lässt sich nicht gesetzlich regeln. Wer in Not ist und wer mich braucht, wird mir zum Nächsten. Die erste Frage ist daher nicht: Was verlangt das Gesetz von mir? Was darf ich und was darf ich nicht?, sondern: Was ist hier und jetzt notwendig und notwendend?
So verstehe ich das Christsein und die gelingende Evolution des Menschen: Ich muss die Welt nicht durch die Brille vieler Vorschriften und Verbote betrachten, sondern ich darf in jedem Augenblick fragen: Was entspricht jetzt, in diesem konkreten Augenblick, dem Gebot der Liebe? Wie kann ich jetzt dazu beitragen, dass Leben sich entfaltet, Menschen Hilfe erfahren und befreit aufatmen können? Und so stelle ich mir auch eine Kirche vor, die an Jesus Maß nimmt: Sie presst das dynamische und sich ständig verändernde Leben nicht in ewig gültige Normen, sondern traut mir zu, mich in den verschiedenen Herausforderungen meines Lebens für das zu entscheiden, was im Sinn Jesu das jeweils Gute und Richtige ist. Nicht starre Gesetze, sondern situationsgerechte Entscheidungen helfen der Kirche, den Geist der Freiheit zu wahren und mutigen und vorausdenkenden Christen in ihr einen Platz zu geben.
Der dritte Leitsatz: Nicht fromme Sprüche, sondern menschliche Gesten!
Jesus nimmt in seiner Erzählung das Wort „Gott“ nicht ein einziges Mal in den Mund. Jesus erzählt eine Alltagsgeschichte, in die sich seine Zuhörer gut hineindenken können. Und doch ist die Nähe Gottes überall zu spüren: in der Art, wie Jesus dem Gesetzeslehrer eine neue Perspektive eröffnet; im Mitleid des Samariters; in seiner konkreten Hilfe für den Überfallenen. Jesus will den Gesetzeslehrer zur Tat bewegen, indem er ihn auffordert: „Dann geh und handle genauso!“ Nicht durch fromme Worte, sondern durch menschliche Gesten also wird Gott hörbar, erlebbar und spürbar.
So verstehe ich das Christsein und die gelingende Evolution des Menschen: Ich muss nicht viel von Gott reden. So wie ich lebe, wie ich zuhöre, wie ich auf andere zugehe, kann Gott zum Vorschein kommen. „Rede von Gott nur, wenn du gefragt wirst! Aber lebe so, dass man dich fragt!“, lautet die Devise. Und so stelle ich mir auch eine Kirche vor, die an Jesus Maß nimmt: Sie redet nicht vollmundig und wissend von Gott, sondern fördert in ihren Gemeinden und Gemeinschaften eine offene, gastfreundliche Atmosphäre, in der man die Menschenfreundlichkeit Gottes ahnen und erfahren kann. Wenn uns jemand auffordert: „Zeig uns deinen Gott!“, dann müssten wir antworten: „Sieh unseren Gottesdienst und unser Leben, wie wir uns um unsere Mitmenschen mühen, wie wir mit Konflikten umgehen, mit eigener und fremder Schuld, wie wir Frieden zu stiften versuchen und uns versöhnen – dann weißt du, wer unser Gott ist!“ Nicht fromme Sprüche also, sondern menschliche Gesten helfen mir, etwas von der Liebe Gottes zu spüren und weiterzugeben.