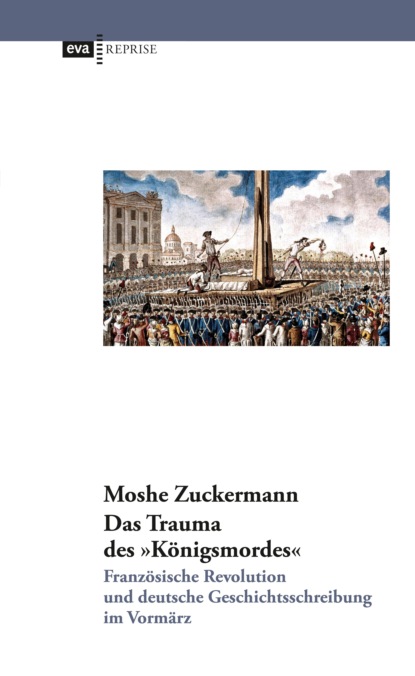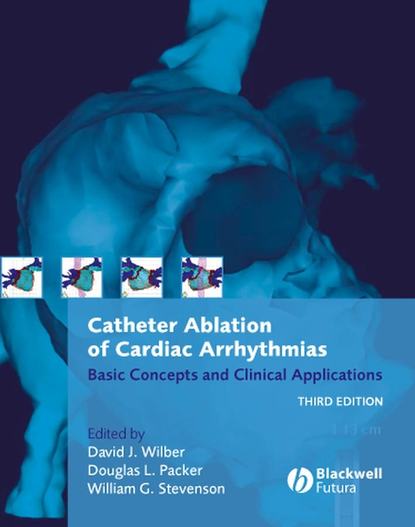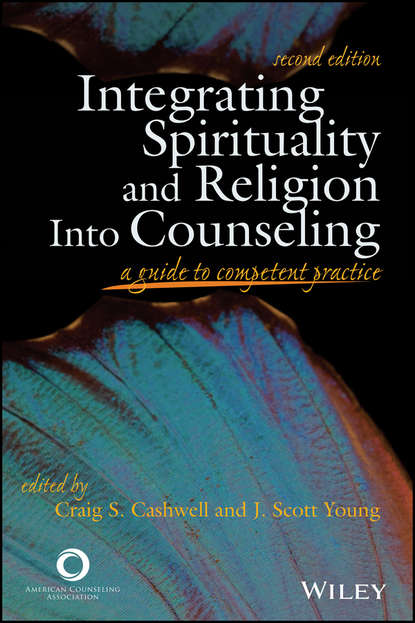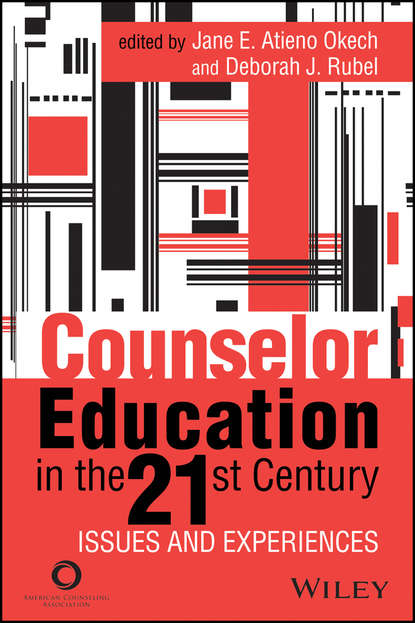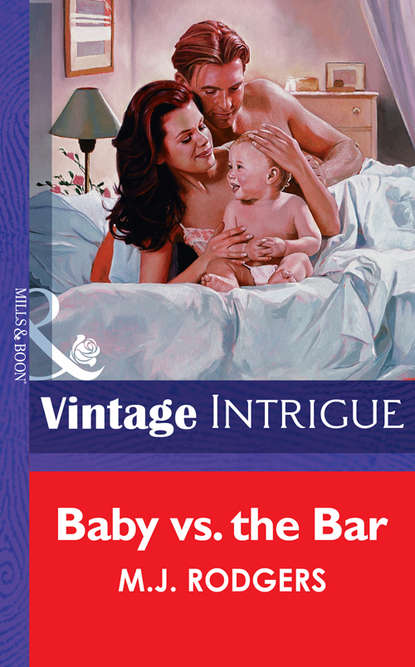- -
- 100%
- +
Im nachhinein lassen sich die »Septembermorde« als Bindeglied zwischen dem 10. August, dem Tag der Bestürmung der Tuileries und des Sturzes der Monarchie, und dem 21. September, dem Tag der Errichtung der Republik, begreifen. Die Manifestation der Kode-Matrix ist in diesen beiden Monaten besonders prägnant; fast will es scheinen, als durchlaufe die Auflehnung gegen die Autorität die Gewalttätigkeit, um in die Emanzipation einzumünden. Der Übergang zur Republik selbst verdeutlicht freilich die zwangsläufige Ambivalenz, die mit diesem Vorgang einhergeht. »Wenn Paris kein Königtum mehr haben will, will es darum die Republik?« fragt Aulard, »[…] Haß auf das Königtum, Zaudern, sich für die Republik zu erklären – diese beiden widerspruchsvollen, aber tatsächlichen Empfindungen leben beieinander im Geiste des Pariser Volkes […]«.69 Der Auflehnungsakt gegenüber den Mächten der Vergangenheit wird also von einer Unentschlossenheit, die Regierungsform auszurufen, welche die Souveränität und die neuerlich gewonnene Freiheit repräsentieren soll, begleitet. Im Grunde wird »die Republik […] nicht ausgerufen; sie entsteht erst am nächsten Tag, fast verstohlen, durch die Entscheidung, daß fortan alle amtlichen Aktenstücke ›aus dem Jahr I der Republik.‹ zu datieren sind«.70 Die erste Aufnahme des neuen Zustandes durch die Bevölkerung ist dementsprechend »ziemlich kühl«; die meisten Zeitungen feiern »eher die Abschaffung des Königtums als die Aufrichtung der Republik.« Sogar im Jakobinerklub hütet man sich, das Wort ausdrücklich zu erwähnen. »Erst am 24. September beschlossen sie, ihr Protokoll vom Jahre I der Republik zu datieren.«71 Die Revolutionäre wußten sehr wohl, daß die Anhänglichkeit an den König noch überall in Frankreich recht weit verbreitet war. Auch ohne Robespierres Monarchismus im Jahre 1789 hervorzuheben, kann man behaupten, daß sowohl er als auch andere radikale Führer der Revolution sich dessen bewußt waren, daß »der Monarch von einer riesigen, als ›Volk‹ bekannten Menge – den Arbeitern und den Bauern – geliebt wurde, und dies nicht nur religiöser Sentimente halber oder wegen des der geheiligten Person des Königs beigemessenen, legendären Prestiges (obschon diese Empfindungen nicht außer acht gelassen werden sollten)«, sondern weil er als Beschützer der Bauern vor der Tyrannei des örtlichen Adels gilt, und weil »die große Macht der Monarchie als politische Institution darin liegt, daß sie die Kontinuität gewährleistet.«72 Es waren Vermutungen solcherart, die Befürchtungen und Zweifel im Herzen eines Mannes wie Marat haben aufkommen lassen: »Er war der Meinung, die Republik sei schwach; die Franzosen seien keine guten Republikaner und nicht für die Freiheit geboren. Die Worte République française riefen bei ihnen offensichtlich keinerlei Gefühlsaufwallungen hervor. […] Deshalb weigerte er sich, an die Republik zu glauben, bis Ludwigs Haupt von seinen Schultern getrennt wurde.«73
Angesichts dieser Gegebenheiten geht man wohl nicht fehl, wenn man der Hinrichtung des Königs, dem konkreten »Vatermord«, die Funktion eines Kriteriums für die Bereitschaft und Fähigkeit der französischen Bevölkerung, den begonnenen politischen Emanzipationsprozeß durchzustehen, beimißt. Der Prozeß des Königs wird somit zu ihrer letzten Prüfung vor der endgültigen Entscheidung über das Schicksal der Revolution. Je näher aber der unumgängliche Entscheidungsmoment heranrückt, desto stärker bricht die Ambivalenz bei den Revolutionären durch, wie sowohl den gegensätzlichen Positionen der Girondisten und der Montagnards als auch der Weise, wie jede der Seiten seine Position der Öffentlichkeit präsentiert, zu entnehmen ist. Robiquets Bemerkung, daß weder die Sitzungen des Konvents noch die langwährende Abstimmung über die Verurteilung des Königs von einer sonderlich »schweren und schmerzerfüllten« Stimmung gekennzeichnet gewesen seien, erfährt eine unserer Darlegung gemäße Deutung, wenn man der Darstellung Gascars folgt:
»So haben die Girondisten durch allerlei Aktivitäten versucht, das Erscheinen des Königs vor der in einen Gerichtshof verwandelten Versammlung hinauszuzögern. Sie hatten zwar selbst die Maßnahme verlangt, fürchten aber nun ihren Ausgang und wagen nicht die Nachsicht, die sie mit dem gestürzten Monarchen haben, konsequent zu vertreten. Die Montagnards dagegen sind zwar entschlossen, ihn zum Tode verurteilen zu lassen, hüten sich jedoch, die Strafe auch offen zu verlangen; sie wissen nur zu gut um den unklaren Respekt, den ein Großteil der Bevölkerung noch immer vor der Person des Königs empfindet. Wegen dieser zwar gegensätzlichen, aber auf beiden Seiten nicht eindeutig zum Ausdruck gebrachten Haltung vollziehen sich der Prozeß Ludwigs XVI. und wenig später die namentliche Abstimmung der Abgeordneten ohne laute, lärmende Debatten in gleichsam schemenhaften Halbdunkel.«74
Wir meinen, daß die sich in der Äußerungssweise der streitenden Positionen widerspiegelnde Ambiguität mehr als nur politisches Kalkül zum Inhalt hat. Die Tatsache, daß viele der Versammlungsmitglieder ihre Meinung im Laufe der Sitzungen geändert haben, die girondistische Forderung, eine Volksbefragung bezüglich der Urteilsfrage zu veranstalten und die Weigerung der Jakobiner, dieser Forderung nachzukommen, sowie die Meinungsverschiedenheiten innerhalb der Girondisten selbst und die knappen Ergebnisse der Abstimmung – all diese deuten nicht nur darauf hin, daß »die große Mehrheit der Franzosen noch immer Royalisten« waren, sondern auch, daß ein nicht unbedeutender Teil der Volksvertreter selbst vor dem »Odium des Königsmordes« zurückschreckte.75 Soboul hat demnach zwar recht mit seiner Behauptung, daß wenn man den Tag des 10. August nicht verurteilen wollte, man tatsächlich gezwungen gewesen sei, den König für schuldig zu erklären, aber man sollte die Schwierigkeit der Verwirklichung einer solchen zweckrationalen Unumgänglichkeit im Spiegel der Aussagen vieler der Versammlungsmitglieder bewerten, die bezeugten, »wie sehr die Tatsache sie bewegte und erschütterte, daß ein ehemaliger König vor der Vertretung seines Volkes als Angeklagter erschien.«76
Eine solche Verknüpfung von erklärten politischen Zielsetzungen und (der Ambivalenz Ausdruck verleihenden) emotionalen Äußerungen lassen sich auch deutlich an den Reden der Delegierten im Laufe des Prozesses des Königs ablesen. »Bürger,« ruft Saint-Just am 13. November, »wenn das römische Volk nach sechs Jahrhunderten der Tugend und des Hasses gegen die Könige, wenn Großbritannien nach Cromwells Tod das Königtum trotz seiner Energie wieder aufleben sahen, was müssen bei uns nicht die guten Bürger, die Freunde der Freiheit fürchten, wenn sie das Beil in unsern Händen zittern sehen, wenn sie ein Volk erblicken, welches am ersten Tag seiner Freiheit vor der Erinnerung an seine Ketten Scheu hat! Welche Republik wollen Sie mitten unter unsern innern Kämpfen und unserer gemeinsamen Schwäche errichten?«77
Die rhetorische Frage, die den Delegierten das Irrationale ihrer Reaktion auf den möglichen Tod des Königs vor Augen führen soll, deckt gerade jene Sphäre auf, die sich eines rein rationalen Zuganges entzieht. Die Hand zittert, weil sie das Beil zur Vollbringung einer Tat führen soll, der gegenüber das Herz zwiespältig empfindet; sie kann diese Tat nicht wie selbstverständlich ausführen, genauso wie der Schwenker des Beils seine Freiheit nicht auf Befehl zu empfinden vermag, eben weil er sich mit der psychischen Realität von Erinnerungen, die ihn paralysieren, auseinanderzusetzen hat. Es handelt sich demnach um den Versuch, die Ambivalenz zu überwinden, wenn Saint-Just feststellt: »Dieselben Menschen, welche Ludwig richten sollen, haben eine Republik zu gründen; diejenigen, welche der gerechten Bestrafung eines Königs irgendwelche Wichtigkeit beilegen, werden niemals eine Republik gründen.«78 Ähnlich stellt auch Jacques Roux das Problem als eine Dichotomie ohne möglichen Zwischenweg dar: »Entweder fällt Louis’ Kopf oder wir werden uns unter den Trümmern der Republik begraben.«79 Es erhebt sich die Frage, warum es die Revolutionäre so sehen. Welchen Schaden kann schon der gestürzte und eingesperrte Ludwig noch verursachen? Die Antwort hierauf dürfte klar sein: Nicht in seiner Fähigkeit zu handeln und zu schaden liegt Ludwigs Macht, sondern in der Art, wie die durch ihn verkörperte Institution verinnerlicht worden ist; die ihm durch die psychische Realität verliehene Macht ist ungleich größer als seine objektive. Dies fühlt offensichtlich auch Robespierre, als er im November 1792 behauptet: »Bürger, wenn es euch schwerer fällt, einen König zu bestrafen als einen schuldigen Bürger zu belangen; wenn eure Strenge in umgekehrtem Verhältnis zur Größe des Verbrechens und zu der Schwäche des Verbrechers steht, dann seid ihr noch sehr weit von der Freiheit entfernt; dann besitzt ihr noch immer die Seele und die Vorstellungen von Sklaven.«80
Die Seele von Sklaven ist die Seele von Menschen, die in einen repressiven Zustand hineingeboren wurden, die die Freiheit nicht als eine Grunderfahrung verinnerlichen gelernt und daher eine psychische Verfassung der Abhängigkeit entwickelt haben. Sklaven sind fast so machtlos wie Kinder; Robespierres rügende Worte spiegeln also ein objektives Paradox wider: Er wendet sich an die Versammlungsmitglieder als rationale Erwachsene, ahnt jedoch auch, daß sie in der Zwickmühle der Ambivalenz eingezwengt sind. Er muß daher seine Zuhörer in einen quasi prämoralischen Zustand versetzen: »Wenn eine Nation gezwungen gewesen ist, auf das Recht des Aufstandes zurückzugreifen, tritt sie dem Tyrannen gegenüber in den Naturzustand zurück.« Und in diesem Sinne erhält die Beziehung zum König eine neue Bedeutung: »Es gibt hier keinen Prozeß zu führen. Ludwig ist kein Angeklagter. Ihr seid keine Richter. Ihr seid lediglich Vertreter des Staates und Repräsentanten der Nation und könnt auch nichts anderes sein. Ihr habt kein Urteil für oder gegen einen Menschen zu fällen, sondern eine Maßnahme im Interesse der Öffentlichkeit zu ergreifen und einen Akt auszuführen, der für das Schicksal der Nation bedeutungsvoll ist.«81 Im Naturzustand gibt es kein Gewissen und keine herkömmliche Moral, sondern ein natürliches Recht zur Auflehnung; ein solcher Zustand ermöglicht auch die Verwendung mythischer Bilder, um die Gestalt des Vaters zu eliminieren und die Erinnerung an ihn auszumerzen: »Die Völker richten nicht auf die gleiche Weise wie die Gerichtshöfe; sie fällen keine Urteile, sondern sie schleudern Blitze; sie verurteilen die Könige nicht, sondern werfen sie ins Nichts zurück«.82 Robespierre weiß aber auch, daß sich das Problem vor allem in den Revolutionären selbst befindet; er wendet sich daher an die Girondisten: »Man sagt, es handele sich um einen Fall von größter Bedeutung und man müsse mit Weisheit und bedächtiger Umsicht urteilen. Aber ihr allein seid es, die einen großen Fall daraus machen. […] Ihr macht einen großen Fall daraus, aber was findet ihr daran eigentlich so groß? […] Was ist das Motiv dieser ewigen Verzögerungen, die ihr uns anempfehlt?« Er beantwortet die Frage selber, indem er den Spieß umdreht und jene Argumentationslinie gebraucht, die er späterhin heranziehen wird, um sich dann allerdings der Volksbefragung zu widersetzen: »[…] als ob das Volk eine gemeine Herde von Sklaven wäre und einfältig an einen hinterhältigen Tyrannen noch hinge, nachdem es ihn längst verbannt hat, und als ob es sich um jeden Preis in Niedrigkeit und in Knechtschaft wälzen wollte. […] Ihr glaubt also noch an die eingeborene Liebe zur Tyrannei?«83 Es ist ganz und gar nicht klar, ob sich Robespierre selber dessen sicher ist, daß sich das Volk schon von seiner traditionellen Loyalität dem Monarchen gegenüber emanzipiert habe; er wendet sich an die Delegierten, als sähe er die traumatischen Auswirkungen der Hinrichtung des Herrschers voraus, als wüßte er um die psychologische Bedeutung der Verdrängung: »Warum erscheint uns etwas klar, was uns später dunkel vorkommt?« Der Fragende kennt anscheinend die Antwort; er ahnt, daß das Gedächtnis dem Gewissen nachgibt; er ist daher bestrebt, die Revolution im Gewissen selbst hervorzurufen: »[…] ihr stellt immer noch die Person des Königs zwischen uns und der Freiheit! Im Namen unseres Gewissens sollten wir uns davor fürchten, zu Verbrechern zu werden; wir sollten fürchten, daß wir uns selbst an die Stelle des Schuldigen setzen, wenn wir ihm zu viel Nachsicht erweisen.« Als Beispiel gibt Robespierre sich selber – er habe es geschafft, sich vom König emotional zu lösen: »[…] ich empfinde für Ludwig weder Liebe noch Haß; ich hasse nur seine Missetaten.« Aus all dem folgert er also: »Ludwig muß sterben, weil das Vaterland leben muß.«84
Dieser letzte Satz enthält in komprimiertester Dichte die gesamte dialektische Logik des »Vatermordes« und seines emanzipatorischen Sinns: Anstatt der traditionellen Formel »Der König stirbt niemals!« und ihrer historischen Entwicklung »Der König ist tot, es lebe der König!«85, tritt nun das revolutionäre Postulat, daß der König, sozusagen der »Vater«, sterben muß, damit die »Brüderschar« leben kann, ihn also beerben kann, um sich alsdann in eine neue, nunmehr das Vaterland beherrschende »Vater«-Kategorie zu verwandeln. Unter diesem archetypischen Gesichtspunkt ist es nicht so sehr relevant, daß sich die Versammlungsmitglieder in ihrer Stimmabgabe von keinem Ressentiment Ludwig gegenüber haben leiten lassen, wie Furet und Richet hervorheben, sondern vielmehr, daß sie einerseits der durch ihn verkörperten Institution überdrüssig waren, es ihnen aber andererseits dennoch schwer fiel, gegen ihn zu stimmen. In diesem Sinn vermitteln Robespierres Worte nach der Entscheidung mehr als ein nur persönliches Bekenntnis: »Ich fühlte in meinem Herzen die republikanische Tugendstrenge wankend werden, als ich den gedemütigten Schuldigen vor der souveränen Gewalt stehen sah.«86
Ludwig selber verkörperte nicht gerade die Idealgestalt des Schuldigen. Einerseits spielte er zwar vom Anbeginn der Revolution durch sein Zaudern, durch Versuche, seine Stellung auch in verlorenen Situationen zu wahren, durch pathetische Handlungen, wie etwa das gescheiterte Fluchtunternehmen, und durch aberwitzige Ungereimtheiten, wie die systematische Sammlung von Dokumenten, die seine konspirativen Absichten bezeugten, im eisernen Schrank seines Schlosses, in die Hände der Revolutionäre. Andererseits erweckte aber der dickliche, etwas einfältige König doch die Sympathie seiner Untertanen. Im Grunde bestand anfangs kein Ziel, ihn zu stürzen. Die meisten Revolutionäre vertraten die Auffassung, daß wenn es gelänge, ihn vom Einfluß der Hofleute zu separieren und zur Unterstützung der ersten Revolutionsphasen zu bewegen, so wäre dies noch immer der wünschenswerteste Zustand. Die realen revolutionären Begebenheiten amplifizierten daher die Ambivalenz dem Monarchen gegenüber umso mehr–eine Tatsache, die sich in der Forderung, den »gekrönten Verräter« zu bestrafen, einerseits und in den Gnade erflehenden Petitionen andererseits ausdrückte.87 Eine solche Situation erschwerte zweifelsohne die Lage derjenigen im Konvent, die seine Verurteilung anstrebten. Man konnte Ludwig wohl als Verräter darstellen, aber die immer wieder zu hörende Bezeichnung seiner Person als »Tyrannen« kennzeichnete weniger eine tatsächlich so empfundene Realität, als vielmehr den hilflosen Versuch, sich mit der psychologischen Archaik der Gesamtsituation auseinanderzusetzen. Unter solchen Umständen wird das Bedürfnis der Anlehnung an den historischen Präzendenzfall der Hinrichtung Karls I. von England sowohl unter den Konventsmitgliedern als auch bei der Bevölkerung verständlich.88 Das Präzedens forciert gewissermaßen die Motivation zur Handlung, wobei es das kontingenzbedingte Unbekannte sozusagen eliminiert. Das Bedürfnis nach Bekräftigungen ist an den Äußerungen der Delegierten nach der Abstimmung und der Entscheidung über den Tod des Königs deutlich erkennbar: »[…] von allen Opfern, die ich meinem Heimatland dargebracht habe, ist dieses das einzige, das würdig ist, registriert zu werden«, bekennt Roger Ducos, und Lebas schreibt am 20. Januar, einem Tag vor Vollzug des Urteils: »Jetzt sind wir auf dem Weg, die Brücken hinter uns sind zerstört; ob wir wollen oder nicht, wir müssen vorwärts gehen; und besonders für diesen Augenblick gilt der Satz: in Freiheit leben oder sterben.«89
Eine düstere Stimmung liegt am 21. Januar 1793 über Paris. Man bewegt sich langsam und wagt es kaum, sich in die Augen zu schauen, wie ein zeitgenössischer Beobachter berichtet. Alle Geschäfte sind geschlossen, und eine »schreckliche Stille« lastet auf den Straßen. Trotz der in ihr enthaltenen späten Interpretation und des karrikierenden Untertons widerspiegelt die Kindheitserinnerung J.G. Millingens treffend die Empfindung vieler der Bewohner der Hauptstadt an jenem Tag. Er beschreibt seinen Begleiter, »dessen demokratischen Energien nun durch die Feierlichkeit des Tages gedämpft waren, und der trotz seiner Anstrengungen, gleichgültig zu erscheinen, dann und wann schluchzte und sich eine herunterrollende Träne abwischte«.90 Wir erwähnen diese individuelle Impression, weil sie deutlich macht, wie viele Jahre nach dem akuten Ereignis sowohl die seinen Akteuren eigene Ambivalenz als auch die auf diese bezogene ideologische Stellungnahme noch immer motivisch durchschimmern: Die beschriebene Person bezahlt ihre demokratischen Neigungen mit Leid und Trauer; hätten diese Neigungen nicht die Hinrichtung des Königs gezeitigt, so würde es sich auch erübrigen, ihn beweinen zu müssen. Die dialektische Umkehrung dieser Deutung würde ergeben, daß die Chance für die mögliche Emanzipation nur um den Preis des mit der Loslösung von den traditionellen Bindungen einhergehenden Schmerzes erreichbar wird. Auf diesem Weg gibt es eben kein Entrinnen vor der erforderlichen Durchbrechung der Tabuschranken.
Bis zum letzten Augenblick kann Cléry, der treue Diener des Königs, nicht glauben, daß man das Unberührbarkeitstabu übertreten werde. »Hoffen Sie, Sire,« sagt er zu Ludwig, »man wird nicht wagen, Sie anzutasten.«91 Jahrzehnte später überkommen den deutschen Historiker Ludwig Stacke ähnliche Empfindungen, als er die Situation an der Guillotine beschreibt: »Als ihn [Ludwig] die Henker ergriffen, um ihm das Sünderkleid anzuziehen, die Haare abzuschneiden und die Hände auf den Rücken zu binden, stieß er sie anfangs zurück, fügte sich aber auf die Erinnerung, daß sich auch Christus willig habe binden lassen, und daß er dadurch dem Heilande ähnlicher werde.«92 Die aggressive Berührung wird also nur mittels einer Analogie, welche Ludwig indirekt die Funktion des von Jesus dargebrachten Erlösungsopfers zuschreibt, faßbar, d.h. durch die sozusagen vorgezogene Wiederbelebung des zu »ermordenden« Vater-Königs. Das Haar des Königs, jener geheiligte und tabuisierte Körperteil der Herrscher früherer Kulturen, erhält in diesem Zusammenhang eine besondere symbolische Bedeutung: Ludwig bittet darum, seine Haare selber schneiden zu dürfen, wie Furet und Richet bemerken, aber man verweigert es ihm und besteht auf den öffentlichen Vollzug dieses Aktes durch den Henker. Carlyle hebt gar hervor, daß Locken vom geschnittenen königlichen Haar nach der Enthauptung verkauft werden.93 Das Attribut der Macht, das dem Haar seit dem Samson-Mythos zugeschrieben wird, seine Symbolik als Bestandteil jugendlicher Kraft und seine allegorische Bedeutung als Auflehnungsemblem in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, aber auch die Assoziationen, die das Schneiden des Haars als Demütigungsakt in repressiven Situationen begleiten, bezeugen seine metaphorische Funktion als Ausdruck der Macht und der Heiligkeit in verschiedenen Zusammenhängen. Das öffentliche Schneiden der Haare des gestürzten Monarchen dient den Revolutionären demnach als eine quasi kultische Demonstration ihrer neuerdings erlangten Macht. Wenn sich das Unberührbarkeitstabu des Haars übertreten läßt, wird es nicht zu schwer sein, den nächsten Schritt zu vollziehen und das nunmehr entmachtete Haupt abzuköpfen. Der König selber ist sich offenbar der symbolischen Bedeutung der Situation wohl bewußt; noch in seinen letzten Augenblicken widersetzt er sich der Tabuübertretung. Edgeworth, Ludwigs Beichtpriester, berichtet, wie die Henkersknechte versuchen, den Monarchen zu fesseln. Er fragt sie, was sie vorhätten. Auf ihre Antwort hin, sie wollten seine Hände binden, reagiert er entrüstet: »Mich binden […]. Nein! Ich werde dies niemals zulassen: Tut, was ihr zu tun habt, aber ihr werdet mich niemals binden…«.94
Es stellt sich indes heraus, daß die Übertretung des Unberührbarkeitstabu auch die Kehrseite des von den Revolutionären verfolgten Zwecks zum Vorschein bringt. Das Blut des enthaupteten Herrschers erweckt das Entsetzen der um die Guillotine versammelten Massen. »Noch ist der Königsmythos nicht tot« deutet Göhring. »Dem Blut eines französischen Königs entströmt magische Kraft, denn er gilt als ein Gesalbter Gottes.«95 Der von Jacques Roux am Hinrichtungstag verfaßte Bericht vermerkt: »Sein Kopf fiel. Die Bürger tauchten ihre Piken und ihre Taschentücher in sein Blut.«96 Der Akt, der den Königsgedanken ausmerzen soll, erweckt spontan das Bedürfnis, sein Gedenken zu wahren; die kultische Tat zur Wahrung des Gedenkens symbolisiert widerum beide Aspekte der Ambivalenzempfindung: Einerseits drücken sich Bewunderung und Ehrfurcht durch die Erhöhung des königlichen Blutes zur Reliquie aus; andererseits exemplifiziert das Tauchen der Waffen in eben dieses Blut die gewalttätige Aggression.
Wir erinnern daran, daß dies auch die dem Stamm nach Beendigung der Totemmahlzeit zeremoniell auferlegten Reaktionen sind. Interessant ist demnach Stackes Assoziation bei der Beschreibung der Reaktion der Masse, als der Kopf des Königs durch den Henker hochgeschwungen wird: »Kannibalisches Gebrüll erscholl ringsrum und setzte sich weithin in die Stadt fort.«97 Göhring spricht von einer »Bewegung des Entsetzens«, die durch Tausende gegangen sei, Edgeworth erinnert sich an eine »ehrfurchtserregende Stille im ersten Moment«, und der Augenzeuge Philippe Pinel berichtet von einer »finsteren Bestürzung«, die sich plötzlich verwandelt habe; »Es lebe die Nation!« und »Es lebe die Republik!« klingt es nun von überall her, und ein Freuden- und Siegestaumel verbreitet sich, während »man im Reigen um das Schafott« tanzt.98 Dieser Übergang von der einen emotionalen Reaktion zur konträr entgegengesetzten erinnert aufs deutlichste an das stilisierte Ambivalenzverhalten im altertümlichen Totemkult. In der konkreten Situation ermöglicht er zweifelsohne die Entladung des psychologischen Drucks und der Spannung, welche über die Bevölkerung von Paris seit der Entscheidung über die Hinrichtung des Königs bis zu deren Vollzug lastet: »Ohne Leid und Tränen, aber doch mit instinktiver Angst und leicht unruhig erwartet, ersehnt man nur den Augenblick, wo es vorbei ist«, wie es Gascar formuliert.99 Die Revolutionäre, die die Liquidierung des Königs anstreben, fürchten seinen (amts)charismatischen Einfluß bis zum letzten Augenblick; als Ludwig den Versuch unternimmt, die um die Guillotine versammelten Zuschauer noch einmal anzusprechen, beginnen die Trommler auf Anweisung Santerres zu trommeln, und des Königs Stimme geht im ohrenbetäubenden Lärm unter.
Die Tat ist vollbracht, der König ist tot; ein Gefühl der Erleichterung bemächtigt sich der politischen Führer. Konservative Historiker, die sich bei der Verarbeitung des »Königsmordes« selber schwer tun, erfassen für gewöhnlich die psychologische Bedeutung dieser Erleichterung nicht. Der Umstand, daß am Abend nach dem »schrecklichen Morde« die Schauspielhäuser gedrängt voll waren, klingt bei Stacke zum Beispiel so, als habe man darin den schlagenden Beweis für die Empfindungslosigkeit und Grausamkeit der »Königsmörder« zu sehen. Carlyle, der sich auf den gleichen Tatbestand bezieht, scheint da etwas einsichtiger zu sein: »Abends in den Kaffeehäusern […] drückten die Patrioten einander noch herzlicher die Hand als sonst. Erst einige Tage nachher […] sah man ein, wie gewichtig die Sache war.«100 Gerade das Bedürfnis, zusammen zu sein, das Bedürfnis nach der Nähe der an der Tat Mitbeteiligten und nach der momentanen Bestärkung durch den noch mehr »als sonst« herzlichen Händedruck bezeugen das noch unklare Gefühl der »Brüdergemeinschaft«, daß sich etwas schicksalhaftes und bedrohliches zugetragen habe, etwas, das sich eben nicht anders als in der Gemeinschaft ertragen läßt. »Vereint wagten sie und brachten zustande, was dem Einzelnen unmöglich geblieben wäre«, bemerkt Freud in Beziehung auf den »Urvatermord«. Gleiches gilt für den 21. Januar 1793. Das Gemeinschaftsbedürfnis ist der Grund dafür, daß »in den Wintertagen, in denen sich die Hinrichtung des Königs vorbereitet, […] die politischen Aktivitäten aufgehoben, die Konflikte ausgestzt« scheinen; dieses Bedürfnis unterliegt auch der Wunschvorstellung des Freiwilligen Maurin in einem Brief aus der Armee eine Woche nach dem Ereignis: »Der Tyrann lebt nicht mehr, und die Bürger, die über sein Schicksal gespalten waren, sind alle einig […]«; Bouloiseau stellt also zurecht einen Zusammenhang zwischen Einigkeitsgefühl und Schuldbewußtsein her: »In diesem oder jenem Maß empfanden die Königsmörder Reue, ein Bedürfnis, sich im nachhinein zu rechtfertigen, und hatten das Gefühl, gegen göttliches Recht verstoßen zu haben. Ein Solidaritätsgefühl einigte sie nun.«101