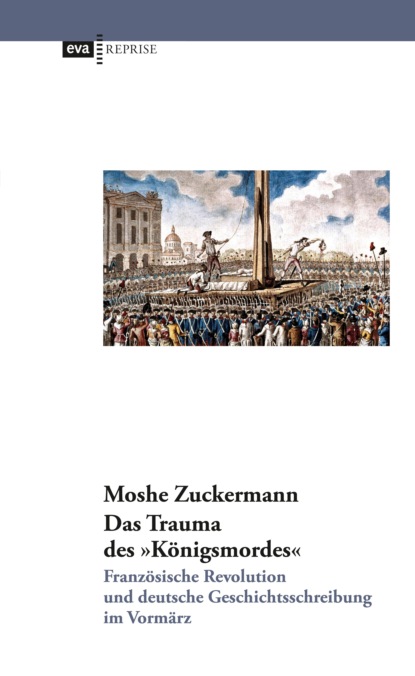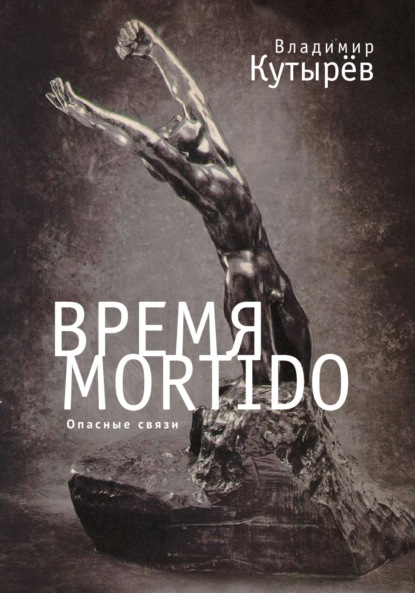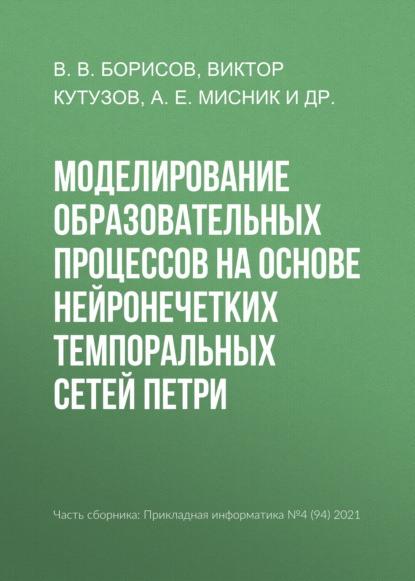- -
- 100%
- +
Daraus geht allerdings weder der genetische Ursprung dieser »Schranke« noch der Einfluß, den sie auf die Tathandlung ausübt, hervor. Horkheimer bemerkt zwar, die Theorie sei kein Rezept, und das Handeln enthalte »ein Moment, das in der kontemplativen Gestalt der Theorie nicht ganz aufgeht«; aber auch seine Feststellung, daß »zwischen Theorie und Praxis, zwischen Denken und Handeln, eine Art von Notwendigkeit bestehen« könne6, löst das Problem letztlich nicht, denn die »Notwendigkeit« kann ebenso eine unbewußte Handlung hervorbringen, wie sie andererseits einer bewußten Handlung unterlegt sein mag. Habermas hingegen hebt hervor: »[…] die Verhaltensreaktionen sind stets vermittelt durch die Interpretationen, unter denen die Handelnden aus ihrem Erwartungshorizont […] die ›beeinflußenden‹ Ereignisse auffassen.«7 Diese Behauptung ist für unsere Problemstellung von immenser Wichtigkeit, weil in ihr das a priori Verhältnismäßige an der Art, wie Menschen ihre Welt auffassen, und der sie zur Handlung bewegenden Kodes – zumindest indirekt – zum Ausdruck kommt. Der »Erwartungshorizont« und die Entscheidung, welche »die ›beeinflußenden‹ Ereignisse« seien, stimmen nicht unbedingt mit der der »objektiven Situation« angemessenen Rezeption überein, und dennoch kodifizieren sie die Einstellungen und Handlungsweisen des Menschen. In dieser Bedeutung hat man auch die »symbolische Sinnwelt« zu begreifen, die von Berger und Luckmann als »die Matrix aller gesellschaftlich objektivierten und subjektiv wirklichen Sinnhaftigkeit« definiert wird. »Die ganze Geschichte der Gesellschaft und das ganze Leben des Einzelnen sind Ereignisse innerhalb dieser Sinnwelt.«8
Selbstverständlich entstehen so unzählig viele Kode-Matrizes. Dieser Umstand ist sowohl unserer Beschränktheit in der ontologischen Erfassung der Realität als auch den diese Realität konstituierenden, letztlich vorgegebenen Antagonismen zuzuschreiben. Dasselbe läßt sich über die Kode-Matrizes der mannigfaltig möglichen Historiographien der Französischen Revolution sagen; Lévi-Strauss hat hierauf Bezug genommen:
»Sobald man sich vornimmt, die Geschichte der Französischen Revolution zu schreiben, weiß man (oder sollte wissen), daß sie nicht gleichzeitig und mit demselben Anspruch die des Jakobiners und die des Aristokraten sein kann. Der Hypothese zufolge sind ihre jeweiligen Totalisierungen (deren jede sich antisymmetrisch zur anderen verhält) gleicherweise wahr. Man muß also zwischen zwei Parteien wählen: entweder einer von beiden oder einer dritten (denn es gibt ihrer unendlich viele) den Vorrang geben und darauf verzichten, in der Geschichte eine Gesamttotalisierung partieller Totalisierungen zu suchen; oder allen eine gleiche Wirklichkeit zuerkennen: doch nur um zu entdecken, daß die Französische Revolution, so, wie man von ihr spricht, nicht existiert hat.«9
Dieses Problem ist letztlich unlösbar. Man kann sich lediglich einer von zwei Auffassungen anschließen: Eben der Ansicht von Lévi-Strauss, daß »der Historiker oder der Agent des historischen Werdens« die historische Tatsache »durch Abstraktion und gleichsam unter der Drohung eines unendlichen Regresses« konstituiere10, oder der kompromißhaften Entscheidung Alexander Demandts, das Problem als ein hermeneutisches und kein ontologisches zu begreifen, um somit wenigstens eine gewisse begriffliche Prägnanz zu erreichen: »Mit der Französischen Revolution wurde der Begriff […] zur Metapher aus der Geschichte, insofern beim Gebrauch des Begriffs ›Revolution‹ immer die Erinnerung an jene spezielle Revolution mitschwingt und erwarten läßt, daß jeder mit ›Revolution‹ bezeichnete Vorgang wesentliche Gemeinsamkeiten mit der Französischen Revolution besitzt, zumindest eine Dosis Gewaltsamkeit.«11
So besehen, wird die Französische Revolution zur »Erinnerung« oder Assoziation, die sich in der einen Matrix mit dem Schlüsselbegriff »Gewaltsamkeit«, in der anderen mit »Emanzipation« und in der von uns herausgearbeiteten eben mit der Verbindung »Gewalt und Emanzipation« kodifizieren läßt, wobei diese vom motivischen Kode »Auflehnung gegen die Autorität« abgeleitet wird.
In der Französischen Revolution findet die dialektische Verknüpfung von Auflehnung gegen die Autorität, Gewalt und Emanzipation ihren nahezu fortwährenden Ausdruck – von jenem ersten dramatischen Moment der berühmten Antwort Mirabeaus an den Zeremonienmeister an bis hin zum großen Wendepunkt der gesamten Revolution, dem Sturz der Monarchie und der Hinrichtung des Königs. Fügt man die Phase der jakobinischen Herrschaft hinzu, so kann man behaupten, jedes dieser Elemente habe sich in dieser Zeitspanne solchermaßen verdichtet, daß durch die Ereignisse selbst idealtypische Modelle der kodifizierten Rezeption entstanden seien: Die Auflehnung gegen die Autorität durch die zunehmende Schwächung der traditionellen Position des Königs, die Gewalt durch seine Hinrichtung und durch den Terror und die Emanzipation durch die Errichtung der Republik und die sich daraus ergebende Machtübernahme durch die Volksrepräsentation. Angesichts einer solchen mit sowohl positiven als auch negativen Gefühlen und Assoziationen beladenen Kode-Matrix, ist es unumgänglich, daß die Bewertung der Revolution stets mit einer gewissen Ambivalenz einhergeht, wie sie, beispielsweise, in den Worten Andre Maurois’ ihren Niederschlag gefunden hat: »Die Französische Revolution ist gleichzeitig ein weltgeschichtliches Abenteuer, ein erhabenes Heldenlied und der Anlaß zu blutigen und schmutzigen Szenen. Diese Verflechtung von Größe und Schrecken zu entwirren, ist fast unmöglich […]«.12 Wir werden die psychologische Grundlage dieser Kode-Matrix noch eingehend zu erörtern haben; es sei indes schon an dieser Stelle hervorgehoben, daß die »Ambivalenz« zwar als eine »Reaktion« auf die übrigen (vermeintlich antagonistischen) Kodes erscheinen mag, in ihrer Bedeutung als psychologischem Faktor sind jedoch die Prädispositionen ihres Bestehens und ihrer Wirkung als vorgegeben anzusehen. Wir begreifen sie demnach als integralen, sozusagen »gleichwertigen« Bestandteil der Kode-Matrix der Französischen Revolution.
Die entscheidende Bedeutung der Hinrichtung des Königs findet ihren historiographischen Ausdruck sowohl in der Rezeption ihrer unmittelbaren Ergebnisse als auch in der ihrer langfristigen Auswirkungen. »Ein König, der auf so gewaltsame Weise stirbt, wirkt, wie es nicht anders sein kann, mächtig auf die Einbildung ein. Und doch ist es im Grunde nicht der König, der stirbt, sondern der Mensch!«13 sagt Carlyle im Jahre 1837. Demgegenüber meint Pierre Gascar: »Den König töten: Das ist für die meisten Franzosen dieser Zeit weit schlimmer als der Mord an einem Menschen. Es bedeutet, das Bild zu zerstören, das sich auf den kleinen Geldstücken befindet, die man täglich in der Tasche mit sich herumträgt; es bedeutet, eine Institution zu vernichten, die dem nationalen Leben so integriert ist wie das Gold dem Taler«.14 Eine solche Trennung zwischen dem menschlichen und dem politisch-institutionellen Aspekt scheint indes rein technischer Natur zu sein. Gaxotte z.B. gibt zwar vor, sich auf die »politischen Beweggründe« für den »Leidensweg« des Königs zu konzentrieren, aber er tut dies doch nicht ohne den Leser vorher ausdrücklich wissen zu lassen, daß der Prozeß gegen den König »eine der ergreifendsten Geschichtstragödien« darstelle: »Eines der schönsten und menschlichsten Bücher, die je geschrieben wurden, könnte aus der schlichten Schilderung der Gefangenschaft und der letzten Augenblicke Ludwigs XVI. zusammengestellt werden.«15
Der »tiefe Eindruck«, den der Tod des Königs hinterließ, entwickelte sich sehr bald zu einem Bürgerkrieg im Innern Frankreichs und führte zur Erklärung eines »Vernichtungskrieges« des übrigen Europas gegen die »Königsmörder«.16 Jedoch, so Mathiez, der Tod des Monarchen »traf das traditionelle und mystische Ansehen des Königtums ins Herz. Mochten die Bourbonen wiederkommen, nie wieder werden sie im Herzen der Völker von der Aureole des Gottesgnadentums umstrahlt sein«17; der Königsgedanke erschien seitdem »fast nur noch als Anhängsel aristokratischer oder klerikaler Strömungen oder als Deckmantel bourgeoiser Klassenbestrebungen«18, wie Griewank bemerkt. Nach Walter Grabs Auffassung kennzeichnet der Tod des Königs den endgültigen Bruch zwischen dem der konstitutionellen Monarchie anhängenden Liberalismus und der nach der Republik strebenden Demokratie; von gesamtfranzösischer Warte aus gesehen, bedeutet er den Riß der »Bande des Landes mit seiner Vergangenheit und mit Europa«, ohne einen Weg zurück.19 Eine solche dramatische Interpretation ist es wohl auch, die Alex Karmel gar folgern läßt, die Revolution habe mit dem Tod des Königs »begonnen«, da mit ihm das Legitimitätsprinzip auf politischer Ebene für immer eingestürzt sei: »Eine tausendjährige Geschichte wurde ignoriert.«20 Historiker, die die Revolution als sozialen Prozeß begreifen, widersprechen gemeinhin dieser Auslegung. Schon Mitte des letzten Jahrhunderts erklärte Lorenz von Stein, nach dem Sturz der Monarchie hätten der Prozeß und die Hinrichtung des Königs keinerlei Einfluß auf den weiteren Verlauf der Revolution gehabt, und Karmel selbst weist darauf hin, daß in der herkömmlichen marxistischen Interpretation der Umwälzung der König kaum erwähnt werde: »Die Monarchie wird lediglich als ein Bestandteil des feudalen Systems und der König als Oberhaupt der Aristokratie angesehen.«21 Karmels Behauptung ist zweifelsohne übertrieben; wie dem aber auch sei, es genügt, an die verärgerte Kritk Kropotkins an den vielen »pathetischen Worten« und »Tränen« der Historiker, wenn sie vom Prozeß des Königs berichteten, zu erinnern, um einzusehen, daß es sich hierbei um ein sowohl für die Revolution als auch für deren historiographische Rezeption höchst bedeutsames Ereignis handelt.22 In dieser Hinsicht bleibt es sich gleich, ob Louis Blanc zur Schlußfolgerung gelangt, die Hinrichtung des Monarchen sei »ein gewaltiger Mißgriff, wenn auch kein unberechtigter« gewesen, denn »das Ziel der Revolutionäre war, die monarchische Idee zu töten, das Schafott aber hat sie erhöht und veredelt«23, oder ob sie Griewank lobt, weil sie »den Schimmer der Unverletzlichkeit, […] der bis dahin das Königtum immernoch für das einfachste Empfinden umgeben hatte«, zum Verschwinden gebracht habe.24 Beide Bezugnahmen enthalten die für unsere These relevanten Elemente: den Kode der Auflehnung gegen die Autorität (die Tötung der monarchischen Idee), den Kode der Gewalt (die Hinrichtung selbst), den Kode der Emanzipation (Liquidierung des Schimmers der Unverletzlichkeit) und den Kode der Ambivalenz, der sich in den Folgen des Ereignisses manifestiert, zumindest nach der Interpretation Louis Blancs.
Wie schon gesagt, ist aus diesen Kodes das fundamentale Netz der Matrix gewoben, durch welche die Revolution rezipiert und interpretiert wird. Wir vertreten daher die Ansicht, daß die nun folgenden Worte Aulards, gesprochen am 12. März 1886 anläßlich der Einweihungsfeier des Lehrstuhls für die Geschichte der Französischen Revolution an der Sorbonne, eine mehr als nur politische Bedeutung aufweisen. Mit Bezug auf auf die Wichtigkeit des Revolutionsereignisses für das französische Volk erklärt er:
»Unser ganzer Charakter mit seinen guten und schlechten Eigenschaften ist dabei in Erscheinung getreten, und für den Zurückblickenden erscheint die Französische Revolution wie ein Spiegel, in dem Frankreich sich wiedererkennt, sich seiner selbst bewußt wird, sich seine Gewissensbisse, seine Freuden, seine Befürchtungen und seine Hoffnungen erklärt. Die Revolution kennen heißt für dieses Volk: sich selbst in der Tiefe seiner Instinkte kennen, sich seiner Stärke und seiner Schwäche bewußt werden und entdecken, wessen es in einer Stunde höchsten Lebenskampfes fähig ist.«25
Gerade die zweiwertige Tendenz in den Worten Aulards und der ihnen anhaftende verallgemeinernde Charakter – dies zu einer Zeit, da die Französische Revolution sozusagen offiziell zum bestimmenden Maßstab für das französische Selbstbild aufgewertet und zum unteilbaren »Block« deklariert wird – lassen die zunächst unzusammenhängend erscheinenden Fragen aufkommen: Welchen Ursprungs ist diese durch die Revolutions-Kodes hervorgerufene Zweideutigkeit? Was ist so sehr revolutionär an der Zerstörung der Gottesgnadentum-Aureole und an der Übertretung des »Unverletzlichkeits«gebots? Was bedeutet der Bürgerkrieg nach der Hinrichtung des Königs? Was steckt hinter der auf das Kollektivsubjekt »Frankreich« bezogenen Zusammenfügung von »Freuden«, »Befürchtungen«, »Gewissensbisse« und »Hoffnungen« in den Worten Aulards, und in welcher Verbindung steht diese Zusammenfügung mit den ebenfalls erwähnten »Instinkten« des besagten Subjekts?
Es gibt scheinbar einfache Antworten hierauf. Wie wir im komprimierten historiographischen Abriß des ersten Kapitels angedeutet haben, lassen sie sich ohne weiteres in den antagonistischen Klasseninteressen oder in den politisch-ideologischen Kämpfen, welche (den verschiedenen Interpretationsschulen zufolge) den gesamten Revolutionsverlauf kennzeichneten, verankern. Einer verwandten Denkweise gemäß, nimmt es auch kein Wunder, wenn ein blutiges Ereignis, wie es die Französische Revolution nun mal war, die Moral alarmiert und das Gewissen peinigt; andererseits überrascht es nicht, wenn es Freuden und Hoffnungen erweckt – haftete ihm doch eine emanzipatorische Verheißung an. Das Revolutionäre und das Neue am Ereignis ist also in der Auflehnung gegen die historischen Institutionen und im Schlachtruf gegen menschliche Konventionen zu sehen. Alle diese Erklärungen sind richtig und bewahren auch weiterhin ihre Gültigkeit; unserer Ansicht nach erfassen sie jedoch nicht mit erforderlicher Tiefe die Bedeutung der dem Tode des Königs einwohnenden traumatischen Dimension und die aus ihr resultierende Idiosynkrasie in allen Phasen der nunmehr fast 200 Jahre währenden Rezeptionsgeschichte der Revolution. »In seiner Monumentalität« behauptet Hermann Bortfeldt, »war dieser Tod ein Faktor der Beunruhigung für alle. Hundert Zusammenstöße innerhalb und außerhalb des Parlaments zwischen Gironde und Jakobinern, bei denen es immer um mehr Freiheit oder mehr Gleichheit ging, zeigten in ihrer Form, die schärfer und schließlich tödlich wurde, die Sensibilisierung der Nation im Punkte Königsmord, gesehen als Beseitigung eines Phallussymbols oder als Vatermord.«26
Die Feststellung Bortfeldts ist, unserer Auffassung nach, von gewichtigster Bedeutung; indem er den »Königsmord« einem »Vatermord« gleichsetzt, verleiht er dem historischen Ereignis der Tötung des Königs gewissermaßen einen »ahistorischen« Rang und somit eine für die Klärung des mentalen Aspekts der Hinrichtung Ludwigs XVI. sehr nützliche archetypische Dimension. Seine Analogie lehnt sich an einen der Schlüsselbegriffe der Freudschen psychoanalytischen Theorie an. Auch uns dienen – wie oben angezeigt – Elemente dieser Lehre als theoretische Stütze bei der Herausarbeitung der die Kode-Matrix der Französischen Revolution konstituierenden psychischen Grundlage. Es scheint daher angebracht, die in unserer These zur Anwendung kommenden Grundrisse der Lehre in Kürze darzulegen.
Auf der Basis der Darwinschen Theorie der »Urhorde« geht Freud von der Annahme einer prähistorischen Existenz solch einer Horde aus, in der ein »gewalttätiger, eifersüchtiger Vater, der alle Weibchen für sich behält und die heranwachsenden Söhne vertreibt«, herrscht. Er postuliert: »Eines Tages taten sich die ausgetriebenen Brüder zusammen, erschlugen und verzehrten den Vater und machten so der Vaterhorde ein Ende.« Er fügt noch betonend hinzu: »Vereint wagten sie und brachten zustande, was dem Einzelnen unmöglich geblieben wäre.«27 Dieses »Ereignis« nun gebraucht Freud als Grundhypothese, von der sich sowohl seine phylogenetische Kulturtheorie der Menschheit als auch seine ontogenetische Persönlichkeitslehre ableiten.28 Beide Sphären sind nicht auseinanderzuhalten, denn laut Freud »handelt es sich hier nicht um ein einmaliges Ereignis. Es wiederholt sich im Verlauf der Geschichte der Menschheit und der Geschichte jedes Einzelnen immer wieder.«29 Wir verfolgen zunächst die phylogenetische These, welche da besagt, der Urmord habe seinen Ursprung in den ambivalenten Gefühlen der Brüder dem Vater gegenüber gehabt: Sie haßten den Vater, weil sie durch sein Monopol zum Verzicht auf Macht und Lust gezwungen wurden, aber natürlicherweise liebten und verehrten sie ihn auch, eben als ihren biologischen Vater. Daher kam in ihnen, nach seiner Beseitigung und nachdem sie ihre Haßgefühle befriedigt hatten, eine Empfindung der Reue und ein Gefühl der Schuld auf. Dieses Gefühl ist es nun, das die Grundlage für alle folgenden Entwicklungen bildet. Der Einfluß des toten Vaters wurde gar größer als der des lebendigen; die Sehnsucht nach ihm brachte den Vaterersatz in der Gestalt des Totemtieres hervor, und nachdem er so wieder auferstanden war, schufen die Brüder »aus dem Schuldbewußtsein des Sohnes« zwei Tabus, mit denen sie ihr Verbrechen sühnten: Das Tabu, das Totemtier zu töten, einerseits und das Tabu, sich mit den nun freigewordenen Weibchen der Horde zu paaren, andererseits. Im zweiten Verbot sieht Freud den Ursprung des sogenannten Inzest-Tabus. Wichtiger für unsere Darlegung ist jedoch die dem ersten Tabu beigemessene Bedeutung, wonach im Totemismus der erste Versuch vorliege, eine Religion zu schaffen:
»Die Totemreligion war aus dem Schuldbewußtsein der Söhne hervorgegangen als Versuch, dies Gefühl zu beschwichtigen und den beleidigten Vater durch den nachträglichen Gehorsam zu versöhnen. Alle späteren Religionen erweisen sich als Lösungsversuche desselben Problems, variabel je nach dem kulturellen Zustand, in dem sie unternommen werden, und nach den Wegen, die sie einschlagen, aber es sind alle gleichzielende Reaktionen auf dieselbe große Begebenheit, mit der die Kultur begonnen hat und die seitdem die Menschheit nicht zur Ruhe kommen läßt.«30
Freud beruft sich hierbei auf Beschreibungen von Totemriten primitiver Stämme in zeitgenössischen anthropologischen Veröffentlichungen. Von besonderer Bedeutung erscheint ihm der Kult der Totemmahlzeit, in dem das Totemtier als Opfer geschlachtet und gemeinsam verzehrt wird. Die kollektive Aktion sei es, welche die Tabuübertretung einer Tötung des heiligen Totemtieres ermögliche, ihre Rechtfertigung müsse darin gesehen werden, daß »nur auf diesem Wege das heilige Band hergestellt werden kann, welches dieTeilnehmer untereinander und mit ihrem Gotte einigt.«31 Die Sitte gebietet eine der Opferhandlung unmittelbar folgende Trauerreaktion der Teilnehmer; der ganze Stamm beweint das Opfer, um sich so der Schuld der durch den Tötungsakt vollzogenen Tabuübertretung zu entledigen. Bald danach jedoch bricht der Stamm in eine ekstatische, alle Triebe entfesselnde Freude aus, mit der das Vergehen gefeiert wird. In dieser Weise wird mit der Opferung des Totemtieres der Vatermord rituell wiederholt und die mit ihm einhergehenden Ambivalenzgefühle zeremoniell formalisiert.
Diese primitive Form der Religion, die (wie gesagt) als kulturelle Reproduktion der prähistorischen Begebenheit begriffen wird, bildet für Freud die Ausgangsbasis einer Weiterverfolgung der historischen Evolution der religiösen Institution bis hin zu ihrer entwickeltsten Form, der monotheistischen Religion.32 Jeder Entwicklungsphase liegt jenes Urmuster in verschiedenen Varianten zugrunde, in jeder wird die »Vatersehnsucht« deutlich, so daß die Schlußfolgerung unumgänglich scheint, »daß Gott im Grunde nichts anderes ist als ein erhöhter Vater.«33 Im entscheidenden Moment, als sich das Christentum von diesem Urmuster loszulösen versucht, reproduziert es paradoxerweise die verbrecherische Tat: Jesus opfert sein Leben, um seine Brüder von der Erbsünde zu befreien. Mit diesem Akt wird dem Vater vermeintlich die höchste Sühne geboten.
»Aber nun fordert das psychologische Verhängnis der Ambivalenz seine Rechte. Mit der gleichen Tat, welche dem Vater die größtmögliche Sühne bietet, erreicht auch der Sohn das Ziel seiner Wünsche gegen den Vater. Er wird selbst zum Gott neben, eigetlich an Stelle des Vaters. Die Sohnesreligion löst die Vaterreligion ab. Zum Zeichen dieser Ersetzung wird die alte Totemmahlzeit als Kommunion wiederbelebt, in welcher nun die Brüderschar vom Fleisch und Blut des Sohnes, nicht mehr des Vaters, genießt, sich durch diesen Genuß heiligt und mit ihm identifiziert. […] Die christliche Kommunion ist aber im Grunde eine neuerliche Beseitigung des Vaters, eine Wiederholung der zu sühnenden Tat.«34
Diese »anthropologische«35 Theorie beschränkt sich nicht auf die historische Rekonstruktion einer hypothetischen Entwicklung der religösen Institution. Dasselbe Gefühl der Ambivalenz, aus dem das Schuldbewußtsein hervorgeht, erweist sich auch als relevant für die Erklärung kollektiver Gefühle von Untergebenen in allen von der Zivilisation hervorgebrachten hierarchischen Situationen, Situationen der »institutionalisierten sozialen und politischen Herrschaft«, wie sie Herbert Marcuse nennt.36 In dieser Hinsicht gibt es keinen wesentlichen Unterschied zwischen den kollektiven Psychologien der in Kirche und Heer organisierten »künstlichen Massen«.37 Am deutlichsten drückt sich dies aber in der Beziehung der Untertanen zum König aus, wobei die Tabus eine wiederum tragende Rolle spielen.
Zwei sich ergänzende Grundsätze bestimmen das Verhalten »primitiver Völker« ihren Häuptlingen, Königen und Priestern gegenüber: »Man muß sich vor ihnen hüten, und man muß sie behüten. Beides geschieht vermittels einer Unzahl von Tabuvorschriften.«38 So kann z.B. die Berührung mit dem König einerseits eine gefährliche, ja tödliche, andererseits aber eine beschützende und sogar heilende Bedeutung haben. Solche Vorstellungen und die Notwendigkeit, den König vor den ihn bedrohenden Gefahren zu beschützen, haben eine zunehmende Isolation des Herrschers gezeitigt, und je sakraler die ihm beigemessenen Eigenschaften waren, desto strenger wurden die Isolationsbräuche gehandhabt. So wurden alle Körperteile des Mikados von Japan als dermaßen heilig aufgefaßt, daß man es verhinderte, sie der frischen Luft und den Sonnenstrahlen auszusetzen; es war verboten, sein Kopfhaar, seinen Bart und seine Fingernägel zu schneiden. Ein Nachhall dieses Tabus läßt sich noch in der Beziehung der Römer zum Flamen Dialis, dem Hohepriester Jupiters, finden; nur ein freier Mann durfte sein Haar schneiden, und die geschnittenen Haare sowie seine Nägelabfälle mußten unter einem glückbringenden Baum vergraben werden. Freud erkennt auch in diesem Zusammenhang das gespaltene Verhältnis zum physischen Kontakt mit dem Herrscher: Die vom König ausgehende und in guter Absicht initiierte Körperberührung gilt als schützend und heilend, wohingegen die vom gemeinen Mann am König oder Königlichen verübte Berührung als gefährlich angesehen wird,«wahrscheinlich weil sie an aggressive Tendenzen mahnen kann«. Hieraus ergibt sich die Schlußfolgerung, »daß der Verehrung, ja Vergötterung [der Herrscher] im Unbewußten eine intensive feindselige Strömung entgegensteht, daß also hier […] die Situation der ambivalenten Gefühlseinstellung verwirklicht ist.«39
Es läßt sich behaupten, daß Freuds Lehre von der Kollektivpsychologie in der Konzeption einer sich zwischen zwei konträr entgegengesetzten Polen bewegenden Gefühlsregung fußt. Der Kampf um die Beilegung dieses Widerspruchs ist es, der die Entwicklung psychischer Mechanismen hervorbringt, in denen die Entstehung zivilisatorischer Institutionen wurzelt, die aber ihrerseits auch wieder ein beredtes Zeugnis von der Fortwirkung der dialektischen Dynamik zwischen den beiden Polen abgeben. In einem solchen umfassenden Sinne gibt es denn auch keinen eigentlichen kollektiv-psychischen Unterschied zwischen den archetypischen Gestalten des Vaters, des Königs und des Gottes. Dieses gesamte theoretische Gebilde würde jedoch ein, wenn auch brillanter, intellektueller Jongleurakt geblieben sein, wäre es nicht mit der ontogenetischen Lehre Freuds verknüpft. Im Grunde bildete sie den Ausgangspunkt für das bisher Dargestellte; es ist demnach kein Zufall, daß Freud die meisten seiner metapsychologischen Schriften in seinen letzten Lebensjahren verfaßte.
Die Mittelachse der psychoanalytischen Theorie ist in der ödipalen Situation als einem ersten »Höhepunkt« in den frühen Entwicklungsphasen des (männlichen) Kindes, wo es seine Mutter begehrt und seinen Vater als Gegner ansieht, verkörpert. Die Kastrationsdrohung zwingt das Kind jedoch, seine Einstellung aufzugeben; es verläßt den ödipalen Komplex, verdrängt ihn und »im normalsten Fall« zerstört ihn gar gründlich, um »als sein Erbe ein strenges Über-Ich« einzusetzen.40 Diese schicksalsträchtige Entwicklung hat zwei zentrale Aspekte: Einerseits stellt sich in ihr der Übergang vom Lust- zum Realitätsprinzip dar; andererseits erwächst aus diesem Übergang selbst eine zusätzliche Schicht im System der menschlichen Psyche. Dieses System läßt sich sodann in folgender komprimierten Form beschreiben: Es besteht aus einem primitiven Es, aus dem sich das Ich abteilt. Jener Bereich im Es, »der mit den Normen des Ichs unvereinbar ist«, bildet den verdrängten Teil der Persönlichkeitsstruktur, wohingegen sich ein anderer Teil des Ichs zum gesonderten Über-Ich entwickelt41, dem die Funktion des Gewissens beigegeben ist, also die, welche »die Handlungen und Absichten des Ichs zu überwachen und zu beurteilen hat,« und somit »eine zensorische Tätigkeit ausübt«.42 Mit anderen Worten: Wenn sich das Über-Ich als Vertreter der moralischen Forderungen definieren läßt, so vertritt das Ich »Vernunft und Besonnenheit«, das Es hingegen »die ungezähmten Leidenschaften«.43