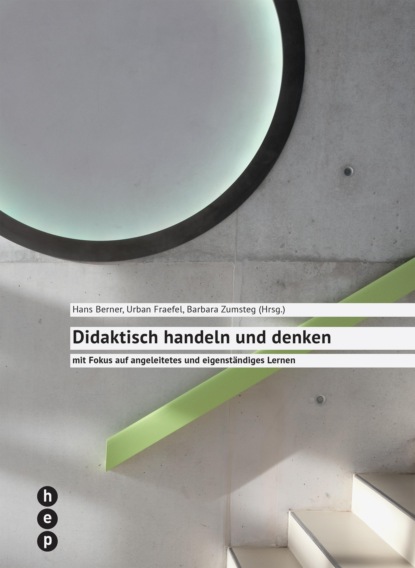- -
- 100%
- +
Über pädagogisches Handeln klug nachdenken, um klug handeln zu können
Reflexion meint die Rekonstruktion von Erfahrung. Reflexion ist eine Form von Lernen aus Erfahrung. Sie bedeutet konstruktive Verarbeitung von Erfahrungen. Vorbereitung auf Reflexion ist Vorbereitung auf optimale Auswertung der konkreten Erfahrungen, die man als Lehrerin oder Lehrer macht. Die Professionalität der pädagogischen Berufe zeigt sich nicht an der Form ihres Wissens, sondern im Umgang mit ihrem Wissen – und dieser Umgang ist reflexiv. Walter Herzog, emeritierter Professor für Pädagogische Psychologie in Bern, sieht die Aufgabe einer posttechnokratischen Lehrerbildung nicht im Einschleifen von Fertigkeiten und Gewohnheiten oder in der Indoktrination stereotyper Verhaltensweisen, sondern in der Hilfe, über pädagogisches Handeln klug nachzudenken und klug handeln zu können (Herzog 1995; vgl. hierzu auch die Materialien zu diesem Kapitel unter http://mehr.hep-verlag.ch/didaktisch-handeln-und-denken und den Anhang).
Literatur
Bandura, A. (1976). Lernen am Modell: Ansätze zu einer sozial-kognitiven Lerntheorie. Stuttgart: Klett.
Bessoth, R. & Weibel, W. (2000). Unterrichtsqualität an Schweizer Schulen. Zug: Klett und Balmer.
Combe, A. & Kolbe, F.-U. (2004). Lehrerprofessionalität: Wissen, Können, Handeln. In W. Helsper & J. Böhme (Hrsg.), Handbuch der Schulforschung (S. 833–851). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
Felten, R. von (2011). Lehrerinnen und Lehrer zwischen Routine und Reflexion. In H. Berner & R. lsler (Hrsg.), Lehrer-Identität – Lehrer-Rolle – Lehrer-Handeln. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.
Ditton, H. (2002). Lehrkräfte und Unterricht aus Schülersicht. Ergebnisse einer Untersuchung im Fach Mathematik. Zeitschrift für Pädagogik, 48 (2), S. 262–286.
Gudjons, H. (2007). Beruf: Lehrerin: Wandlungen – Widerspüche – Wunschbilder. Pädagogik, 59 (9), S. 6–10.
Helmke, A. (2009). Unterrichtsqualität und Lehrerprofessionalität. Seelze: Kallmeyer.
Herzog, W. (1995). Reflexive Praktika in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung. Beiträge zur Lehrerbildung, 13 (3), S. 253–273.
Langmaack, B. & Braune-Krickau, M. (2010). Wie die Gruppe laufen lernt. Anregungen zum Planen und Leiten von Gruppen (8., vollst. überarb. Auflage). Weinheim: Beltz.
Luft, J. (1989). Einführung in die Gruppendynamik. Frankfurt a. M.: Fischer Taschenbuch Verlag.
Maturana, H. R. & Varela, F. J. (1987). Der Baum der Erkenntnis. Die biologischen Wurzeln des menschlichen Erkennens. Bern: Scherz.
Schön, D. A. (1983). The Reflective Practitioner. How Professionals Think in Action. New York. Basic Books.
Schön, D. A. (1987). Educating the Reflective Practitioner. San Francisco: Jossey-Bass.
Schulz von Thun, F. (2001). Miteinander reden. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.
Texte
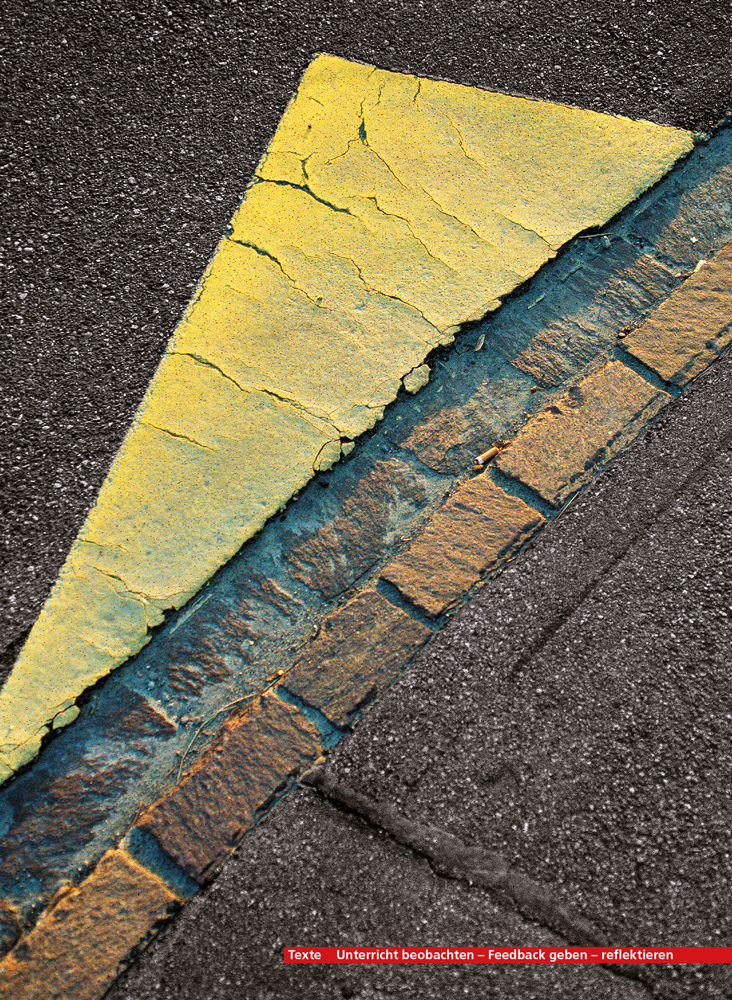
1 «Glauben wir, was wir sehen, oder sehen wir, was wir glauben?»
1 «Glauben wir, was wir sehen, oder sehen wir, was wir glauben?»
Im folgenden Text wird der für die Unterrichtsbeobachtung wichtige Prozess der selektiven Wahrnehmung beschrieben, und es wird dargelegt, wie jeder Mensch seine Realität konstruiert.
‹ Wenn zwei Parteien z. B. in einem Konfliktfall den gleichen Sachverhalt schildern, dann scheinen diese Schilderungen manchmal «Welten» auseinanderzuliegen. Wahrnehmung ist offensichtlich mehr als nur ein «objektives» Registrieren und Verarbeiten dessen, was um uns herum geschieht. Es ist ein Vorgang im Menschen, bei dem manche der angebotenen Daten und Fakten ausgeblendet werden und anderes hinzugefügt wird, was wir schon von früher her in uns gespeichert haben.
Damit ist angedeutet, dass sich jeder Mensch seine eigene «Realität» konstruiert, sich sein eigenes Bild vom «realen» Geschehen schafft. Man nennt diesen Vorgang «selektive Wahrnehmung»: Wir können ein Geschehen in uns und um uns herum immer nur durch unsere Filter hindurch wahrnehmen, die ähnlich wie beim Fotografieren Bildteile ausblenden, erweitern, verkleinern und farblich verändern.
Selektive Wahrnehmung ist einerseits wichtig und notwendig für den Menschen. Angesichts der Unzahl an Informationen um uns herum und angesichts der Komplexität der Umwelt ist Auswahl notwendig, um handlungsfähig zu bleiben. Selektive Wahrnehmung reduziert die Komplexität und gibt uns ein Gefühl von Sicherheit, «richtig» zu handeln. Ohne die Fähigkeit zur selektiven Wahrnehmung würden wir in Informationen ertrinken.
Andererseits bedeutet die Tatsache der selektiven Wahrnehmung, dass sich jeder der begrenzten Gültigkeit seines Bildes von der Realität bewusst sein muss. Niemand sieht die Wirklichkeit objektiv. Er muss sich mit den Bildern anderer auseinandersetzen, wenn er mit diesen zu einem gemeinsamen Handeln kommen will. Er muss sich bewusst sein, dass die andere Sichtweise in der Regel auch Wahrheiten beinhaltet. Ohne Bereitschaft zu diesem Sich-infrage-stellen-Lassen und ohne Toleranz führt selektive Wahrnehmung zum Dogmatismus und zur Borniertheit.
Der Mensch kommt zu seinem Bild von der Realität, indem er Information aufnimmt, auswählt und interpretiert. Auf diese drei Aspekte wollen wir im Folgenden etwas näher eingehen. Dabei meinen wir mit Informationen alles, was der Mensch verbal oder nonverbal über seine Sinnesorgane empfangen kann.
Wahrnehmung ist, wie gesagt, mehr als nur das quasi fotografische Registrieren. Das ist nur der erste Teil davon, wobei wir schon bei dieser Analogie im Auge behalten sollten, dass auch ein Kamerafilm nur das deutlich aufzeichnen kann, was u. a. in den Grenzen des Bildausschnittes, der Qualität des Objektivs, der Verschlusszeit der Kamera, der Körnung und Empfindlichkeit des Films und in der ruhigen Hand des Bedieners liegt.
Die Analogie zur menschlichen Aufnahmefähigkeit liegt auf der Hand: Der Qualität des Objektivs könnten Beobachtungsfähigkeit, körperliche und geistige Fähigkeiten entsprechen. Die Lichtwellen repräsentieren die Sprache, in der uns eine Information angeboten wird und deren Vokabeln und Symbole wir kennen müssen. Die ruhige Hand des Kameramannes symbolisiert die Bedeutung der eigenen Ruhe und psychischen Befindlichkeit für unsere Fähigkeit, Information aufzunehmen. Was übersehen wir nicht alles in hektischen oder bedrohlichen Situationen?
Unsere bewusste Wahrnehmung bezieht jedoch selbst bei optimalen Aufnahmebedingungen nur einen Bruchteil der angebotenen Informationen mit ein. «Zum einen Ohr rein, zum anderen raus» ist die volkstümliche Umschreibung dafür. Innere Filter verursachen, dass die meisten von außen angebotenen Informationen die Stufe der bewussten Wahrnehmung nicht erreichen.
Diese WahrnehmungsfiIter bestehen zum einen in den konkreten körperlichen und geistigen (Un-)Fähigkeiten, wie sie uns angeboren oder angelernt wurden. Wir können nur bestimmte Frequenzen sehen oder hören. Wir können uns nur in bestimmten Sprachen verständigen. Wir können nur eine bestimmte Zahl von Informationen pro Zeiteinheit aufnehmen. Wir nehmen Dinge rascher wahr, die im Schwerpunkt unserer Aktivitäten liegen. Hier sehen wir mit dem geschulten Blick und besonders wacher Aufmerksamkeit Dinge, die anderen entgehen.
Eine andere Gruppe von wirksamen Filtern bilden unsere Werte, Normen, Sitten, die wir im Laufe unseres Lebens gelernt und akzeptiert haben. Man hat gelernt, was «einen angeht» und wo man seine Nase reinsteckt und wo nicht. Man hat seine Regeln für gut und schlecht, richtig und falsch: Vieles davon ist so verinnerlicht, dass wir kaum mehr bemerken, wie stark es unsere Wahrnehmung beeinflusst.
Werte, Normen und Sitten sind im Menschen stark emotional geerdet. Sie sprechen Gefühle an und damit eine dritte und gewichtige Gruppe von Wahrnehmungsfiltern: Gefühle wie Angst und Freude, Sympathie und Antipathie, Mut und Verzweiflung, Liebe oder Hass bilden eine wirksame Brille mit einer eigenen Optik und Farbgebung (von Rosarot bis Tiefschwarz …).
Wenn man jemanden mag, dann sieht man sein Tun in einem positiven Licht oder findet jedenfalls rascher Gründe dafür, warum das alles nicht so tragisch sei. Freude über einen Auftrag lässt einen leicht Probleme ungünstiger Vertragsbedingungen «übersehen». Angst kann wach machen oder starr. Häufig führt sie zur Verdrängung, zum Wegschieben oder Verniedlichen der angstauslösenden Information.
Das, was diese Wahrnehmungshürden übersprungen hat, wird weiter verändert: Es wird interpretiert. «Ich weiß nicht, was soll es bedeuten …»: Je nach Bedeutung, die ich einer Information gebe, wird meine Handlung anders aussehen.
Zunächst versuchen wir, Informationen in die uns vertrauten Muster (Erfahrungen, Wertvorstellungen, Regeln und Theorien) einzuordnen. Es wird gewissermaßen nachgeschaut, ob die Information in ein bekanntes Raster passt. Häufig wird sie so ergänzt oder so beschnitten, dass sie «passend» wird. Selbst Bruchstücke einer Beschreibung werden rasch zu einem Ganzen aufgebaut. Jemand mit schwarzen Haaren und Schnurrbart ist – natürlich ein Südländer. Wie schnell ist jemand aufgrund der ersten Eindrücke eingeordnet und wird dann relativ lange darin festgehalten, auch wenn er sich in der Zwischenzeit geändert hat. Erst wenn offensichtlich die Information von außen nicht mehr mit diesen Mustern der Erfahrung in Übereinstimmung zu bringen ist, beginnt ein – mitunter langer – Lernprozess, um neue Erklärungen und neue Handlungsmuster zu entwickeln.
Unser Vorrat an Mustern hilft uns, Informationen schnell inhaltliche und gefühlsbezogene Bedeutung und Priorität zu geben. Die Muster helfen uns, rasch zu erkennen, worum es sich handeln könnte, lang bevor wir alle Informationen haben. Das ist eine Überlebenschance (rasches, entschlossenes Handeln) und eine Gefahr (Fehlreaktion, unangemessene Fortschreibung überholter Erfahrungen) zugleich.
Die inneren Muster verbinden zudem Information mit Empfindungen: Etwas wird als schön, gefährlich, gut, hässlich etc. empfunden. Diese Empfindungen haben viel mit unserer Lebensgeschichte zu tun. Sie verbinden die aktuelle Information mit unseren früheren Erfahrungen, Vorstellungen und Urteilen und verändern sie damit. Es erinnert uns (vielleicht sogar unbewusst) jemand an eine Person, die wir von früher her kennen, und schon übertragen wir ähnliche Gefühle und Einschätzungen auf die neue Person.
Schließlich werden den Informationen Prioritäten verliehen: Etwas wird als wichtig oder unwichtig, sinnvoll oder unsinnig eingeordnet. Auch hier werden Werte und Normen eine wichtige Rolle spielen. Prioritäten sind jedoch auch stark von unseren eigenen Interessen und Bedürfnissen geprägt, die wir in Bezug auf eine Situation haben.
In diesem Sinne ist jeder eingebunden in Gemeinschaften, in Rollen, in Beziehungsgeflechte, aus denen heraus ein gewisser Druck in Richtung gleichgerichteter Wahrnehmung entsteht: Man nimmt wahr, was man wahrnehmen soll und gewohnt ist, wahrzunehmen.
Die hier skizzierten Faktoren und Zusammenhänge, die auf die individuelle «Konstruktion von Realität» einwirken, erinnern uns zunächst daran, dass hinter der Wahrnehmung immer komplizierte psychologische Vorgänge stehen. Ihre Veränderung ist heikel und übersteigt rasch einmal die Fachkompetenz des Laien. Die Tatsache, dass wir immer nur selektiv wahrnehmen, hat eine wichtige Schutzfunktion für den Einzelnen. Er lässt dadurch auch Dinge zugedeckt, die ihn zu sehr ängstigen oder mit denen er nicht recht fertig wird.
Wahrnehmung ist immer ein Prozess, an dem die eigene Person mit ihrer Lebensgeschichte beteiligt ist. In diesem Sinne reagiert der Mensch nicht auf «die Realität», sondern auf sein Bild davon. Dieses Bild ist der entscheidende Anstoß für unsere Reaktionen. Auf dieses Bild hin handeln wir, treten in Kontakt, urteilen und entscheiden. Wir reagieren auf Menschen so, wie wir sie sehen, und nicht darauf, wie sie wirklich sind. ›
Auszug aus: Langmaack, B. & Braune-Krickau, M. (2000). Wie die Gruppe laufen lernt: Anregungen zum Planen und Leiten von Gruppen (7. Auflage). Weinheim: Beltz, S. 104–107 © Psychologie-Verlags Union, Verlagsgruppe Beltz, Weinheim.
2 Soziale Wahrnehmung und Wahrnehmungsfehler
2 Soziale Wahrnehmung und Wahrnehmungsfehler
Unsere Wahrnehmung von Menschen und Sachverhalten ist nicht objektiv. Wir machen uns ein Bild (unser Bild), indem wir aufgrund von Informationen und unseren Wahrnehmungen anderen Menschen Eigenschaften und Absichten zuschreiben. Im folgenden Ausschnitt werden mögliche Wahrnehmungsfehler beschrieben, die für Unterrichtsbeobachtungen und -besprechungen eine besondere Bedeutung haben.
< Die Einschätzung «auf den ersten Blick»
Der erste Eindruck bestimmt oft erstaunlich nachhaltig das Bild, das wir uns von Menschen machen. Die äußere Erscheinung des anderen und unsere eigene Spontanreaktion darauf (Sympathie / Antipathie) beeinflussen unsere späteren Wahrnehmungen. So tendiert man z. B. bei Menschen, die einem spontan gefallen, das zu übersehen, was nicht ins positive Bild passt. Leider gilt dies auch für den umgekehrten Fall. Unsere Wahrnehmung arbeitet selektiv. Der «erste Eindruck» kann nur schwer korrigiert werden.
Vorgefertigte Bilder (Stereotype)
Unsere Wahrnehmung wird beeinflusst durch vorgefertigte Bilder, die wir in unseren Köpfen haben. Man bezeichnet diese Bilder als Stereotype (griech. stereotyp: starr, ständig wiederkehrend). Es handelt sich um emotional gefärbte Vorstellungen, die sich auf ganze Gruppen (bzw. Klassen) von Menschen beziehen:
•ein Italiener! (Nationenstereotyp)
•ein Lehrer! (Berufsstereotyp)
•ein Linker! (politisches Stereotyp)
Wenn wir irgendeine Information über einen Menschen besitzen – wir wissen z. B., welchen Beruf er ausübt –, so treten diese Stereotype in Aktion: Wir beginnen den Unbekannten «einzuordnen», wir machen uns ein Bild, wir glauben, etwas über ihn zu wissen.
Der Halo-Effekt
Damit ist gemeint, dass irgendeine hervorstechende «Eigenschaft» einer Person den Gesamteindruck bestimmt. Alles andere wird davon «überstrahlt», es wird nicht mehr bemerkt (griech. halo = «Hof» um eine Lichtquelle).
•eine schöne Frau!
•ein erfolgreicher Mann!
•ein schwacher Schüler!
Die Beispiele machen deutlich, wie der Halo-Effekt mit den bestehenden Normen zusammenhängt. Wenn ein Schüler in den «zentralen» Fächern (Sprache, Rechnen) schwache Leistungen erbringt, ist er eben ein «schwacher Schüler». Andere Qualitäten werden dann weniger beachtet.
Der logische Fehler
Er besteht darin, dass wir annehmen, dass bestimmte Eigenschaften «logischerweise» zusammen auftreten:
•intelligent, kritisch, ehrgeizig
•dumm, faul, uninteressiert
•höflich, sauber, anständig
Schon ein kurzer Blick auf eine solche «Liste» lässt uns den logischen Fehler erkennen. Trotzdem beeinflusst er unsere Alltagswahrnehmung.
Der Zuschreibungsfehler
Grundsätzlich können wir «Eigenschaften» von Menschen überhaupt nicht beobachten. Was wir tatsächlich sehen, sind Verhaltensweisen in bestimmten Situationen: Wir tendieren aber dazu, aus einzelnen beobachteten Verhaltensweisen Rückschlüsse auf die Person selbst zu ziehen: Wir schreiben ihr Eigenschaften zu.
•Einer, den wir bei einer Aggression beobachten, wird für uns «ein aggressiver Typ».
•Wir ertappen jemanden bei einer Lüge: Er ist unehrlich.
Zuschreibungen prägen unser «Bild vom anderen». Sie beeinflussen aber auch unser Verhalten. Von Zuschreibungen kann abhängen, ob wir mit dem anderen überhaupt etwas zu tun haben wollen oder nicht.
Warum unterliegt die soziale Wahrnehmung so vielen Verzerrungen?
Warum können wir andere Menschen nicht «objektiver» sehen?
Es scheint, dass unser «Bildermachen» von wichtigen Bedürfnissen beeinflusst
wird.
1.Die Bilder sind einfacher als die Realität. Sie erleichtern dadurch die Orientierung und Entscheidung.
2.Die Bilder sind dauerhafter als die Wirklichkeit. Wenn die Menschen «eben so sind, wie sie sind», fällt es uns leichter, ihr Verhalten zu verstehen, als wenn sie sich ändern.
3.Die Bilder sind einheitlicher, weniger widersprüchlich als die Realität. Auch dies erleichtert uns die Orientierung und Entscheidung.
4.Bilder (besonders Stereotype) erzeugen Übereinstimmung mit der Gruppe: «WIR» sehen die anderen so oder so.
Wir nehmen Menschen wahr, indem wir uns ein Bild von ihnen machen. Die Bilder sind einfacher, dauerhafter und widerspruchsfreier als die Wirklichkeit. Gemeinsame Bilder stärken den Gruppenzusammenhalt. ›
Auszug aus: Marmet, O. (2000). Ich und du und so weiter. Kleine Einführung in die Sozialpsychologie, Weinheim: Beltz, S. 60–63 © Verlagsgruppe Beltz, Weinheim.
3 Reflexion des Handelns – eine grundlegende Kompetenz
3 Reflexion des Handelns – eine grundlegende Kompetenz
Im folgenden Ausschnitt fordert Regula von Felten, dass erfolgreiche Lehrerinnen und Lehrer fähig und bereit sein müssen, ihr eigenes Handeln zu reflektieren und zu verändern. Dazu gehört, Routinen zu hinterfragen und sein berufliches Handeln einer reflexiven Rechtfertigung zu unterziehen.
< Reflexion als Mittel, eigenes Handeln zu entwickeln
Eine erfolgreiche Lehrperson verfügt über ausreichendes Wissen und Können, um die Anforderungen des Schulalltags zu erfüllen. Sie kann beispielsweise Lernziele formulieren und begründen, Inhalte sinnvoll strukturieren und verschiedene Lehr-Lern-Arrangements realisieren. Sie versteht es, Schülerinnen und Schüler zu beobachten, ihre Ressourcen und Defizite wahrzunehmen und sie individuell zu begleiten. Sie kennt Möglichkeiten, um ein Gespräch zu eröffnen und zu leiten, Konflikte in der Klasse anzugehen und die Gemeinschaftsbildung zu fördern. Sie kann auf die Vorwürfe eines Vaters an einem Elternabend oder auf die Kritik einer Schülerin angemessen reagieren. Sie weiß, in welchen Situationen sie eine weitere Fachperson beiziehen sollte, und kann alleine und im Team Verantwortung übernehmen. Von ihr wird vieles und ganz Unterschiedliches erwartet.
Nur ein umfangreiches Handlungsrepertoire macht es möglich, die vielfältigen Aufgaben des Lehrberufs zu bewältigen. Trotzdem muss eine Lehrperson stets damit rechnen, dass bisher bewährte Handlungen nicht zum Erfolg führen. Schülerinnen und Schüler, Eltern und Teammitglieder reagieren oft anders als erwartet. Eine Lehrperson sollte daher fähig und bereit sein, ihr eigenes Handeln zu reflektieren und zu verändern.
Probleme, die im Schullalltag auftreten, fordern heraus und bieten gleichzeitig die Chance, Handlungsroutinen aufzubrechen und die eigene Kompetenz zu erweitern.
«So notwendig und sinnvoll Routinen auch sind, sie verleiten dazu, Situationen zu nivellieren, die Sensibilität für Differenzen verkümmern zu lassen, den Blick für die geänderten Verhältnisse zu verlieren und schließlich sein eigenes pädagogisches Konzept nicht mehr infrage stellen zu wollen. Kompetentes Wissen und Handeln muss deshalb auf einer übergeordneten Ebene thematisiert werden. Es muss sich der reflexiven Rechtfertigung stellen» (Plöger 2006, S. 22).
Um die Bedeutung der Reflexion zu begründen, bezieht Wilfried Plöger die Systemtheorie Luhmanns ein und verdeutlicht, dass die Kompetenzen von Lehrpersonen Resultat von Selektions- bzw. Reduktionsprozessen sind. Handlungsroutinen kommen durch Negation anderer Möglichkeiten zustande. Eine Lehrperson hält an einmal Bewährtem fest. Sie kann und will sich nicht jeden Tag neu entscheiden, denn dann wäre sie letztlich handlungsunfähig. Pädagogisches Wissen und Können hat aber immer nur eine vorläufige Gültigkeit und muss als potenziell wandelbar angesehen werden. Eine Lehrperson muss offen bleiben für die vorerst ausgeschlossenen Möglichkeiten und diese wieder in die pädagogische Reflexion einbeziehen (ebd., S. 22 ff.).
Steht die Reflexion des eigenen Handelns im Vordergrund, beziehen sich die Argumentationslinien auch häufig auf Donald A. Schöns «Epistemologie der Praxis» (Wittenbruch 2007; von Felten 2005; Altrichter & Lobenwein 1999; Dick 1999; Herzog 1995). Schön zeigt in seinen beiden Werken «The Reflective Practitioner» (1983) und «Educating the Reflective Practitioner» (1987) auf, wie wichtig es ist, dass Praktikerinnen und Praktiker ihr Handeln aus Distanz betrachten. Befreit von Handlungsdruck, können Probleme überhaupt erst wahrgenommen werden. «In real-world practice, problems do not present themselves to the practitioner as givens. They must be constructed from the materials of problematic situations which are puzzling, troubling, and uncertain. In order to convert a problematic situation to a problem, a practitioner must do a certain kind of work» (Schön 1983, S. 40).
Diese Art von Praxisreflexion bezeichnet Schön als «reflection-on-action». Nach dem Unterricht analysieren Lehrpersonen Geschehenes. Sie beziehen bisher unberücksichtigte Aspekte ein, fassen das Problem, betrachten es aus unterschiedlichen Perspektiven und suchen nach möglichen Handlungsalternativen. Schließlich gilt es, neu entdeckte Handlungsmöglichkeiten in der weiteren Praxis zu erproben, ihre Wirkung zu überprüfen und das eigene Wissen und Können auf diese Weise zu erweitern und zu differenzieren.
Um die Fähigkeit zur Reflexion und zur Entwicklung des eigenen HandeIns – in eben beschriebenem Sinne – zu erwerben, sieht Schön (1987) ein spezifisches Ausbildungssetting vor. Anhand von Beispielen aus der Ausbildung von Architektinnen und Architekten illustriert er, wie Studierende im reflexiven Praktikum mit ihren Coachs zusammenarbeiten. Begleitet von erfahrenen Praktikerinnen und Praktikern, üben sich Architekturstudierende darin, Probleme in der Praxis zu erkennen, nach adäquateren Handlungsweisen zu suchen und so das eigene Wissen und Können schrittweise zu entwickeln.
Erfolgreiche Praktikerinnen und Praktiker verfügen aber nicht nur über die Fähigkeit, ihr Handeln im Nachhinein zu reflektieren, sie sind auch in der Lage, unvorhergesehene Situationen während des Handelns neu zu interpretieren und geschickt darauf zu reagieren. Schön spricht in diesem Zusammenhang von «reflection-in-action».
«Reflection-in-action has a critical function, … we may, in the process, restructure strategies of action, understandings of phenomena, or ways of framing problems […]. Reflection gives rise to on-the-spot experiment. We think up and try out new actions intended to explore the newly observed phenomena, test our tentative understandings of them, or affirm the moves we have intended to change things for the better» (Schön 1987, S. 28).
«Reflection-in-action» meint also ein Neurahmen («reframing») einer Situation während des Handelns. Die Situation erscheint dadurch in neuem Licht und weist der Lehrperson die Richtung für weitere Handlungsschritte. Dieses Im-Austausch-mit-der-Situation-Sein («reflexive conversation») und das unmittelbare Reagieren auf Unerwartetes erfordert Präsenz, Gefühl und Kreativität. Entscheidungen fällt die Lehrperson dabei intuitiv, und es wird ihr im Nachhinein nicht auf Anhieb gelingen, das Geschehene zu erklären. Was nicht heißt, dass das Wissen und Können von Lehrpersonen irrational ist (Dewe, Ferchhoff & Radtke 1992, S. 85).
«Reflection-in-action is a process we can deliver without being able to say what we are doing. Skillful improvisers often become tongue-tied or give obviously inadequate accounts when asked to say what they do. Clearly, it is one thing to be able to reflect-in-action and quite another to be able to reflect on our reflection-in-action so as to produce a good verbal description of it» (ebd., S. 31).
Um Ereignisse im Unterricht klar zu fassen und das eigene Handeln zu begründen, sind daher Phasen der Rechenschaftslegung unabdingbar. In diesen beziehen sich Lehrpersonen auf ihre persönlichen Überzeugungen, was eine gute Schule bzw. guter Unterricht ausmacht, und haben Gelegenheit, diese aufzuarbeiten.» ›