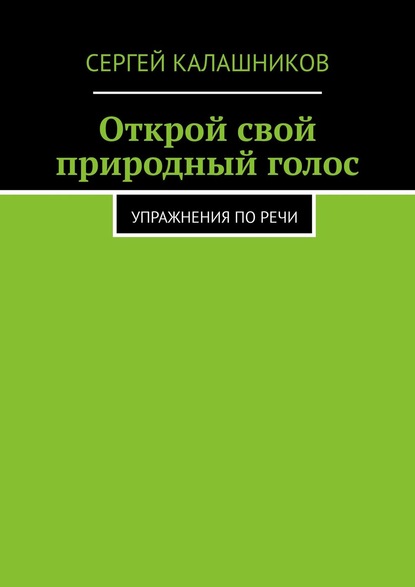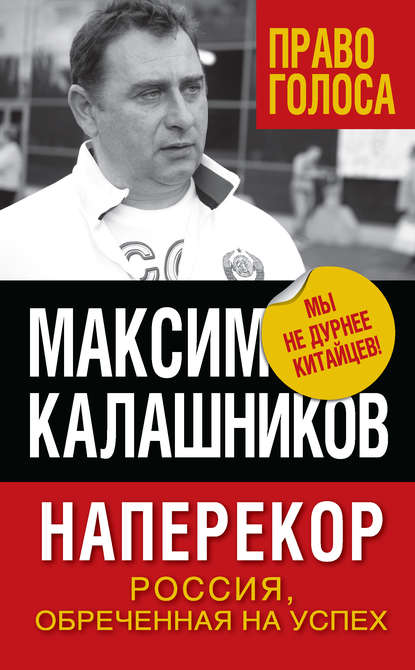Schule und Bildung aus soziologischer Perspektive (E-Book)

- -
- 100%
- +
«Geht in eure Bänke! Beim Wort Geht legen die Schüler vernehmlich ihre rechte Hand auf die Bank und setzen ein Bein in die Bank; bei in eure Bänke ziehen sie das andere Bein nach und setzen sich vor ihre Schiefertafel […] Nehmt die Tafeln! Beim Wort Nehmt legen die Kinder die rechte Hand an die Schnur, mit der die Tafel am Nagel aufgehängt ist, und mit der linken fassen sie die Tafel; bei die Tafeln nehmen sie sie ab und legen sie auf den Tisch.» (Journal pour l’instruction élémentaire [1816]; zit. n. Foucault 1977, S. 215 f., [Hervorh. i. Original])
2.2 Institutioneller Wandel im Zeitalter der Nationenbildung
Am Übergang vom 18. zum 19. Jahrhundert kommt es in Europa zum bereits erwähnten fundamentalen gesellschaftlichen Umbruch, dem auch die Bildungsinstitution unterworfen ist. Gemeint ist der Zerfall der ständischen Ordnung des Ancien Régime. Dieser schritt in den europäischen Ländern mit verschiedener Geschwindigkeit voran. Wo er stattfand und eine zunehmend nicht mehr ständisch gebundene Gesellschaft entstehen konnte, hatte er Folgen sowohl für die gesellschaftliche Positionierung der Individuen als auch für die zuvor territorialstaatlichen Gebilde13:
•Die soziale Stellung des Einzelnen sollte nicht mehr von Geburt an vorbestimmt sein. Vielmehr hatten die Menschen nun in zunehmendem Masse die Möglichkeit, sich mit Tüchtigkeit und Glück eine gesellschaftliche Position selber zu erarbeiten.
•Der Zusammenhalt der grossen gesellschaftlichen Kollektive bedurfte einer neuen Grundlage. Waren die alten Verhältnisse – gestützt durch die Autorität weltlicher Obrigkeit und der Kirche – weithin als gottgewollt hingenommen worden, bedurfte es zur Sicherstellung von Zusammenhalt und Gemeinsamkeit nun einer neuen Klammer, eines neuen ‹Bindemittels›.
Man kann sich vorstellen, dass der erwähnte Umbruch sowohl für den einzelnen Menschen als auch für kleinere Gemeinschaften und grössere Kollektive schwierig zu bewältigen war. Die alten Werte und Normen waren infrage gestellt und zum Teil beseitigt worden, das Neue war erst in Ansätzen erkennbar. Die Soziologie bezeichnet eine Situation dieser Art als kollektive Anomie und meint damit das Fehlen verlässlicher Normen, allgemeine Unsicherheit und Orientierungslosigkeit. Hilfreich unter solchen Voraussetzungen waren zwei neue ideologische Konstrukte: die Nation und, damit zusammenhängend, das Volk. Überall in Europa entstanden ab der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts nationalistische Bewegungen, die den Rahmen der Gesellschaft nicht mehr allein über ein Territorium definieren wollten, das von einer politischen Obrigkeit als Hoheitsgebiet verwaltet wurde, sondern diesem Territorium den Nimbus einer ursprünglichen Gemeinschaft verliehen, die als auf ‹ethnischer› Zugehörigkeit beruhendes Volk imaginiert wurde – als eine «vorgestellte Gemeinschaft von Gleichen» (Anderson 1988).
Die Idee des Volkes stützte (und stützt sich zum Teil noch heute) in der Regel auf ein Gemenge von Komponenten, die überwiegend als ideologische Konstruktionen zu sehen sind. Obschon sie von Nation zu Nation mit unterschiedlichen Akzentsetzungen14 auftreten, lassen sich insgesamt doch die folgenden hervorheben:
•eine gemeinsame Sprache, die eine ‹natürliche› Zusammengehörigkeit derjenigen suggeriert, die diese Sprache sprechen;
•eine Reihe von – wie angenommen wird, allen gemeinsamen – Glaubensüberzeugungen;
•ein Gründungsmythos, der gleichsam den Punkt markieren soll, ‹an dem alles angefangen hat›;
•daran anschliessend eine gemeinsame, heroisierte Geschichte;
•die Vorstellung von einem Territorium, das ein Volk berechtigterweise beanspruchen kann;
•die Idee einer Art Blutsverwandtschaft all derer, die sich dem Volk zurechnen können.
Historische und sozialwissenschaftliche Erklärungen der Dynamik solcher nationalistischer Strömungen verweisen unter anderem auf die Bedeutung, die das Schulwesen für die Verbreitung entsprechender Ideen haben kann, und stellen beispielsweise Fächer wie Heimatkunde oder staatbürgerlichen Unterricht in diesen Zusammenhang.
«Seit der Mitte des 18. Jahrhunderts wurde deshalb in weiten Teilen Europas vermehrt über Nationalerziehung gesprochen. Diese Diskussionen wurden dadurch begünstigt, dass sich die Tendenz abzuzeichnen begann, anstehende gesellschaftliche und/oder politische Probleme durch Erziehung zu lösen.» (Horlacher 2011, S. 44)
Auch in den republikanischen Gebieten der damaligen Schweiz waren solche Gedanken alles andere als fremd, wie Tröhler (2011, S. 47) in seiner Darstellung der Gründung der Zürcher Kunstschule 1773 schreibt:
«Der Initiator der Zürcher Kunstschule von 1773 etwa, der Bürgermeister Hans Conrad Heidegger (1710–1778), hatte 1765 die Ansicht vertreten, dass die Schule als ‹eine Nationalanstalt› zu verstehen sei, ‹in welcher von der ersten Kindheit an und für alle Stände der Mensch sich zum nützlichen Mitglied des Staates› mit dem Zweck zu entwickeln habe, ‹an der Beförderung der Wohlfahrt des Vaterlandes arbeiten zu helfen›.» (Heidegger, zit. in: Nabholz 1938, S. 86)
Die zu dieser Zeit entstehende Auffassung von Erziehung als Beitrag zur nationalen Wohlfahrt und Entwicklung impliziert auch eine Veränderung der gesellschaftlichen Stellung des einzelnen Menschen gegenüber dem Staat, also mithin seines staatsbürgerlichen Status. Der englische Soziologe Thomas H. Marshall hat diese Entwicklung vom 18. bis ins 20. Jahrhundert nachgezeichnet. Das 18. Jahrhundert ist für ihn die Zeit, in der sich vor allem das «bürgerliche Element», das heisst die bürgerlichen Individualrechte ausbreiten: «Freiheit der Person, Redefreiheit, Gedanken- und Glaubensfreiheit, Freiheit des Eigentums, die Freiheit, gültige Verträge abzuschliessen, und das Recht auf ein Gerichtsverfahren» (Marshall 1992, S. 50). Darauf bauen ab dem 19. Jahrhundert die politischen Rechte auf: «Recht auf Teilnahme am Gebrauch politischer Macht, entweder als Mitglied einer mit politischer Autorität ausgestatteten Körperschaft, oder als Wähler der Mitglieder einer derartigen Körperschaft» (a. a. O.). Im späten 19. Jahrhundert schliesslich kam die Entwicklung und Ausweitung des «sozialen Elements» in Gang: « […] vom Recht auf ein Mindestmass an wirtschaftlicher Wohlfahrt und Sicherheit, über das Recht an einem vollen Anteil am gesellschaftlichen Erbe, bis zum Recht auf ein Leben als zivilisiertes Wesen entsprechend der gesellschaftlich vorherrschenden Standards» (a. a. O.).
In unserem Zusammenhang von besonderem Interesse ist nun die Stellung, oder besser die ‹Karriere› der Bildung über die drei Phasen hinweg. Aus heutiger Sicht handelt es sich dabei klar um ein soziales Recht, nämlich das Anrecht auf Teilhabe an den kulturellen Errungenschaften der Gesellschaft, oder individuell gewendet das Recht auf Kultivierung der eigenen Person. Dies war indessen nicht die vorherrschende Sicht im 18. und 19. Jahrhundert.15 Damals erschien der Erwerb von Bildung noch als Voraussetzung für die Wahrnehmung zunächst der bürgerlichen Rechte wie etwa der Eigentums- und Vertragsrechte; und dann vor allem für die verantwortungsvolle und informierte Teilhabe an politischen Entscheidungen. Bildung wurde somit als Pflicht verstanden, der man sich zu unterziehen hatte, um – dies das darauf aufbauende Bürgerrecht – an der Gestaltung des Gemeinwesens teilzuhaben:
«Wenn der Staat allen Kindern eine Erziehung sicherstellen will, dann hat er dabei ausdrücklich die Voraussetzungen und das Wesen des Staatsbürgerstatus im Blick. Er versucht, die Entwicklung der werdenden Staatsbürger zu fördern. […] Grundsätzlich sollte es [das Recht auf Bildung, M. R.] nicht als das Recht des Kindes auf den Besuch der Schule gesehen werden, sondern als das Recht des erwachsenen Staatsbürgers, eine Erziehung genossen zu haben.» (Marshall 1992, S. 51)
Diese im Recht auf Bildung enthaltene Ambiguität zwischen Bildung als Voraussetzung und Bildung als sozialer Wert an sich lebt in den Institutionen der öffentlichen Bildung bis auf den heutigen Tag weiter. Der Auffassung von Bildung als einem selbstverständlichen, universellen Menschenrecht steht in Gestalt der obligatorischen Schule noch immer die Institutionalisierung von Bildung als einer Verpflichtung gegenüber.
Im Zusammenhang des vorliegenden Kapitels ist indessen auf zwei Aspekte hinzuweisen, die in dieser Diskussion eher im Hintergrund geblieben sind: Wenn es eine Form gibt, der «vorgestellten Gemeinschaft von Gleichen» bereits im frühen Kindesalter symbolisch Ausdruck zu verleihen, so eignen sich dazu wenige Dinge so gut wie die für alle geltende Teilnahme an einer Institution, die sich spezifisch mit Kindern und Jugendlichen befasst (zur Legitimationsfunktion von Bildung vgl. Kapitel 3). So gesehen darf man die Einführung der allgemeinen Schulpflicht, die im 19. Jahrhundert in weiten Teilen Europas vollzogen wurde, durchaus als eine Erscheinung verstehen, die in engstem Zusammenhang mit der Entstehung der modernen Nationen und mit dem damit verbundenen Nationalismus steht.
Die Einführung der allgemeinen Schulpflicht stellte auch die erste und wohl radikalste Herausforderung der hergebrachten Schulstrukturen dar. Erstmals sollten alle Kinder, ungeachtet ihrer Herkunft, die elementare schulische Erziehung nicht von Anfang an in durch Standesgrenzen getrennten Bahnen – und das heisst in separierten Teilen der Bildungsinstitution – erfahren, sondern in einer Einrichtung, welche keine Standesgrenzen kennt. Diese Feststellung bringt uns zu einem weiteren Punkt: Mit der Einführung der Pflicht aller zur Teilnahme an der gemeinsamen elementaren Bildung wurde auch der Grundstein für etwas gelegt, das vor allem mit dem Ausbau der weiterführenden Bildung zunehmende Bedeutung erlangen sollte. Das Schulwesen wurde nämlich dadurch als ein System eingerichtet, in dem man mehr oder weniger Erfolg haben und vorankommen, also weiterführende Schulen besuchen kann, was wiederum dem Erreichen höherer beruflicher und gesellschaftlicher Positionen förderlich ist. Für alle Kinder wurde eine Art gemeinsame Grund- oder Startlinie im Alter von etwa sieben Jahren geschaffen. Mehr über die weitreichenden Folgen dieses fundamentalen Wandels wird in einem der nächsten Kapitel (Kapitel 3) zu erfahren sein.
Die eben skizzierte Entwicklung fand in den Ländern Europas je nach deren politischen Verhältnissen in unterschiedlicher Geschwindigkeit und mit unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen statt. Vollzogen einige die Einführung der allgemeinen Schulpflicht verhältnismässig früh in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, dauerte es in anderen bis zum späten 19. oder gar frühen 20. Jahrhundert. Und lag der Akzent in noch stark der alten Ordnung verpflichteten Ländern auf der Einführung einer einseitig von oben verordneten Staatsschule, wurde die Entwicklung in anderen auch von breiten Kreisen eines aufgeklärten republikanischen Bürgertums mitgetragen.
Letzteres trifft namentlich auch für den Fall der damaligen Eidgenossenschaft zu. Hier wurde kurz nach dem Einmarsch der napoleonischen Truppen zunächst die Helvetische Republik ausgerufen und ein Versuch unternommen, die allgemeine Schulpflicht landesweit zu verankern. Reformen im Schulwesen sollten gemäss den Wortführern der Helvetik nicht nur der Aufklärung zum Durchbruch verhelfen und zur Perfektionierung des Menschen beitragen; vielmehr wurden sie auch als Mittel gesehen, dem neuen Staat ein Fundament zu geben und ein Zugehörigkeitsgefühl gegenüber der helvetischen Nation zu erzeugen (Bütikofer 2006, S. 131 ff.).
Bekanntlich scheiterte das Experiment der Helvetik bereits nach knapp fünf Jahren, und die weitere Entwicklung vollzog sich – ebenfalls in unterschiedlicher Geschwindigkeit – in den Kantonen. Entsprechend liess sich die Einführung der modernen Schule nicht in derselben, direkten Weise, sondern nur gleichsam auf einer unteren, kantonalen Ebene mit dem Aufbau der Nation verknüpfen. Dass der landesweite Nationalismus auf gesamtschweizerischer Ebene mehr im Rahmen eidgenössischer Schützen-, Turn- und Trachtenfeste zelebriert wurde (Jansen und Borggräfe 2007, S. 155 f.), bedeutet jedoch nicht, dass er nicht auch im Schulwesen der Kantone durchaus präsent war. Denn die kantonalen Lehrpläne und Lehrmittel, namentlich jene für die Fächer Geschichte, Geografie und Gesang, orientierten sich sehr wohl am nationalen Ganzen. Und wichtiger noch: Auch auf der kantonalen Ebene wurde die neue Schule als Volksschule, als eine Schule für Gleiche, eindeutig im Kontext der neuen Ordnung und der Herausbildung einer Nation verstanden. In einem gewissen Sinne geschah dies gar noch radikaler als anderswo. Denn die Volksschule wurde nicht nur als eine Errungenschaft des ganzen Volkes und der entstehenden Nation gefeiert, sondern namentlich auch als Beitrag zu deren demokratischen Verhältnissen. Die Schule sollte einen grundlegenden Beitrag dazu leisten, dass die Bürger des Landes16 an den Staatsgeschäften Anteil nehmen konnten.
Wie erwähnt, lässt sich die Etablierung der modernen Volksschule im Falle der Schweiz wegen der Verschiebung dieses Prozesses auf die kantonale Ebene nicht unmittelbar zu nationalistischen Bestrebungen in Beziehung setzen. Das bedeutet aber nicht, dass sie nicht mit der Entwicklung der Schweiz als Nationalstaat aufs Engste verknüpft gewesen ist. Denn wenn sich die Schweiz im Verlauf des 19. Jahrhunderts als ein föderalistisches und eben nicht zentralistisches Staatsgebilde definierte, so war es nicht zuletzt die Verlagerung der Entscheidungsbefugnisse in Bezug auf Schule und Bildung nach unten, welche diesen Staatsaufbau stützte – und bis auf den heutigen Tag stützt.17
Vergegenwärtigen wir uns an dieser Stelle nochmals Durkheims These: «Es [das Bildungssystem, M. R.] wird dann nicht als eine Gesamtheit von Praktiken und Einrichtungen erkennbar, die sich im Laufe der Zeit allmählich organisiert haben; die auf alle anderen sozialen Institutionen abgestimmt sind und diese ausdrücken; die sich demzufolge nicht nach Belieben verändern lassen, sondern nur bei gleichzeitiger Veränderung der Gesellschaftsstruktur selbst.» (Durkheim 1985, S. 44; Übers. und Hervorh. M. R.) Gerade die Entwicklungen an der Schwelle zur Moderne verdeutlichen sehr klar, dass die Praktiken und Institutionen der Erziehung vor allem dann geändert werden können, ja müssen, wenn sich die Struktur der Gesellschaft ändert, auf die sie bezogen sind. Dies scheint für den Zusammenhang zwischen Schulpflicht und Nationenbildung europaweit zu gelten, im Falle der Schweiz auch für den Zusammenhang zwischen der Etablierung der Volksschule auf der einen Seite und dem föderalistischen, demokratischen System auf der anderen.
2.3 Die Ausbreitung der weiterführenden Bildung
Halten wir nochmals fest: Der Übergang vom 18. zum 19. Jahrhundert leitet die Transformation eines ständisch gebundenen in ein auf Leistung beruhendes, meritokratisches Bildungswesen ein, an welchem alle Menschen ohne Standesunterschiede teilhaben können beziehungsweise sollen. Er markiert auch den Beginn einer Entwicklung, an deren Ende die für alle verpflichtende Elementarbildung steht. Und er setzt schliesslich, davon soll der vorliegende Abschnitt handeln, eine Entwicklung in Gang, in der das Schulwesen über die Elementarbildung hinaus ausgebaut wird. Damit erhält eine wachsende Zahl von Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit, an weiterführender Bildung teilzuhaben.
Gewiss hatte es schon in der Zeit zuvor Einrichtungen der mittleren und höheren Bildung gegeben. Sie standen jedoch ausschliesslich den städtischen Eliten offen; dies zunächst als Lateinschulen, die namentlich auf die Übernahme kirchlicher Ämter vorbereiten sollten, im Laufe des 18. Jahrhunderts zunehmend auch auf Tätigkeiten in Verwaltung und Handel.18 Weiterführende Schulen brauchten somit nicht völlig neu erfunden, wohl aber an eine neue Denkweise angepasst zu werden. Diese bestand darin, die Bildungseinrichtungen in ihrer Gesamtheit nicht mehr als ein horizontal gegliedertes Nebeneinander von Standesschulen zu konzipieren, sondern als ein vertikal gegliedertes Ganzes.
Einer der ersten Vorschläge in dieser Richtung stammte vom Geistlichen Gregor Girard, der ihn 1798 dem Helvetischen Directorium unterbreitete (vgl. dazu Jenzer 1998, S. 30 ff.). Er regte eine Konstruktion aus drei aufeinander aufbauenden Stufen an, nämlich
•einer première école für ouvriers, artisans und laboureurs. Gemeint waren damit nicht die Kinder aus Handwerker-, Bauern- und Arbeiterkreisen, sondern Menschen, die im späteren Erwachsenenleben in Landwirtschaft, Handwerk oder Industrie tätig sein würden. Was diese erste Stufe vermitteln sollte, waren les éléments des connaissances les plus nécessaires à la vie et à l’état de citoyen d’Helvétie. Nicht berufliche Qualifikationen, sondern staatsbürgerliche Kompetenzen standen somit im Vordergrund.
•einer seconde école für gens de plume und commerçants; dies als Vorbereitung auf Tätigkeiten in Verwaltung und Handel wie auch auf die nächste Stufe.
•die troisième école für instituteurs19, médecins und juges.
Man erkennt unschwer den dreistufigen Aufbau, der auch aus heutiger Sicht durchaus vertraut erscheint. Davon abgesehen verweist der Vorschlag jedoch, mehr implizit als explizit, auf eine Reihe weiterer Merkmale, die auch noch für das heutige Bildungswesen kennzeichnend sind:
•Da ist zunächst die Idee eines Zusammenhangs zwischen schulischen Niveaus und späteren beruflichen Tätigkeiten, also die Vorstellung von Schule als Ort einer Qualifikationsvermittlung, die differenziert nach unterschiedlichen beruflichen Anforderungen erfolgen soll.
•Deutlich wird zweitens, dass die Stände und die zwischen ihnen bestehenden Unterschiede nicht einfach auf einen Schlag spurlos verschwunden sind. Den drei Stufen entsprechen in Girards Vorschlag gesellschaftliche Gruppen, die auch bezüglich ihrer gesellschaftlichen Stellung vertikal angeordnet sind. Neu ist, dass die Zuordnung der Schülerinnen und Schüler zu diesen Gruppen gemäss diesem Modell nicht mehr gestützt auf Herkunft, sondern aufgrund schulischer Leistungsfähigkeit erfolgen soll.
•Daraus ergibt sich ein weiteres Merkmal, das den Vorschlag von der alten Ordnung unterscheidet: Das dreistufige System beruht auf Selektion nach Massgabe dieser schulischen Leistungsfähigkeit.
•Verknüpft man die beiden letzten Überlegungen, so ergibt sich eine weitere, die für das gewandelte Bildungswesen von fundamentaler Bedeutung ist: die Möglichkeit nämlich, gestützt auf schulische Leistungen von einer Generation zur nächsten in der sozialen Hierarchie auf- oder abzusteigen.
•Ein letzter Punkt schliesslich betrifft die Legitimation gesellschaftlicher Positionen, insbesondere privilegierter sozialer Stellung. Im Masse, in dem solche Positionen aufgrund schulischer Leistungsfähigkeit erlangt werden können, beruht die Legitimation von gesellschaftlichem Einfluss und Ansehen auf individuellem Schulerfolg – dies im Einklang mit liberalem Gedankengut, das sich am Übergang vom 18. zum 19. Jahrhundert zu formieren und zu artikulieren begann.
Was Gregor Girard formulierte, war das Modell des möglichen Aufbaus eines weiter entwickelten Schulwesens, nicht ein präziser Plan zu dessen künftiger Gestalt und schon gar nicht eine Beschreibung der damaligen Wirklichkeit. In der Schweiz sollte noch manches Jahrzehnt vergehen, bis die Kantone ein Gefüge aufgebaut hatten, das in etwa dem Girard’schen Modell entsprach. Und es sollte noch mehr als 200 Jahre dauern, bis das Prinzip eines Bildungsraums Schweiz in der Bundesverfassung verankert wurde.20 Es kann nicht Sache des vorliegenden Beitrags sein, die Entwicklung während dieser Jahrzehnte im Einzelnen darzustellen.21 Was hier interessiert, ist die Dynamik, die sich auf dem Hintergrund der eben diskutierten Implikationen des Modells in Bezug auf die Entwicklung der weiterführenden Bildung hat entfalten können.
Es ist allerdings schwierig, für länger zurückliegende Perioden verlässliche Daten über das Bildungswesen zu finden. Reinhart Schneider, ein deutscher Soziologe, hat es sich dennoch vor einiger Zeit zur Aufgabe gemacht, solche Daten für die Zeit zwischen 1870 und 1975 aus 13 europäischen Ländern, unter ihnen die Schweiz, zusammenzutragen (Schneider 1982). Zwei Schweizer Kollegen haben die Werte für alle 13 Länder mit jenen für die Schweiz verglichen und dabei zwar einige Abweichungen, aber insgesamt eine Bestätigung des allgemeinen Trends gefunden (Bornschier und Aebi 1992).
Abbildung 1: Durchschnittliche Einschulungsraten für 13 westeuropäische Länder 1870–1975 in Prozent

Quelle: Schneider (1982)
Infolge der Vielfalt der Schulstrukturen in den 13 Ländern sind die Kategorien in der linken Spalte vor allem zwischen Primar- und Sekundarschülern und -schülerinnen nicht trennscharf, überschneiden sie sich doch für die Altersgruppen der Zehn- bis Vierzehnjährigen. Und auch die in der Waagrechten unterschiedenen Perioden weisen unterschiedliche Ausdehnungen auf. Bezieht sich die erste Periode auf einen Zeitraum von 40 Jahren, sind es in den drei jüngsten noch je 5 Jahre. Dennoch lassen sich aus der Tabelle ein paar Tendenzen herauslesen:
•Für alle 13 Länder steigt der Anteil Primarschüler und Primarschülerinnen an der entsprechenden Altersgruppe nach der Periode 1870–1910 noch einmal kräftig an, bleibt dann bis 1960–65 auf dem Niveau von rund 70 Prozent, um dann zur letzten Periode leicht abzusinken. Der Anstieg in der ersten Periode hat damit zu tun, dass einige der Länder die allgemeine Schulpflicht erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts einführten, das Absinken im letzten Zeitintervall damit, dass ein steigender Anteil der Zehn- bis Vierzehnjährigen bereits die Sekundarschule besucht. Für die Schweiz liegen die Werte recht konstant bei knapp 80 Prozent; dies ist eine Folge der vergleichsweise frühen Institutionalisierung der Volksschule.
•Bei der Sekundarschule zeigt sich über alle Perioden hinweg für die Gesamtheit der berücksichtigten Länder ein dramatischer Anstieg von 2.2 Prozent (1870–1910) auf ein volles Drittel der Altersgruppe 10–19. Auch für die Schweiz steigen die Werte an, allerdings in einem viel schwächeren Ausmass, nämlich von etwa 3 auf 9 Prozent. Hier wirkt sich einerseits der Umstand aus, dass die sich in einer Berufslehre befindenden Jugendlichen nicht mitgezählt wurden, weil sie keine Vollzeitschule besuchten. Zum anderen spiegelt sich darin auch eine grössere Zurückhaltung der Schweizer Kantone in Bezug auf den Ausbau der Sekundarschulbildung.
•Ein ähnliches Bild ergibt sich für die tertiäre Bildung. Auch hier ist europaweit ein stetiger, wenngleich viel moderaterer Anstieg zu verzeichnen, der sich auch in der Schweiz nachweisen lässt, wobei hier wiederum eine grössere Zurückhaltung zu verzeichnen ist.
Im nachfolgenden Abschnitt wird sich zeigen, dass sich der Trend in Bezug auf die tertiäre Bildung ab 1975 nicht nur fortsetzt, sondern gar ein exponentielles Wachstum zu verzeichnen ist. Bevor wir uns dieser jüngsten Periode zuwenden, soll jedoch erst die Frage diskutiert werden, wie man sich die Zunahme der Beteiligung an mittlerer und höherer Bildung überhaupt erklären kann: Was bewegt die Staaten dazu, das Angebot an weiterführender Bildung stetig zu erweitern? Und was bringt die Menschen in den verschiedenen Ländern dazu, davon Gebrauch zu machen?
In der bildungssoziologischen Diskussion sind verschiedene Vorschläge erwogen worden, wie das Phänomen der Bildungsexpansion – und genau darum handelt es sich beim Ausbau der nachobligatorischen Bildung – erklärt werden könnte. Der scheinbar nächstliegende Ansatz argumentiert mit einer Veränderung und Zunahme der gesellschaftlichen Anforderungen, die es mit einem Ausbau der sekundären und tertiären Bildung zu bewältigen gibt. Man kann ihn als funktionalistischen Erklärungsansatz oder die funktionalistische Hypothese bezeichnen. Sie besagt, dass in der Gesellschaft des 19. und vor allem des 20. Jahrhunderts der Bedarf an Qualifikationen und Kompetenzen stetig und mit zunehmender Geschwindigkeit gestiegen ist, weshalb das Bildungswesen für die Bereitstellung dieser Qualifikationen und Kompetenzen sorgen musste, was insgesamt zu einer zunehmenden Verweildauer junger Menschen in schulischen Einrichtungen geführt hat.
Die Erklärung ist auf den ersten Blick bestechend. Denn es kann kaum ein Zweifel daran bestehen, dass das moderne Leben immer mehr neue Anforderungen an die Menschen stellt, mit denen sie in früherer Zeit noch nicht konfrontiert gewesen waren. Man denke hier etwa an die technologische Entwicklung, die sie in ihrer beruflichen Tätigkeit, aber auch im Alltagsleben mit zunehmend komplexen Anforderungen konfrontiert. Oder an die Einrichtungen der Sozialversicherungen, deren Regelwerke seit ihrer Einführung gewiss nicht an Durchsichtigkeit gewonnen haben. Oder schliesslich an Vorlagen eidgenössischer und kantonaler Abstimmungen, die zu verstehen Kopfzerbrechen bereiten kann.