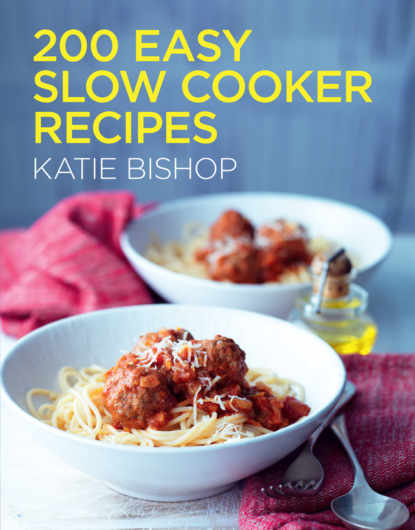- -
- 100%
- +
Aber das hieß auch, die schöne Schulzeit war nun endgültig und unwiderruflich vorbei. Nun gab es keinen mehr, der bei etwaigen Fehlern den Kopf für uns hinhalten würde. Selbst für den kleinsten Fehler beim Arbeiten lag die volle Verantwortung ab jetzt bei jedem einzelnen selbst.
Auch für unsere Gruppe, wir waren etwa 21 Mädels, kam dann nun bald die Zeit des Abschiednehmens. Einige blieben in Mainz, andere gingen in ihre Heimatstädte zurück und wieder andere heirateten schnell nach dem Examen.
Und ich? Theoretisch war auch meine Ausbildung am
1. April vorbei, da ich aber im ersten Ausbildungsjahr schwer erkrankt war – ich hatte mich während eines Südfrankreichurlaubs mit einem hartnäckigen Salmonellenstamm angefreundet – und für fast zwei Monate nicht hatte arbeiten dürfen, musste ich nachsitzen. Das hieß im Klartext, ich musste bis zum 6. Mai nacharbeiten.
Für mich war das allerdings auch ein Vorteil, musste ich doch noch mein Diplom zum Spital in die Schweiz schicken und auf eine Zusage hoffen. Somit konnte ich mich also beim Arbeiten mehr oder weniger lässig zurücklehnen und in Ruhe meinen Zukunftsträumen nachhängen.
Dann kam der Tag, an dem tatsächlich ein Brief von dem Schweizer Spital in meinem Briefkasten lag. Ich hielt das große Kuvert in den Händen, meine Beine fühlten sich auf einmal an wie Pudding und ich hatte Angst, den Umschlag zu öffnen. Sicher hatte man mir meine Bewerbungsunterlagen zurückgeschickt, dieser Gedanke schoss mir beim Öffnen durch den Kopf. Oh mein Gott! Es war ein Arbeitsvertrag! Es war mein Arbeitsvertrag! Befristet auf ein Jahr, das war damals in der Schweiz so üblich; es gab für Ausländer zunächst eine Aufenthaltsbewilligung für nur ein Jahr. Das alles spielte keine Rolle, ich hielt meinen ersten Arbeitsvertrag in den Händen! Kein Traum, nein, Realität!
Ich konnte mein Glück kaum fassen, dass mein großer Traum in Erfüllung gehen sollte. Schon zum 1. Juni konnte ich als Gruppenleiterin auf der Wöchnerinnenstation mit meiner Arbeit beginnen.
Mein nächster Blick galt meinem Kalender – Panik! Wir hatten bereits den 20. April, das bedeutete, mir blieben nur noch sechs Wochen Zeit, um für meinen Umzug alles vorzubereiten. Wohnung kündigen, packen, Abschied nehmen, und so weiter.
Wolfgang! Abschied von Wolfgang? Auf einmal wurde mir bewusst, was er mir bedeutete. Wollte ich wirklich weg? Wollte ich mich wirklich von ihm trennen? Andererseits, so ein Dreiecksverhältnis war nicht wirklich das, was ich wollte. Ich musste mit ihm reden, wenn er mich liebte und mich bitten würde zu bleiben, wenn er sich von Mimi trennen und sich eine Zukunft mit mir vorstellen könnte, vielleicht sogar eine Heirat nicht ausschließen würde, ja, dann würde ich hier bei ihm bleiben.
Also setzte ich mich hin, um ihm einen Brief zu schreiben. Ich hatte nicht den Mut und auch Angst, ihm persönlich gegenüberzutreten, um ihn vor die Entscheidung zu stellen: Mimi oder ich.
Ich schrieb mir alles von der Seele, wie sehr ich ihn liebte und wie sehr ich unter unserem seltsamen Verhältnis litt. Den noch nicht unterschriebenen Arbeitsvertrag vor Augen stellte ich ihn vor die Wahl: sie oder ich. Drei Tage wollte ich ihm für die Entscheidung Zeit geben, das müsste genügen, danach den Vertrag unterschreiben und zurück in die Schweiz schicken.
Unter Tränen schrieb ich diesen Brief, fuhr zu Wolfgang und warf den Brief eigenhändig in seinen Briefkasten.
Jetzt hieß es abwarten. Ich wollte nichts in Bezug auf meinen Weggang unternehmen, bevor die Frist für Wolfgang abgelaufen war. Ich wollte seine Entscheidung abwarten.
Also wartete ich. Wie lange sind eigentlich drei Tage? Zu lange. Die Stunden vergingen im Zeitlupentempo, ich traute mich aus Angst, er käme genau dann, wenn ich nicht da wäre, kaum noch aus meiner Wohnung. Telefon hatte ich keines und Handys gab es damals natürlich noch nicht.
Drei Tage. Kein Wolfgang. Ich beschloss, noch einen Tag dranzuhängen, dann noch einen und noch einen Tag.
Sechs Tage, kein Lebenszeichen von Wolfgang. Ich war enttäuscht, traurig und auch wütend. Zu ihm zu fahren traute ich mich nach diesem Liebesbrief natürlich nicht.
Nun konnte ich den Arbeitsvertrag auch nicht länger zurückhalten. Das Kantonsspital wollte meine Antwort. Schweren Herzens unterschrieb ich und brachte noch am gleichen Tag den Brief zur Post. Die Entscheidung war also gefallen. Mein Leben würde sich ändern. Wie sehr, sollte ich erst viel später erfahren.
Die nächsten Tage wurden zum wahren Fiasko. Es gab so viel zu erledigen, Papierkram, nebenbei noch arbeiten, meine Familie und Freunde von meinem Umzug informieren. Dazu noch der Schmerz und die Gewissheit, Wolfgang endgültig verloren zu haben.
Jetzt erst recht, irgendwann schaltete mein Gehirn um und ich begann mich auf das Neue, auf das Unbekannte zu freuen. Ich würde ins Ausland gehen, damals schien selbst unser Nachbarland Schweiz für viele auf einem anderen Planeten zu liegen; auch für meinen Vater ein schier unmögliches Unterfangen. Seine kleine Tochter, fern der Heimat, ganz allein. Ich glaube, insgeheim trug er sich mit der Hoffnung, ich würde in seiner Nähe irgendwo einen Arbeitsplatz finden. Aber für mich war klar, das war das Letzte, was ich wollte.
Endlich frei und unabhängig sein, neue Leute kennen lernen. Dass der Vertrag nur für ein Jahr befristet war, störte mich nicht. Man würde weitersehen, wenn es denn so weit war. Ich malte mir aus, vielleicht nach dieser Zeit nach England zu gehen und das internationale Examen zu machen. Oder auf einem Schiff als Krankenschwester anzuheuern. Irgendetwas würde sich schon finden. So auf ein Jahr im Voraus wollte ich nicht denken. Nur das Heute zählte und die Zeit bis zur Abreise wurde immer kürzer.
Recht schnell erhielt ich aus der Schweiz die Einreisebewilligung mit sämtlichen Informationen, die ich als Ausländer benötigte. Wie und wo die grenzsanitäre Untersuchung stattzufinden hatte, wann und wo ich mich anmelden müsste, der Mietvertrag für meine Personalwohnung und vieles mehr.
Da ich absolut keine Ahnung hatte, wie ich mit der Vielzahl an Informationen für Ausländer umzugehen hatte, war ich auf die Hilfe von Dorothea und Paul angewiesen, die ja auch schon für einige Jahre in der Schweiz gelebt hatten. Papierkrieg und Behördenkram waren noch nie mein Hobby und ich beschloss, irgendwann zu gegebener Zeit einfach abzureisen und die Dinge auf mich zukommen zu lassen. Irgendwann würde mir schon irgendjemand zu gegebener Zeit sagen, wann ich was zu tun hätte oder wann ich mich wo anzumelden hätte.
Wenn ich heute daran zurückdenke, muss ich sagen, dass ich damals recht blauäugig und unschuldig in die unbekannte Zukunft gestürzt bin. So alles auf sich zukommen lassen; heute fast ein Unding. Aber so war ich damals.
So weit, so gut.
Mitten in meinen Vorbereitungen kam, was kommen musste. Wolfgang stand vor meiner Tür, meinen Brief in der Hand, übernächtigt und bleich, bemühte er sich, die Fassung zu wahren. Er sei eben erst aus einem Skiurlaub zurückgekommen, habe den Brief von mir vorgefunden, gelesen und sei umgehend zu mir gefahren.
Ob ich den Vertrag schon unterzeichnet hätte, war seine erste Frage. Die zweite, ob ich den Vertrag wieder rückgängig machen könne. Ich solle bei ihm bleiben, wir könnten uns zusammen eine Wohnung suchen, Mimi sei unwichtig.
Zu spät! Zu spät! Ich schien ins Bodenlose zu stürzen, ich hatte ja keine Ahnung, dass er in den Urlaub fahren wollte, es sei eine kurzfristige Entscheidung gewesen, deshalb habe er sich nicht mehr von mir verabschieden können. Und jetzt das! Warum hatte ich ihn nicht schon viel früher um eine Entscheidung gebeten, mit ihm geredet, ihm von meinen Gefühlen erzählt? Nun war es zu spät, der Stein war ins Rollen gekommen, Wohnung gekündigt und so weiter. Ich war nie ein Mensch, der auf einem einmal eingeschlagenen Weg stehen bleibt oder Entscheidungen rückgängig macht. Es war passiert, ich stand dazu, egal wie schwer es mir fiel. Es hat halt so sollen sein. Unsere Wege würden sich trennen müssen, Fernbeziehungen führte man damals noch nicht so wie heute.
Nur eine Woche bis zum 6. Mai blieb uns noch. Dann war meine Zeit an der Uniklinik in Mainz vorbei und mein Nachmieter sollte meine Wohnung übernehmen. Ein paar Tage wollte ich noch bei meiner Freundin Sissi und ihrem Mann Werner bleiben, bevor ich für weitere zehn Tage zu meinem Vater in die Eifel fahren wollte.
So hatte ich in dieser kurzen Zeit alle Hände voll zu tun, mein ganzes Hab und Gut, welches in einer kleinen 1-Zimmer-Wohnung untergebracht war, musste auf ein Minimum reduziert werden, sollte doch alles irgendwie in meinem VW-Käfer verstaut werden. Dieses Unterfangen stellte sich auch als äußerst schwierig dar. Am Schluss war das Auto so voll, das ich kaum noch hinter den Fahrersitz passte und durch das Rückfenster konnte man gar nichts mehr sehen. Ich glaube, ich fuhr den ersten tiefergelegten VW-Käfer überhaupt auf meinem Weg in die Schweiz.
Es gab viele Tränen beim Abschied. Sissi und Werner organisierten noch eine Abschiedsparty für mich und alle meine Freunde kamen. Ich hätte nie gedacht, dass mir der Abschied doch so schwer fallen würde. Am schlimmsten war es natürlich für Wolfgang. Eigentlich mussten wir uns wegen eines Missverständnisses trennen. Erich und er versprachen, mich so schnell wie möglich besuchen zu kommen. Es seien bald Semesterferien, da könne man kurzfristig in Urlaub fahren. Trotz allem war ich todtraurig. Doch sobald ich im Auto eingeklemmt hinter dem Steuer saß, nahm die Vorfreude auf das Neue und Unbekannte überhand.
Auf geht’s in die Eifel zum nächsten Abschied!
Mein Vater freute sich einerseits riesig, mich mal länger als ein Wochenende bei sich zu haben. Andererseits war er auch traurig, denn die Schweiz war ja so weit. Er sagte, ich müsse seine Angst und seine Sorgen verstehen, schließlich wäre ich ja mutterseelenallein in diesem fremden Land. Ich musste hoch und heilig versprechen, mich regelmäßig zu melden und mir ein Telefon anzuschaffen, nachdem er so oft vor Sorge fast umgekommen sei, weil ich in Mainz keines gehabt hatte und mich nur sporadisch gemeldet hatte.
Somit war die Zeit bei meinem Vater zwar schön, aber auch äußerst anstrengend. Gott sei Dank konnte ihn seine Frau Hera, mit der ich mich hervorragend verstand, allmählich beruhigen. Schließlich sei ich alt genug und stark mit eisernem Willen, außerdem hätte ich ein großes Mundwerk, ich würde meinen Weg schon gehen. Mich könne man nicht unterkriegen. Oh, wie Recht sie hatte! Mein Sturkopf bestand zu 99% aus Stahlbeton, ich nahm mir immer, was ich wollte und konnte auch meinen Willen zu fast 100% durchsetzen. Und niemals, noch nie in meinem Leben habe ich eine einmal getroffene Entscheidung bereut, ich stand und stehe noch heute immer dazu. Es war damals richtig, dass ich ins Ausland gegangen bin. Abgesehen davon, man macht im Leben niemals Fehler, nur positive und negative Erfahrungen. Auch heute sage ich: „Was mich nicht umbringt, macht mich nur noch härter“. Nimm das Leben, wie es ist, und mach aus jeder Situation das Beste.
Auch die Tage bei meinem Herrn Papa neigten sich langsam aber sicher dem Ende zu. Natürlich gab es auch hier wieder Tränen, die meinerseits schnell wieder trockneten, denn mit einem Tränennebel vor den Augen fährt es sich relativ schlecht Auto. Ich musste schließlich jetzt zu meiner letzten Abschiedsstation noch eine ordentliche Strecke fahren. Es ging nach Stuttgart, wo meine Freundin Cora derzeit bei ihrem Freund Marcus Urlaub machte und das eventuelle Zusammenleben übte.
Es war der 28. April und schon am 30. sollte ich in dem kleinen Ort in der Nähe von Basel eintreffen. So kurz davor wurde mir jetzt doch langsam etwas mulmig und meine Gedanken fingen an, Achterbahn zu fahren. War alles wirklich richtig, was ich tat? Konnte, wollte ich zurück? Nee, bloß nicht! Diese Blöße würde ich mir nie und nimmer geben. Nein, die Würfel waren gefallen!
Auf nach Stuttgart.
Außerdem freute ich mich auch, Cora wiederzusehen. Bei der Abschiedsparty in Mainz hatte sie nicht dabei sein können, da sie zu diesem Zeitpunkt bereits bei Marcus war.
Und es wurden noch zwei wunderschöne Tage. Wir lachten viel, tranken und weinten. Waren wir schließlich doch für ein paar Jahre richtig dicke Freundinnen gewesen, die sehr viel Spaß miteinander hatten. Aber was noch viel interessanter war, sie hatte Marcus eigentlich mir zu verdanken, denn ich hatte ihn seinerzeit quasi beim Knobeln an sie verloren. Wir hatten ihn bei einem gemeinsamen Urlaub in Südfrankreich auf einem Campingplatz kennengelernt. Leider hatten Cora und ich ihn gleichermaßen äußerst niedlich gefunden, und weil beste Freundinnen sich niemals um einen Mann prügeln, hatten wir um ihn geknobelt. Ich hatte verloren, sie gewonnen. Heute sind Cora und Marcus verheiratet und haben vier Söhne. Was aus einer Urlaubsliebe so alles werden kann!
Und dann war es so weit. Der nächste, schlimmste Abschied stand vor der Tür. Und dieser fiel mir auch am schwersten. Von nun an gab es wirklich kein Zurück mehr. Nur noch ein paar Stunden trennten mich von meinem neuen Leben. Wenn ich damals gewusst hätte, was mich erwartete, doch, ich glaube, ich wäre wieder den gleichen Weg gegangen.
Ciao Cora! Ciao Marcus!
See you later!
Dann war ich weg, die letzte Etappe. Ich musste jetzt zuerst nach Basel. Die grenzsanitäre Untersuchung stand an. Alle Ausländer, die zum Arbeiten neu in die Schweiz einreisten, mussten sich dieser Prozedur unterziehen. Es ging eigentlich nur darum, den Nachweis zu erbringen, dass man nicht an Tuberkulose oder an einer anderen ansteckenden Krankheit litt. Leider genügte selbst bei Pflegepersonal eine Bescheinigung des Haus- oder Amtsarztes vom Wohnort nicht.
Doch bevor es so weit war, musste ich zuerst mit meinem hoffnungslos überladenen Auto die Schweizer Grenze passieren. Die Überraschung des Zöllners stand ihm im Gesicht geschrieben. Da kam doch so ein junges Mädchen, immer noch total verheult, im durch die Last tiefergelegten VW-Käfer, das noch zuletzt reingequetschte Bügelbrett im Nacken, an seinem Grenzposten an. Fassungslos fragte er, ob ich Ware anzumelden oder etwas zu verzollen hätte. Meine Güte, er will doch jetzt nicht etwa, dass ich mein Auto auspacke? Ich hielt ihm Ausweis und Arbeitspapiere unter die Nase und nach eingehender Aufklärung über mein überladenes Fahrzeug ließ er mich endlich doch weiterfahren.
Nach einigem Suchen und vielem Nachfragen traf ich dann auch noch rechtzeitig vor der Mittagspause bei der grenzsanitären Untersuchung ein. Nach erfolgreicher Anmeldung hieß es erst einmal, sich in Geduld zu üben, ich war ja nicht die Einzige, die an diesem Tag eingereist war.
Aber auch die längste Wartezeit ging irgendwann vorüber und so konnte ich mich denn auch am frühen Nachmittag auf den Weg zu meinem neuen Arbeitsort machen. Meinen Abschiedsschmerz hatte ich mit dem Grenzübertritt in Deutschland zurückgelassen. Jetzt war es geschafft, ich konnte mich in eine neue, ungewisse Zukunft stürzen. Ich fühlte mich stolz, dass ich diesen Schritt gemacht hatte, und gleichzeitig war ich ein leeres Blatt, das nur darauf wartete, endlich beschrieben zu werden.
Der Sprung ins Ungewisse war getan, ein neues, mein zweites Leben sollte beginnen!
2. Der Sprung ins Ungewisse – Beginn des zweiten Lebens
Nach meiner Ankunft im Spital meldete ich mich gleich bei der Pflegedienstleitung, welche mich sehr herzlich begrüßte. Ich bekam im naheliegenden Wohnheim für Angestellte ein kleines 1-Zimmer-Appartement zugewiesen und auch die ersten Informationen bezüglich Dienstplan, Arbeitsantritt für den nächsten Tag. Dann war ich erst einmal entlassen.
Zu tun hatte ich für diesen Tag noch genug, Auto auspacken, meinen Kram einräumen und auch noch ein bisschen was zu essen kaufen. Gesagt, getan. Und schon war es Abend. Ach ja, nicht vergessen, Zeit umstellen, damit ich am nächsten Morgen pünktlich zur Arbeit erscheinen konnte. Damals hatte die Schweiz noch nicht die Sommerzeit eingeführt. Langsam wurde ich auch müde, es war ein langer, anstrengender Tag mit vielen neuen Eindrücken. Aber ich war auch nervös, was würde mich morgen erwarten?
Der erste Tag.
Wie sich herausstellte, war ich nicht die einzige Neue, die am 1. Juni diesen Jahres hier zu arbeiten anfangen sollte. Aber ich war die einzige Deutsche! Demzufolge wurde der Einführungsvortrag natürlich nicht auf Hochdeutsch, sondern im Schweizer Dialekt gehalten. Also, ich verstand kein einziges Wort. Diese Sprache, obwohl nur ein Dialekt, schien mir einfach nur lustig, etwas für Leute, die permanent unter einer Halsentzündung litten. Es war schon komisch, in einem fremden Land zu sein, niemanden zu kennen und dann die Sprache nicht zu verstehen. Aber ich war guter Dinge, dass sich das schnell ändern würde.
Wir bekamen das Spital gezeigt, vom Dach bis zum Keller und unsere Dienstausweise ausgehändigt, mit denen wir auch billig an der spitaleigenen Tankstelle tanken durften.
Die Personalumkleiden, die Cafeteria, die OP-Räume, alles in einem exklusiven Zustand, so etwas hatte ich in Deutschland noch nie gesehen. Das ganze Spital wirkte tatsächlich mehr wie ein Hotel denn ein Krankenhaus.
Im Laufe dieses Tages hatte ich mich ein wenig mit einer anderen neuen Krankenschwester angefreundet, sie gab sich Mühe, mit mir Deutsch zu sprechen, und wir beschlossen, nach diesem Einführungstag gemeinsam noch etwas zu unternehmen.
Da sie auch fremd hier war, sie kam aus Bern, wollten wir uns in der Stadt ein wenig umschauen und dann gemütlich essen gehen.
Ich erfuhr, dass sie für den nächsten Tag auf der Chirurgischen Abteilung zum Frühdienst eingeteilt war, während ich auf der Wöchnerinnenstation meinem Einsatz entgegenfieberte.
Wir hatten einen amüsanten Abend, ich schüttelte mich häufig vor Lachen, weil ich mit dieser Sprache meine liebe Not hatte. Woher sollte ich wissen, dass „go poschte“ nichts mit der „Post“ zu tun hatte, sondern einfach nur „einkaufen“ hieß? Aber auch nur hier im Kanton Aargau. Ein paar Kilometer weiter, im Kanton Basel, sagte man „kommisione mache“.
Am nächsten Morgen stand ich pünktlich um 7.00 Uhr auf Station. Wie auch die nächsten Tage bemühte ich mich, mir alles rund um den Tagesablauf zu merken. Das war für mich nicht immer einfach, da ich mit der Sprache Probleme hatte, die Medikamente nicht kannte, kurz, ich kam mir völlig hilflos und dumm vor.
Zu allem Übel machte ich auch gleich am zweiten Tag die Erfahrung, dass man als Deutscher in der Schweiz nur ein „cheibe Düütsche“ war. Ich wollte einer Patientin beim Aufstehen behilflich sein und wurde gleich mit „von ener cheibe Düütsche lan ich mich nöt pflege!“ zurechtgestutzt.
Paff ...das war meine erste verbale Ohrfeige und ich bekam eine ganz kleine Vorahnung von dem, was mich hier in Zukunft als Ausländer erwarten würde. Und was lernte ich daraus? Richtig! Schwyzer Düütsch! So sog ich denn begierig die neue Sprache in mich rein.
Ich lernte, dass ein „Buschi“ ein Baby ist. Dass man dem Buschi einen Schoppen gibt – Schoppen? Also dort, wo ich herkam, war das ein Viertel Wein; nein, hier war das eine Flasche Milch. Ha, ha. Und „de Hafe go hole“ heißt auf Deutsch „den Topf holen“. Ein „Iklemmts“ oder „Chanape“ stellte sich als belegtes Brötchen heraus. Und „znüni“ ist die Frühstückspause. Eine „Stange“ ist ein Glas Bier. Ich weiß nicht mehr, wie oft mir in der Anfangszeit vor Lachen das Make-up verflossen ist, aber ich habe diese Sprache gelernt! Zwar mit Akzent, aber ich konnte perfekt auch ohne Halsweh „Chäsküechli“ und „Chuchichäschtli“ sagen.
Ansonsten waren eigentlich alle Schwestern und Ärzte auf der Station sehr nett. Das Arbeiten machte richtig viel Spaß, es war tatsächlich nicht so hektisch wie in Deutschland, nein, hier gab es genug Personal und man arbeitete langsamer und in Ruhe. So wie Schweizer eben sind.
Nur mit dem „neue Freunde finden“ hatte ich ein Problem. Als echtes „Määnzer Mädche“ war ich sehr aufgeschlossen und kontaktfreudig. Diese Eigenschaften teilten die Schweizer nicht unbedingt mit mir. Alle waren nett, aber auch nicht mehr. Man kam als Ausländer nicht näher an sie heran. Sie ließen keine „Usländer“ in ihre Kreise. Das sollte sich auch während meiner 16 Jahre in diesem Land leider auch nicht ändern.
Ich lernte Mary kennen. Sie war Schottin und arbeitete als Hebamme im Gebärsaal. Wir freundeten uns an und unternahmen ab und zu etwas gemeinsam. Manchmal schloss sich auch ihr Mann Charles an und zu dritt hatten wir viel Spaß, zumal beide nicht richtig Deutsch konnten und meine Englisch/Schottisch-Kenntnisse auch nicht perfekt waren. Aber durch die beiden wurde ich in die Geheimnisse des Whiskys eingeführt, Malt-Whisky und so weiter …. Ihr wisst schon.
Eines Tages stand dann, ohne dass wir Schwestern auf unserer Station darüber informiert worden wären, eine neue Kollegin mit der Pflegedienstleitung zum Frühdienst parat. Es wurde nur kurz mitgeteilt, dass sie ein polnischer Flüchtling mit wenig Deutschkenntnissen sei und wohl auch in ihrem Heimatland als Krankenschwester gearbeitet hatte. Wir sollten uns um sie kümmern und schauen, wie weit sie einsetzbar und arbeitsfähig sei.
Alles klar, nur, in welcher Sprache? Helena, so war ihr Name, konnte tatsächlich so gut wie kein Deutsch und verstand von Wochenbettpflege gemäss Schweizer Niveau etwa so viel wie ein Metzger vom Kuchen backen.
Trotzdem freundeten wir uns an. Mit Händen und Füßen erzählte sie von ihrer Heimat, ihren Freunden, ihrem Mann Lukasz, von ihrer Flucht aus Polen und dass sie jetzt darauf warteten, den Status eines anerkannten Flüchtlings hier in der Schweiz zu bekommen.
Im Laufe der nächsten Wochen lernte Helena schnell, auch durch meine Mithilfe, mit der deutschen Sprache halbwegs klarzukommen und beim Arbeiten ihre Krankenpflegekenntnisse einzubringen.
An einem grauenhaften Samstagnachmittag im August, es war der 16., es regnete in Strömen und ich war müde vom Frühdienst, bat Helena mich, nachdem wir uns umgezogen hatten, mit den Worten „Du hier warten auf mein Mann, du nix vorhaben heute?“ noch mit in die Cafeteria zu kommen. Ich wusste zwar nicht, worum es ging und was das sollte, aber da ich nichts vorhatte und ein einsamer Abend in meinem kleinen Appartement auch nicht unbedingt reizvoll war, stapfte ich ihr tapfer hinter her.
So lernte ich Lukasz kennen, Helenas Mann. Ein Bär von einem Mann! Circa 185 cm groß, fast genauso breit, Vollbart und ein lustiges Lachen. Deutschkenntnisse, na ja, etwas besser als die von Helena, schließlich käme er aus Schlesien, dort spräche man noch ein bisschen Deutsch, erklärte er mir. Die beiden luden mich auf eine Party bei einem Freund ein, damit ich nicht einsam sein müsse. Wir müssten jetzt nur noch auf einen anderen Freund warten, der sich auf Parkplatzsuche befand.
Das hieß, noch schnell eine Zigarette rauchen und einen Kaffee trinken, um die Lebensgeister zu wecken. Und dann Party!
Zwar hatte ich keine Ahnung, wie, wo und in welcher Sprache – logischerweise hatte ich in Polnisch noch weniger Kenntnisse als eine Kuh in Englisch – aber egal, es würde schon irgendwie gehen, Hauptsache nicht allein im Zimmer hocken.
Auf einmal gab es einen Schlag, Blitz, Donner, Erdbeben!
Mir wurde Bartek vorgestellt!
Schicksal!
Bartek war der ehemalige Verlobte von Helena und mittlerweile gut mit ihr und ihrem Mann befreundet.
Nun sollten wir uns gemeinsam aufmachen und mit dem Auto zu einem anderen Freund fahren, der die Party organisiert hatte. So weit, so gut. Ich lernte noch Jazek und Margareta kennen, Jazek war Helenas Cousin und, wie alle anderen auch, in der Warteschleife, um politisches Asyl in der Schweiz zu bekommen.
Es wurde ein feucht-fröhlicher Abend, obwohl ich kein Wort verstand. Lukasz versuchte, mir auf Polnisch das Fluchen beizubringen und nach einigen Wodkas klappte das dann auch ganz gut. Und doch war Bartek der Einzige, der sich Mühe gab, eine Unterhaltung auf Deutsch mit mir zu führen. Ich war sehr dankbar dafür, denn sonst hätte ich mich schon ein bisschen verloren gefühlt. Wir verstanden uns auch prächtig, soweit man das mangels Sprachkenntnissen sagen kann. Unter viel Gelächter, mit Händen und Füßen, schilderten wir uns in Kurzfassung unsere Lebensläufe.
Irgendwann in der darauffolgenden Woche muss es dann passiert sein: Irgendwie instinktiv wusste ich, ich wollte Bartek heiraten. Warum? Wieso? Keine Ahnung. Ich wusste einfach, dass er der Richtige war. Ich war 23 Jahre alt, ich war nicht schwanger, ich konnte kein Polnisch, Bartek konnte kaum Deutsch, Wahnsinn, verrückt; wir kannten uns erst ein paar Tage. Trotzdem.