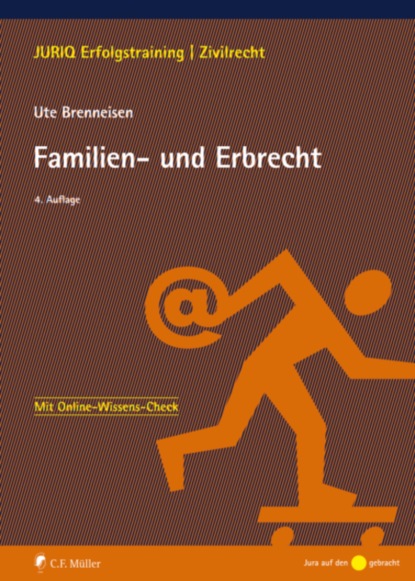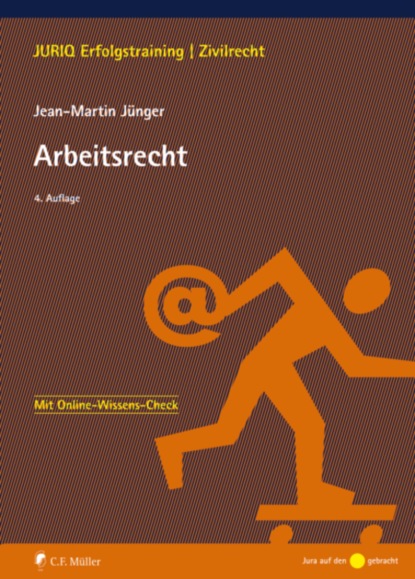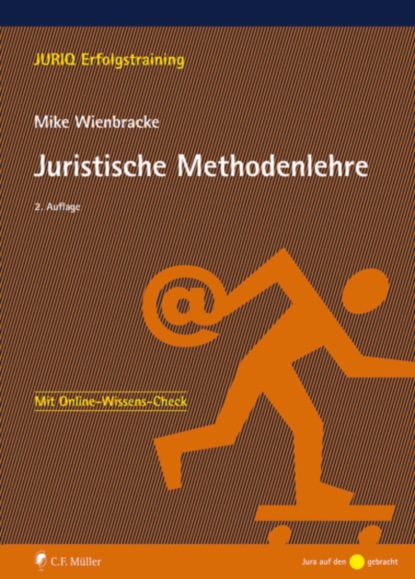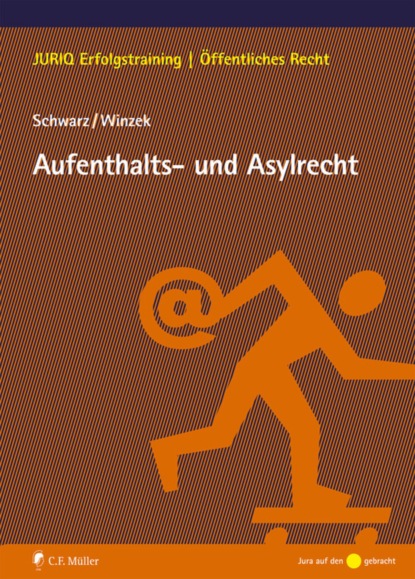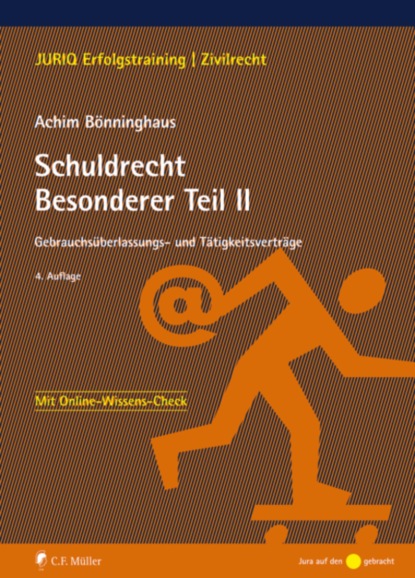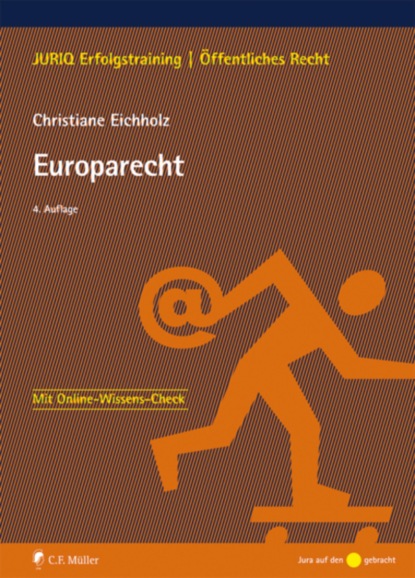- -
- 100%
- +
115

Die Vorschrift des § 1369 bezieht sich nach seinem Wortlaut zudem nur auf Rechtsgeschäfte, die ein Ehegatte über die ihm gehörende Haushaltsgegenstände vornimmt. Umstritten ist, ob diese Norm nach ihrem Schutzweck auch auf Verträge auszudehnen ist, die ein Ehegatte über gemeinsam gehörende Haushaltsgegenstände oder über nur im Eigentum des anderen Ehegatten stehende Haushaltsgegenstände abschließt. Eine analoge Anwendung des § 1369 auf diese Fälle hat nur Bedeutung, wenn ein gutgläubiger Erwerb eines Dritten nicht schon an §§ 932, 935 scheitert. Wegen des Mitbesitzes des anderen Ehegatten wird § 935 einen gutgläubigen Erwerb des Dritten in der Regel verhindern. Die Vorschrift des § 935 greift indes dann nicht ein, wenn der veräußernde Nichteigentümer Alleinbesitzer war. In diesen Fällen wendet die h.M.[28] die Vorschrift des § 1369 analog an.
c) Revokationsrecht, § 1368
116
Verfügt ein Ehegatte ohne die erforderliche Zustimmung des anderen Ehegatten über sein Vermögen, kann nach § 1368 auch der andere Ehegatte die Rechte (§§ 985, 894) gerichtlich geltend machen, die sich aus der Unwirksamkeit der Verfügung gegen den Dritten ergeben (revokatorische Klage). Der Ehegatte kann auch eine Klage auf Feststellung nach § 256 ZPO erheben, dass die Verfügung unwirksam ist. Umstritten ist, ob auch die Unwirksamkeit eines Verpflichtungsgeschäfts nach § 812 Abs. 1 S. 1 Alt. 1 von dem revozierenden Ehegatten geltend gemacht werden kann.[29] Dagegen spricht der Wortlaut des § 1368, wonach nur Ansprüche wegen der Unwirksamkeit einer Verfügung geltend gemacht werden können.[30]
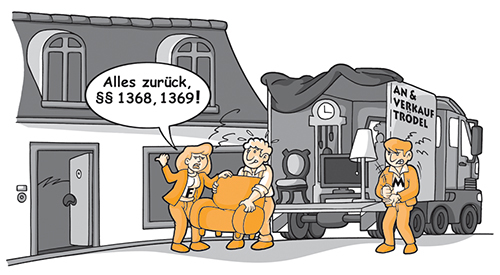
[Bild vergrößern]
117
Durch § 1368 erhält der andere Ehegatte keinen eigenen Anspruch, er ist lediglich berechtigt, die Ansprüche des verfügenden Ehegatten im eigenen Namen prozessual geltend zu machen. Bei der Vorschrift des § 1368 handelt sich nach h.M.[31] um eine gesetzliche Prozessstandschaft.[32] Daraus folgt, dass der revozierende Ehegatte nur Herausgabe an den anderen Ehegatten verlangen kann, sofern er nicht Mitbesitzer gewesen ist. Der Schutzzweck der §§ 1365, 1369 erfordert es jedoch, dass er Herausgabe an sich verlangen kann, wenn der verfügende Ehegatte sich weigert, die Sache an sich zu nehmen.[33] Das folgt aus dem in §§ 986 Abs. 1 S. 2, 869 S. 2 enthaltenen Rechtsgedanken.
Hinweis
Die Klage eines Ehegatten entfaltet nach h.M.[34] hinsichtlich der Rechtshängigkeit und der formellen Rechtskraft keine Wirkung gegenüber dem anderen Ehegatten. Bei den Rechten der Ehegatten handelt es sich um selbständige Rückforderungsrechte mit Schutzcharakter, die in Frage gestellt werden würden, wenn ein Ehegatte durch eine schlechte Prozessführung dem anderen seinen Rückforderungsanspruch vereiteln könnte. Ein obsiegendes Urteil hat jedoch materielle Rechtskraftwirkung, so dass in einem nachfolgenden Rechtstreit des anderen Ehegatten nicht anders entschieden werden kann. Der andere Ehegatte behält jedoch die Möglichkeit, selbst zu klagen, um seine Zwangsvollstreckung durchführen zu können.
118
Hat der Dritte seinerseits gegen den verfügenden Ehegatten Ansprüche aus Bereicherung, weil er im Austausch für den Verfügungsgegenstand eine Gegenleistung erbracht hat, so steht ihm nach h.M.[35] gegenüber der Revokationsklage kein Zurückbehaltungsrecht zu. Das wird darauf gestützt, dass es mit dem im Interesse der ehelichen Lebensgemeinschaft geschaffenen Revokationsrecht nicht vereinbar sei, dass der Dritte durch die Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechts die Rechtsfolgen des unwirksamen Verfügungsgeschäfts aufrechterhalten könne. Wegen dieses Rechtsgedankens steht dem Dritten auch kein Zurückbehaltungsrecht gegenüber dem verfügenden Ehegatten zu.
119
Allerdings schließen die Vorschriften der §§ 1365, 1368 nicht aus, dass der Dritte wegen seiner Gegenansprüche die Aufrechnung erklärt, wenn der andere Ehegatte einen revokatorischen Zahlungsanspruch gerichtlich gegen ihn geltend macht.[36] Gestützt wird dies darauf, dass die Vorschriften der §§ 1365, 1368 keinen umfassenden Schutz gegen Vermögensminderungen des Ehegatten gewähren. Der Dritte ist nicht gehindert, in das Vermögen des verfügenden Ehegatten zu vollstrecken, wenn er einen Titel über seine Rückzahlungsansprüche erwirkt hat. Die Möglichkeit der Aufrechnung stellt lediglich eine einfachere Befriedigungsmöglichkeit dar, die durch § 1365 nicht ausgeschlossen wird.
Hinweis
Dem Dritten kann gegenüber dem verfügenden Ehegatten ein Schadensersatzanspruch aus § 823 Abs. 2 i.V.m. § 263 StGB, bzw. § 826 oder aus c.i.c. (§§ 311 Abs. 2, 280) zustehen, wenn ihm bei Vertragsschluss von dem Ehegatten vorgespiegelt worden ist, dass er nicht verheiratet ist oder im Güterstand der Gütertrennung lebt bzw. die Genehmigung des anderen Ehegatten vorliegt. Der Schadensersatzanspruch ist auf das negative Interesse begrenzt, d.h. der Dritte kann nur verlangen so gestellt zu werden, als wäre der Vertrag nicht abgeschlossen worden.[37]
d) Übungsfall Nr. 2
120
„Augen auf beim Hausverkauf“
M und F sind seit 10 Jahren im Güterstand der Zugewinngemeinschaft verheiratet. F veräußert ein in ihrem Alleineigentum stehendes Grundstück zu einem Kaufpreis von 100 000 € an K. F verfügt neben dem Grundstück noch über ein Barvermögen von 1000 €. Nachdem K im Grundbuch als Eigentümer eingetragen worden war, erfährt M davon, dass F ihr Grundstück veräußert hat. Er verlangt von K die Rückgängigmachung des Kaufvertrags, da er mit dem Verkauf des Grundstücks nicht einverstanden gewesen sei. K erwidert, er habe nicht gewusst, dass die F verheiratet sei. Im Übrigen seien ihm auch nicht ihre Vermögensverhältnisse bekannt gewesen. Kann M die Rückgängigmachung des Kaufvertrags im Rahmen einer gegen K erhobenen Klage verlangen?
(Anmerkung: Dem Sachverhalt liegt die Entscheidung des BGH[38] zugrunde.)
121
Lösung
M kann die Rückgängigmachung des Kaufvertrags von K verlangen, wenn seine Klage zulässig und begründet ist.
A. Zulässigkeit der Klage
Die Klage des M ist nur dann zulässig, wenn er für die Geltendmachung der Ansprüche prozessführungsbefugt ist. Die Prozessführungsbefugnis könnte sich vorliegend aus § 1368 ergeben. Danach kann ein Ehegatte solche Rechte geltend machen, die sich aus der Unwirksamkeit einer Verfügung des anderen Ehegatten nach § 1365 ergeben (Revokationsrecht). Das Revokationsrecht des anderen Ehegatten bewirkt nach § 1368 eine gesetzliche Prozessstandschaft, wonach der andere Ehegatte die sich aus der Unwirksamkeit einer Verfügung ergebende Rechte für den verfügenden Ehegatten im eigenen Namen gerichtlich geltend machen kann.[39]
B. Begründetheit der Klage
Die Klage ist begründet, wenn F ein Anspruch auf Rückgängigmachung des Kaufvertrags hat. Das setzt nach § 894 voraus, dass das Grundbuch durch die Eintragung des K als Eigentümer unrichtig ist. Eine Unrichtigkeit des Grundbuchs ist gegeben, wenn die formelle und die materielle Rechtslage auseinanderfallen.
I. Formelle Rechtslage
Im Grundbuch ist K als Eigentümer des Grundstücks eingetragen.
II. Materielle Rechtslage
K könnte das Eigentum an dem Grundstück von F gemäß §§ 873 Abs. 1, 925 Abs. 1 S. 1 durch Auflassung und Eintragung erworben haben. Die Auflassung und die Eintragung sind erfolgt. Bedenken gegen ihre Wirksamkeit können sich gemäß § 1365 Abs. 1 S. 2 daraus ergeben, dass F ohne Zustimmung des M bei der Veräußerung des Grundstücks über ihr Vermögen als Ganzes verfügt hat.
1. Anwendbarkeit von § 1365 Abs. 1
Die Vorschrift des § 1365 greift nur ein, wenn der Verfügende im gesetzlichen Güterstand der Zugewinngemeinschaft gelebt hat und die sich daraus ergebenden Verfügungsbeschränkungen nicht von den Ehegatten in einem Ehevertrag ausgeschlossen worden sind, §§ 1363 Abs. 1, 1408 Abs. 1. Das ist hier der Fall, da M und F die Vorschrift des § 1365 nicht abbedungen haben und in der Zugewinngemeinschaft gelebt haben.
2. Verfügung über das Vermögen im Ganzen
Nach dem Wortlaut des § 1365 erfasst die Vorschrift nur Verfügungen über das Vermögen im Ganzen. Vorliegend hat F nur über einen einzelnen Vermögensgegenstand verfügt. Nach h.M. wird die Vorschrift des § 1365 dahin erweitert, dass auch eine Verfügung über einen einzelnen Gegenstand zustimmungsbedürftig ist, wenn der betroffene Gegenstand das gesamte oder nahezu das gesamte Vermögen ausmacht (Einzeltheorie). Hierfür spricht der Zweck des § 1365, der neben der Sicherung eines möglichen Zugewinnausgleichsanspruchs die wirtschaftliche Lebensgrundlage der Ehe sichern soll. Beides kann durch eine Verfügung über einen einzelnen Gegenstand gleichermaßen gefährdet werden, wenn der Einzelgegenstand das gesamte Vermögen oder nahezu das gesamte Vermögen ausmacht. Daran fehlt es zwar, wenn dem Verfügenden ein Restvermögen von 15 % des ehemaligen Gesamtvermögens verbleibt.[40] Bei größeren Vermögen ab etwa 25 000 € zieht die Rechtsprechung die Grenze bei einem Vermögen von 10 % des ehemaligen Gesamtvermögens.[41]
Dabei können dingliche Belastungen Wert mindernd berücksichtigt werden. Unberücksichtigt bleiben hingegen nach h.M. etwaige Gegenleistungen des Vertragspartners, auch wenn diese einen gleichwertigen Ausgleich darstellen.[42] Vorliegend verbleibt der F nach der Verfügung über das Grundstück nur ein Restvermögen von 1000 €. Gemessen an dem anfänglichen Gesamtvermögen von 101 000 € beträgt das Restvermögen weniger als 10 %. F hat daher durch die Veräußerung ihres Grundstücks nahezu über ihr gesamtes Vermögen verfügt.
3. Subjektive Einschränkung des § 1365
Die Vorschrift des § 1365 findet nach der subjektiven Einzeltheorie nur dann Anwendung, wenn K positive Kenntnis davon gehabt hat, dass es sich bei dem Grundstück nahezu um das gesamte Vermögen der F gehandelt hat.[43] Die Darlegungs- und Beweislast für die Kenntnis des Vertragspartners trägt derjenige, der sich auf die Unwirksamkeit der Verfügung nach § 1365 beruft. Das ist in der Regel der nicht verfügende Ehegatte.[44] Vorliegend hat K die Vermögensverhältnisse der F nicht gekannt. Er hatte daher auch keine Kenntnis davon, dass das an ihn veräußerte Grundstück nahezu das gesamte Vermögen der F darstellt. Mangels einer entsprechenden positiven Kenntnis des K war die Verfügung der F nicht zustimmungsbedürftig i.S.v. § 1365. Die F hat daher wirksam über das Grundstück verfügt. K ist daher gemäß §§ 873, 925 durch Auflassung und Eintragung Eigentümer des Grundstücks geworden. Die Voraussetzungen eines Grundbuchberichtigungsanspruchs nach § 894 sind daher nicht gegeben, da die materielle Rechtslage nicht von der formellen Rechtslage abweicht.
III. Ergebnis
Die zulässige Klage des M ist unbegründet, da er von K nicht die Rückgängigmachung des Kaufvertrags verlangen kann.
3. Zugewinnausgleich
122
Wegen des Zugewinnausgleichs von Todes wegen siehe ausführlich unter Rn. 298 ff.
Der Zugewinn, den die Ehegatten in der Ehe erzielen, wird nach § 1363 Abs. 2 S. 2 ausgeglichen, wenn die Zugewinngemeinschaft endet. Der Ausgleich des Zugewinns beruht auf der Erwägung, dass jeder Ehegatte an dem teilhaben soll, was die Ehegatten während des Güterstands im Rahmen einer arbeitsteiligen Zusammenarbeit erworben haben. Der Ausgleich des Zugewinns erfolgt zu Lebzeiten der Ehegatten im Fall der Scheidung (§§ 1564 ff.) oder bei Aufhebung der Ehe (§§ 1313 ff.) bzw. bei Aufhebung des gesetzlichen Güterstands durch Ehevertrag, §§ 1385, 1386. Erfolgt die Beendigung der Zugewinngemeinschaft zu Lebzeiten der Ehegatten, so wird der Zugewinn nach der güterrechtlichen Lösung ausgeglichen, §§ 1372 bis 1390. Dem ausgleichsberechtigten Ehegatten steht eine Ausgleichsforderung aus § 1378 Abs. 1 zu. Wird die Zugewinngemeinschaft durch den Tod eines Ehegatten beendet, vollzieht sich der Zugewinnausgleich gemäß § 1371 Abs. 1 i.V.m. § 1931 Abs. 3 nach der sog. erbrechtlichen Lösung.
a) Berechnung der Ausgleichsforderung
123
Ausgleichsanspruch aus § 1378 Abs. 1
I. Anspruchsentstehung
1.Ehe mit Güterstand der Zugewinngemeinschaft
2.Beendigung der Zugewinngemeinschaft zu Lebzeiten der Ehegatten
3.Umfang
a)Hälftiger Zugewinnüberschuss des Anspruchsgegners
aa)Zugewinn des Gegners nach §§ 1373 ff.
bb)abzüglich des Zugewinns des Anspruchstellers nach §§ 1373 ff.
cc)verbleibender Zugewinnüberschuss des Gegners?
dd)Halbierung des generischen Überschusses
b)Begrenzung gem. § 1378 Abs. 2
c)Anrechnung von Vorausempfängen, § 1380 Abs. 1
II. Rechtsvernichtende Einwendungen (insbes. §§ 362 ff. )
III. Durchsetzbarkeit
1.Fälligkeit
2.Einreden
aa) Ausgangsformel
124
Der Zugewinn ist nach der Legaldefinition des § 1373 der Betrag, um den das Endvermögen (§ 1375) eines Ehegatten dessen Anfangsvermögen (§ 1374) übersteigt.
Hinweis
Der Zugewinn wird also wie folgt berechnet:
Zugewinn (§ 1373) = Endvermögen (§ 1375) – Anfangsvermögen (§ 1374)
125
Hat ein Ehegatte einen größeren Zugewinn erzielt, so hat derjenige mit dem geringeren Zugewinn gegen den anderen einen schuldrechtlichen Ausgleichsanspruch auf Zahlung der Hälfte des Überschusses § 1378 Abs. 1.
Beispiel
Ehemann Ehefrau Anfangsvermögen 10 000 € 30 000 € Endvermögen 100 000 € 60 000 € Zugewinn 90 000 € 30 000 €Ausgleichsanspruch: Zugewinn Ehemann von 90 000 € – Zugewinn Ehefrau von 30 000 € = 60 000 € : 2 = 30 000 €.
Der Ausgleichsanspruch der Ehefrau beträgt damit 30 000 €.
Hinweis
Die Höhe des Ausgleichsanspruchs berechnet sich damit wie folgt:
(Höherer Zugewinn – niedriger Zugewinn) : 2 = Höhe des Ausgleichsanspruchs
126
Ist das Endvermögen eines Ehegatten geringer als sein Anfangsvermögen, so findet kein Verlustausgleich statt. Wegen des in § 1373 enthaltenen Gesetzeswortlauts „übersteigt“ kann der Zugewinn nicht negativ sein[45].
Beispiel
Ehemann Ehefrau Anfangsvermögen 30 000 € 30 000 € Endvermögen 10 000 € 60 000 € Zugewinn 0 € 30 000 €Ausgleichsanspruch: Zugewinn der Ehefrau von 30 000 € – Zugewinn des Ehemanns von 0 € = 30 000 € : 2 = 15 000 €.
Der Zugewinnanspruch des Ehemannes beträgt damit 15 000 €.
bb) Anfangsvermögen
127
Für die Ermittlung des Zugewinns ist zunächst das jeweilige Anfangs- und Endvermögen zu ermitteln. Nach §§ 1377 Abs. 2, 1035 S. 3 kann jeder Ehegatte von dem anderen Ehegatten verlangen, dass ein Inventar über das Anfangsvermögen durch einen Notar aufgenommen wird. Diese Verpflichtung ist eine unvertretbare Handlung, die nach § 120 FamFG, § 888 ZPO vollstreckt werden kann.
128
Anfangsvermögen ist nach § 1374 das Vermögen, das einem Ehegatten nach Abzug der Verbindlichkeiten bei Eintritt des Güterstands gehört. Soweit die Ehegatten keinen Ehevertrag geschlossen haben, ist in der Regel der Zeitpunkt der Eheschließung für den Eintritt des Güterstands maßgebend. Haben die Ehegatten im Zeitpunkt der Eheschließung im Rahmen eines Ehevertrages Gütertrennung vereinbart und heben sie im Laufe der Ehe den vereinbarten Güterstand durch einen weiteren Ehevertrag wieder auf, indem sie den gesetzlichen Güterstand vereinbaren, ist für das Anfangsvermögen auf den Zeitpunkt des Abschlusses des zweiten Ehevertrages abzustellen.
(1) Aktivvermögen
129
Zu den zu berücksichtigenden Aktiva zählen alle dem Ehegatten am Stichtag zustehenden rechtlich geschützten Positionen von wirtschaftlichem Wert, d.h. also neben den einem Ehegatten gehörenden Sachen alle ihm zustehenden objektiv bewertbaren Rechte, die bei Eintritt des Güterstandes bereits bestanden haben.[46] Dazu gehören unter anderem auch geschützte Anwartschaften mit ihrem gegenwärtigen Vermögenswert sowie vergleichbare Rechtspositionen, die einen Anspruch auf eine künftige Leistung gewähren, sofern diese nicht mehr von einer Gegenleistung abhängig und nach wirtschaftlichen Maßstäben (notfalls durch Schätzung) bewertbar sind.[47]
130
Nicht zum Anfangsvermögen gehören alle vor dem Stichtag begründeten Rechts- und Dauerschuldverhältnisse, die Ansprüche auf künftig fällige, wiederkehrende Einzelleistungen (Arbeitsentgelt, Besoldung, Unterhaltsleistungen) begründen. Ein güterrechtlicher Ausgleich findet ebenfalls nicht statt, soweit eine Vermögensposition bereits auf andere Weise ausgeglichen wird.[48] Auch Hausrat, der nach §§ 1568a ff. verteilt wird, und Anwartschaften, die durch den Versorgungsausgleich ausgeglichen werden, fallen nicht in das Anfangsvermögen.
131
Die Wertermittlung des Anfangsvermögens erfolgt nach §§ 1376 Abs. 1. Danach wird bei der Berechnung des Anfangsvermögens der Wert zugrunde gelegt, den das Vermögen im Zeitpunkt des Eintritts in den Güterstand hatte. Für den Wert des Vermögens, das dem Anfangsvermögen zuzurechnen ist, ist der Zeitpunkt des Erwerbs maßgebend.
(2) Verbindlichkeiten
132
Vom Wert des Aktivvermögens sind alle am Stichtag vorhandenen Verbindlichkeiten aller Art abzuziehen, also sowohl öffentlich-rechtliche wie private Schulden, Steuern und Abgaben, wie private Lasten. Die Verbindlichkeiten müssen am Stichtag schon entstanden, aber noch nicht fällig sein.[49]
Hinweis
Bis zum 30.8.2009 war durch § 1374 Abs. 1. Hs. 2 die Abzugsfähigkeit der Verbindlichkeiten beschränkt auf die Höhe des Aktivvermögens. Das Anfangsvermögen konnte daher nur den Wert Null haben. Damit wurde bezweckt, dem Ausgleichsschuldner beim Zugewinnausgleich mindestens die Hälfte seines Zugewinns zu belassen.[50] Nach Art. 229 § 20 Abs. 2 EGBGB gilt die alte Rechtslage weiter, wenn der Scheidungsantrag vor dem 1.9.2009 anhängig gemacht wurde. Das Gesetz zur Änderung des Zugewinnausgleichs- und Vormundschaftsrechts vom 6.7.2009[51] hat die Beschränkung der Abzugsfähigkeit von Verbindlichkeiten beseitigt; es wurde § 1374 Abs. 1 Hs. 2 aufgehoben und in dem neu eingefügten § 1374 Abs. 3 klargestellt, dass Verbindlichkeiten über die Höhe des Anfangsvermögens hinaus abgezogen werden können. Als Konsequenz des Halbteilungsgrundsatzes wird daher nunmehr für die Berechnung des Zugewinnausgleichs auch ein negatives Anfangsvermögen berücksichtigt. Verbindlichkeiten sind bei der Berechnung des Anfangsvermögens abzuziehen, sofern sie am Stichtag bereits vorhanden waren. Auf deren Fälligkeit kommt es nicht an.[52] Auch wenn sich dadurch an den Haftungsverhältnissen im Außenverhältnis nichts ändert, wird damit der wirtschaftliche Erfolg aus der Ehezeit zur Hälfte auf die Ehegatten verteilt.[53]
Beispiel
Der Ehemann hat im Zeitpunkt der Eheschließung Schulden in Höhe von 200 000 €. Das Anfangsvermögen der Ehefrau beträgt 5000 €. Während der Ehezeit tilgt der Ehemann seine Verbindlichkeiten und hat im Zeitpunkt der Scheidung ein Endvermögen von 0 €. Die Ehefrau verfügt über ein Endvermögen in Höhe von 20 000 €. Nach altem Recht hätte der Ehemann gegen die Ehefrau einen Anspruch auf Zugewinnausgleich in Höhe von 7500 € (20 000 € [Endvermögen] – 5000 € [Anfangsvermögen] = 15 000 € : 2) gehabt. Dieses Ergebnis wurde als ungerecht empfunden, weshalb § 1374 Abs. 1 Hs. 2 gestrichen wurde. Stattdessen bestimmt § 1374 Abs. 3, dass Verbindlichkeiten auch über die Höhe des Vermögens hinaus abgezogen werden können, so dass das Anfangsvermögen auch negativ sein kann. Danach beträgt der Zugewinn des Ehemannes 200 000 €, da er während der Ehezeit Verbindlichkeiten in dieser Höhe getilgt hat. Der Ehefrau stünde daher ein Zugewinnausgleich in Höhe von 92 500 € (200 000 € [Zugewinn des Mannes] – 15 000 € [Zugewinn der Frau] = 185 000 € : 2) zu. Der Ausgleichanspruch der Ehefrau ist nach § 1378 Abs. 2 S. 1 indes auf die Hälfte des Vermögens beschränkt, über das der Ehemann am Stichtag verfügt. Da dieses im Beispielsfall 0 € beträgt, steht der Ehefrau kein Zugewinnausgleich zu. Im Gegensatz zur alten Regelung steht in diesem Fall aber auch dem Ehemann gegenüber der Ehefrau kein Zugewinnausgleich zu.
133
Während nach der alten Rechtslage jeder Ehegatte die Höhe seines Anfangsvermögen beweisen musste, wird nunmehr nach § 1377 Abs. 3 i.S.v. § 292 S. 1 ZPO gegenüber dem anderen Ehegatten widerlegbar vermutet, dass das Anfangsvermögen der Ehegatten null beträgt, wenn sie gemäß § 1377 Abs. 1, Abs. 2 kein Vermögensverzeichnis erstellt haben. Nach § 1379 Abs. 1 Nr. 2 steht jedem Ehegatten nach der Beendigung des Güterstands ein Auskunftsanspruch über die Höhe des Anfangsvermögens zu.
(3) Privilegiertes Vermögen
134