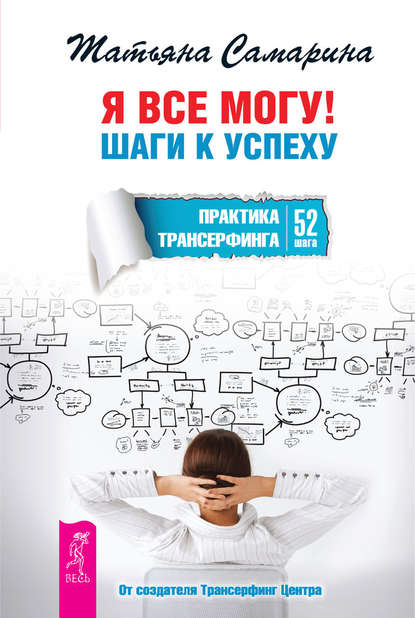Sergia - Sklaven des 22. Jahrhunderts

- -
- 100%
- +
Charles schloss die Augen, und atmete tief durch.
Keine Schwäche, predigte er sich noch einmal. Luke ist nicht mehr mein Neffe, er ist ein Sergia. Kein Individuum mit freiem Willen mehr, sondern Eigentum.
Als er seine Augen wieder öffnete, waren die drei Personen im Transporter verschwunden, nur Albert kauerte schluchzend in der Tür. Dieser Anblick half Charles, sein Mitgefühl für den Jungen zu verdrängen und Hass ergriff wieder Besitz von ihm. Er würde keine Unterschiede zwischen Luke und den anderen Sergia machen, nahm er sich vor. Dies wäre der erste Schritt zur Untergrabung seiner Autorität und das durfte er nicht zulassen.
Keine Schwäche, kein Mitgefühl. Regiere mit eiserner Hand.
Luke lag zitternd im Laderaum des kleinen, weißen Transporters. Die Supervisoren hatten seine Hände und Füße gefesselt, so dass er sich kaum noch rühren konnte. Weil er sich aus Leibeskräften gewehrt hatte, hatten sie ihm mit einem Schlagstock in die Magengrube geschlagen, bis er seine Gegenwehr aufgegeben hatte.
Luke hatte Angst und konnte nicht verstehen, was soeben geschehen war. Er hatte seinen geliebten Onkel kaum wieder erkannt. Er war so kalt gewesen, so unnahbar. Wie konnte er seinem eigenen Neffen nur so etwas antun?
War das etwa sein wahres Ich? Hatte er ihm und seinem Vater jahrelang den freundlichen Onkel Charly nur vorgespielt?
Tränen traten Luke in die Augen und er gab sich schluchzend seinem Kummer hin.
Der Transporter fuhr unterdessen weiter seinem unbekannten Ziel entgegen. Das monotone Rauschen der Räder auf dem Asphalt hatte etwas Beruhigendes. Langsam ließ Lukes Schluchzen nach und sein Atem wurde regelmäßiger.
Was würde nun wohl mit ihm geschehen?
Er hatte seinen Onkel oft gebeten, ihm von seinem Geschäftsimperium zu erzählen, ihm vielleicht sogar einmal eine seiner Farmen zu zeigen, aber Onkel Charly hatte sich stets geweigert, Luke mit dorthin zu nehmen.
So hatte Luke nur eine wage Vorstellung davon, wie es in einem Sergia-Lager wohl aussah.
In der ‚freien Welt‘ wurden die Sergia stets totgeschwiegen.
Es war ein Tabu-Thema, über das man nicht gerne sprach. So gab es auch keine Bilder vom Inneren der Lager und nur sehr lückenhafte Berichte.
Luke wusste nicht, wie lange sie unterwegs gewesen waren, es mochte wohl eine halbe Stunde gewesen sein, als der Transporter stoppte und der Motor erstarb. Er hatte kaum Zeit sich zu sammeln, als auch schon die Türen zum Laderaum aufgerissen wurden. Luke musste die Augen zusammen kneifen, als das grelle Sonnenlicht in sein dunkles Gefängnis fiel und er kauerte sich ängstlich in die hintere Ecke des Wagens.
Einer der beiden Supervisoren kletterte zu ihm, und löste die Fesseln an seinen Füßen.
»Aufstehen«, blaffte er Luke u an, und trat ihm gleichzeitig in die Seite.
Luke stöhnte vor Schmerz.
»Ich sagte: aufstehen«, wiederholte der Supervisor.
Bevor er noch einen weiteren Tritt ab bekam, rappelte Luke sich auf, und stieg ungelenk aus dem Transporter. Halb neugierig, halb ängstlich blickte er sich um.
Der Transporter stand in der Mitte eines großen, gepflasterten Hofs, der von hohen Mauern umgeben war. Die glatten Steinmauern waren gut fünf Meter hoch und auf ihrer Spitze war engmaschiger Stacheldraht gespannt. Zusätzlich waren in regelmäßigen Abständen Schilder mit der Aufschrift ‚Achtung Strom‘ angebracht.
Der Hof selbst war vollkommen kahl, es gab keinen einzigen Baum, nicht mal ein Grashalm lugte zwischen den Pflastersteinen hervor. Alles wirkte sehr bedrückend und Luke hatte das Gefühl, klein und schutzlos zu sein.
Hinter ihnen befand sich ein großes eisernes Tor. Luke nahm an, dass der Transporter dadurch in den Hof gefahren war.
Vor ihnen war ein dunkles Betongebäude mit vergitterten Fenstern. Alles wirkte wie ein Hochsicherheitsgefängnis.
In diesem Moment versetzte einer der Supervisoren Luke einen erneuten Stoß in den Rücken und Luke stolperte vorwärts.
»Na los«, knurrte er, »schlaf nicht ein.«
Sie führten, beziehungsweise stießen, Luke quer über den Hof, bis sie schließlich das Gebäude erreicht hatten. Neben der Eingangstür hing ein kleines Metallschild mit der Aufschrift ‚Integrations-Center I – hier nur Chuvai‘.
Der Supervisor zu Lukes Linken trat an eine in der Wand eingelassene Kamera und blickte mit dem rechten Auge direkt in die Linse. Ein roter Laserstrahl tastete seine Iris ab. Nur wenige Sekunden später leuchtete ein grünes Lämpchen auf und die Tür glitt zur Seite. Sie betraten das Gebäude und die Tür schlug geräuschvoll wieder ins Schloss, kaum dass sie alle drei die Schwelle überschritten hatten. Luke zuckte bei dem Knall vor Schreck zusammen.
Sie standen im Erdgeschoss eines großen Gefängnis-Komplexes. Die dunklen Wände waren gesäumt von unzähligen Zellentüren, in der Mitte führte eine Eisentreppe nach oben in das nächste Stockwerk.
Luke war sich sicher, dass auch die oberen Stockwerke nicht anders aussahen. Das einzige Licht fiel durch trübe Oberlichter, fünfzehn Meter über ihnen, in den Komplex.
Trotz der fast sterilen Sauberkeit war die Luft stickig. Sie wirkte verbraucht und es roch nach Schweiß – dem Angstschweiß der Insassen, die hinter den undurchdringlichen Zellentüren auf ihr weiteres Schicksal warteten. Er konnte ihre Angst fast schmecken, sie schien auf ihn einzustürzen und drohte ihn in die Knie zu zwingen. Zitternd stand Luke in dem bedrückenden Korridor, nicht fähig, sich zu bewegen.
Er schloss für einen Augenblick die Augen. Vielleicht war das alles nur ein böser Alptraum. Vielleicht war er wieder zu Hause in seinem Zimmer, wenn er die Augen öffnete. Doch es war kein Alptraum, und Luke wusste es. Zu real waren seine eigene Angst und die Eindrücke, die auf ihn einstürzten.
Wortlos stießen die Supervisoren ihn tiefer in den Raum hinein, an der Treppe vorbei, und in den hinteren Teil des Gebäudes. Hier war die Luft noch stickiger und Luke atmete instinktiv etwas flacher.
Als sie seine Zelle erreicht hatten, stoppten sie erneut. Der Supervisor drückte seinen Daumen auf eine kleine Metallplatte neben der Tür, die sich prompt öffnete, während der andere Lukes Fesseln löste.
Bevor die beiden Männer ihn in die Zelle stießen, erhaschte er noch einen kurzen Blick auf ein kleines Display neben der Zellentür. Dort stand in leicht flackernden Buchstaben: »Luke 74 – Chuvai«.
Noch bevor Luke sich umdrehen konnte, fiel die Tür mit einem lauten Knall hinter ihm ins Schloss. Einen Moment herrschte eine bedrückende Stille, dann hörte er, wie sich die Schritte der Supervisoren langsam entfernten.
Als ihre Schritte endgültig verklungen waren, stieg erneut Panik in Luke auf. Er war alleine und hatte nicht die leiseste Ahnung, was als Nächstes geschehen würde. Er atmete mehrmals tief durch und versuchte, seine Angst in den Griff zu bekommen. Es hatte keinen Sinn jetzt in Panik zu verfallen, sagte er sich selbst. Das Wichtigste war jetzt einen klaren Kopf zu bewahren, wenn er diesen Alptraum heil überstehen wollte.
Nur langsam nahm er seine Umgebung richtig wahr. Er stand in einer kleinen, steril wirkenden Zelle. Gegenüber der Tür war ein vergittertes Fenster, von dem aus er auf den gepflasterten Hof des benachbarten Integrations-Centers blicken konnte. Hätte seine Zelle sich in einem der oberen Stockwerke befunden, hätte er vielleicht über die hohen Mauern sehen können, so aber war der kahle Hof das einzige, was ihm das Fenster zeigte.
Luke wandte sich von dem beklemmenden Ausblick ab und betrachtete seine Zelle genauer. Doch gab es da nicht viel zu sehen. In der Ecke links neben dem Fenster befand sich eine Toilette und an der rechten Wand stand eine Metall-Pritsche mit einer schäbigen Fleecedecke. Das war alles, was sich in dem großen Raum befand.
Luke setzte sich auf das harte Bett, lehnte sich an die Wand und schlang seine Arme um die angezogenen Beine. So zusammen gekauert starrte er an die gegenüberliegende Wand. Dabei versuchte er nicht zu denken. Denn sobald sein Gehirn anfing über seine momentane Situation nachzudenken, stiegen ihm erneut Tränen in die Augen. Aber er wollte nicht schon wieder weinen. Er war schließlich kein kleines Kind mehr, das bei jeder Kleinigkeit los greinte. Er war zwar vielleicht auch noch kein Mann, aber er fühlte sich den Kinderschuhen doch deutlich entwachsen.
Luke musste wohl eingeschlafen sein, denn als plötzlich ein gedämpfter Schrei durch das Fenster zu ihm herein gellte, wäre er fast von der Pritsche gefallen. Alarmiert sprang er auf und blickte durch die Gitterstäbe nach draußen, auf den Hof.
Dort bot sich ihm ein erschreckender Anblick.
In der Mitte des Hofs, etwa 30 Meter von seinem Fenster entfernt, befanden sich drei Männer. Zwei trugen die Uniform der Supervisoren, der dritte Mann krümmte sich, vor Schmerz schreiend, zu ihren Füßen.
Luke konnte die Schreie trotz der Fensterscheibe noch deutlich hören, und ein Schauer lief ihm über den Rücken.
Der Gepeinigte hatte mit beiden Händen einen schmalen Ring um seinen Hals umklammert und zerrte aus Leibeskräften daran. Dabei zuckten seine Arme und Beine unkontrolliert.
Die Schreie auf dem Hof waren inzwischen verstummt und der Gefolterte lag reglos auf dem Boden. Die Supervisoren schienen ihn anzubrüllen, aber Luke konnte nicht verstehen, was sie sagten. Dann traten sie dem Mann zu ihren Füßen in den Bauch und in die Seite, bis dieser sich schließlich halb aufraffte, so dass er auf den Knien vor den Supervisoren kauerte.
Luke wandte erschüttert den Blick von dem Schauspiel ab. Er konnte den Anblick des gequälten Mannes nicht länger ertragen. Sein Magen zog sich schmerzhaft zusammen als er darüber nachdachte, ob er wohl der Nächste war.
Als er nach ein paar Minuten erneut aus dem Fenster blickte, war der Hof wieder leer. Nichts erinnerte mehr an das grausame Schauspiel, das noch vor ein paar Minuten dort stattgefunden hatte.
Luke setzte sich auf seine Pritsche und atmete tief durch.
Seine Hände zitterten noch immer, aber sein Magen beruhigte sich allmählich wieder. Zumindest hatte er nicht mehr das Gefühl, sich jeden Moment übergeben zu müssen.
Charles hatte sich direkt nach seiner Rückkehr in sein Arbeitszimmer begeben und widmete sich den Wochenberichten. Er hatte während der Fahrt seinen Fokus wiedergefunden und hatte sich nun wieder vollkommen unter Kontrolle. Der Gedanke an seinen verstorbenen Vater hatte ihm dabei geholfen. Sein Vater war stets sein Vorbild gewesen. Viele Jahre hatte er das Familienunternehmen, das wiederum sein Vater nach der Weltwirtschaftskrise Anfang des 21. Jahrhunderts aufgebaut hatte, wie ein Captain sicher durch die raue See befehligt. Er hatte nie sein Ziel aus den Augen verloren und niemals Schwäche gezeigt.
Charles schnaubte leise bei dem Gedanken an diese peinliche Entgleisung. Jetzt, wo er wieder er selbst war, musste er fast lächeln.
Warum bloß war er so weich geworden? Er hatte schon einige seiner Bekannten und Freunde in die Sklaverei gehen sehen und bei keinem hatte er auch nur einen Anflug von Mitgefühl empfunden. Warum auch? Alle waren selbst an ihrem Schicksal schuld gewesen und sie alle erwiesen nun einen guten Dienst, indem sie den Reichtum ihrer Master mehrten.
Er legte das Datapad mit den Wochenberichten der Supervisoren zur Seite. Er hatte keine Lust, sich mit den kleineren und größeren Vergehen seiner Sergia zu befassen. Im Prinzip war es auch nicht so wichtig. Schließlich hatten seine Supervisoren sich schon der Probleme angenommen und die betreffenden Delinquenten entsprechend bestraft.
In diesem Punkt hatten seine höherrangigen Mitarbeiter freie Hand. Nach etwa zehn Dienstjahren wurde ein Wachmann in den Rang eines Supervisors erhoben. Nach dieser Zeit hatte er genug Erfahrung um die Sergia selbständig zu führen. Und dieses System funktionierte gut. Es kam nur selten vor, dass einer der Grand-Supervisoren oder gar Charles selbst, ein Urteil abändern mussten.
So überflog Charles meist nur die Wochenberichte, denn es war ja nur eine nachträgliche Information. Und manchmal war das für seine Sergia gar nicht von Nachteil, denn der ein oder andere Supervisor war doch eher milde in der Wahl des Strafmaßes.
Aber solange das Geschäft lief, wollte Charles sie dafür nicht zurechtweisen. Erst wenn gehäuft Ungehorsam auftrat, so dass man annehmen musste, dass die Sergia ihre Führung nicht mehr ernst nahmen, griff Charles ein. Dies war jedoch erst einmal vorgekommen.
Damals hatte sich ein Supervisor mit einer jungen Sergia eingelassen. Charles tolerierte es, wenn seine Supervisoren sich mit den Mädchen ein wenig vergnügten, schließlich waren sie Männer, und irgendwo mussten sie ihre Triebe ausleben. Aber bei diesen Beiden war es anders gewesen. Der Supervisor hatte sich in das Mädchen verliebt, und darüber vollkommen seine Pflichten vergessen. Während sie gemeinsam ihre Flucht planten, lief auf der Farm, die er beaufsichtigen sollte, alles aus dem Ruder.
Die Sergia merkten schnell, dass ihr Aufseher nicht mehr bei der Sache war. Sie schluderten bei der Arbeit, stellten seine Anweisungen in Frage und wurden aufmüpfig.
Verblendet durch die Liebe zu seinem Mädchen, merkte der Supervisor dies allerdings viel zu spät, als dass er noch eine Chance gehabt hätte, die Situation alleine wieder in den Griff zu bekommen.
Als einige Sergia schließlich eine Revolte anzettelten, blieb ihm nichts anderes übrig, als Hilfe anzufordern. Der Aufstand wurde blutig niedergeschlagen und der Supervisor verlor seine Anstellung.
Damals hatte Charles ernsthaft sein System in Frage gestellt, aber der Vorfall war ein Einzelfall geblieben. So überließ er das tägliche Geschäft auch weiterhin seinen Angestellten, und widmete sich selbst mehr administratorischen und repräsentativen Aufgaben.
Während er sich an diesen ärgerlichen Vorfall erinnerte, hatte Charles gedankenverloren auf das Bild seines Vaters gestarrt, das gegenüber an der Wand hing. Hätte er die Anzeichen vielleicht früher bemerkt? Hätte er schon reagiert, bevor es zum Aufstand gekommen wäre?
Hunderte Sergia hatten an diesem Tag ihr Leben verloren, als die Supervisoren die Revolte niederschlugen. So viele gute Arbeiter. Es hatte fast ein Jahr gedauert, bis die Verluste auf der Farm wieder aufgefüllt waren, und noch ein weiteres, bis die Farm endlich wieder einen Gewinn abgeworfen hatte.
Charles griff erneut nach dem Datapad, und nahm sich vor, die Wochenberichte wieder sorgfältiger zu studieren, um einen weiteren Vorfall dieser Art zu verhindern.
Doch noch bevor er die nächste Datei aufgerufen hatte, klingelte sein Mobiltelefon. Charles blickte auf das Display.
Der Name ‚Jones‘ leuchtete auf. Er griff eilig nach dem kleinen, silbernen Gerät und nahm das Gespräch an.
»Ja, Mr. Jones«, sagte er.
»Entschuldigen Sie die Störung, Mr. Dumare«, meldete sich Jones am anderen Ende der Leitung. »Aber Sie baten mich Ihnen Bescheid zu geben, wenn wir soweit sind.«
»Danke Mr. Jones. Ich bin in etwa 15 Minuten da.«
»Ja, Sir«.
Dann legte Charles auf.
Er hatte beschlossen, bei Lukes Integration persönlich anwesend zu sein.
Bereits sein Vater hatte die Erfahrung gemacht, dass es den allgemeinen Betriebsablauf zu sehr störte, wenn man versuchte, neue Sergia direkt einzugliedern. Vor allem bei den in Freiheit geborenen Chuvai war dies fast unmöglich, ohne einen Aufruhr unter den anderen Sergia zu provozieren.
So hatte sein Vater sogenannte Integrations-Center erbauen lassen, in welchen die betriebsfremden Sergia zuerst einmal ‚angepasst‘ wurden.
Vor allem bei den Chuvai war es wichtig, dass sie gefügig gemacht wurden und die Autorität ihres Masters sowie die der Supervisoren, bedingungslos akzeptierten. Je nach Individuum konnte dies Tage, manchmal aber auch Wochen dauern. Aber bis jetzt hatten seine Supervisoren jeden noch so störrischen Neuzugang unterworfen.
Und auch bei Luke würde dies nicht anders sein. Der Junge war in behüteten Verhältnissen aufgewachsen und hatte nie gelernt zu kämpfen. Es war davon auszugehen, dass er sich unter dem Druck recht schnell beugen würde.
Als er sein Büro verließ, griff Charles nach seinem Mantel, der an einem Haken direkt neben der Tür hing. Er ging in die Tiefgarage unter seinem Haus, stieg in seinen Wagen und fuhr in Richtung Integrations-Center.
Charles wollte bei Lukes Einweisung nicht etwa dabei sein, um den Jungen vor allzu harten Maßnahmen der Supervisoren zu schützen. Vielmehr wollte er sich selbst auf die Probe stellen, ob er sich tatsächlich wieder so unter Kontrolle hatte, wie er es annahm. Der Aussetzer von heute Morgen ließ ihm einfach keine Ruhe und er hatte beschlossen, sich selbst zu beweisen, dass Luke für ihn genauso ein Sergia war wie all die Anderen.
Das Integrations-Center war nur wenige Kilometer von Charles Wohnhaus entfernt, und so dauerte es nur wenige Minuten, bis er den Parkplatz erreicht hatte. Er stellte seinen Wagen ab und ging zum Eingang. Er nickte den Wachen, die das große Eisentor bewachten, kurz zu und sie ließen ihn ein.
Der Hof war noch leer, aber Charles musste nicht lange warten.
Kaum hatte sich das Tor hinter ihm wieder geschlossen, öffnete sich die Tür des gegenüberliegenden Gebäudes.
Heraus traten vier Personen: zwei Wachleute, der Supervisor Robert Jones, mit dem er zuvor telefoniert hatte, und Luke.
Luke wurde von den beiden Wachen flankiert, Jones folgte ihnen in kurzem Abstand. Der Junge wirkte zwischen den beiden kräftigen Männern klein, und eher wie ein Kind, als wie ein junger Mann.
Einen kurzen Moment fürchtete Charles, dass er Mitgefühl mit Luke haben könnte, aber als er seine Gefühle prüfte war da nur die Wut, die er heute Morgen schon empfunden hatte.
Gut, so und nicht anders sollte es sein.
Als Luke seinen Onkel erkannte, rannte er los.
»Onkel Charly«, rief er.
Doch noch bevor er seinen Onkel erreicht hatte, hatten die Wachen ihn eingeholt und zu Boden gestreckt. Einer der Beiden packte Lukes rechten Arm und drehte ihn auf den Rücken, so dass der Junge vor Schmerz aufstöhnte.
»Onkel Charly, bitte«, keuchte er.
Charles trat langsam an seinen Neffen heran und blickte auf ihn herab.
»Für jedes ‚Onkel Charly‘ erhält er drei Hiebe mit der Peitsche«, sagte er kalt. »Das wären bis jetzt sechs.«
»Onkel Charly, BITTE«, keuchte Luke erneut und blickte seinen Onkel flehend an.
»Neun«, sagte Charles.
In der Zwischenzeit war Jones um Luke und die beiden Wachen herum gegangen, und baute sich nun vor dem Jungen auf.
»Stellt ihn auf«, befahl er den beiden Männern.
Augenblicklich zerrten sie Luke auf die Füße, aber ihren Griff lockerten sie nicht.
»Ab dem heutigen Tag wirst du den Namen ‚Luke 74‘ tragen. 74, weil du der vierundsiebzigste Sergia mit dem Namen Luke bist, der sich im Besitz deines Masters befindet. Du wirst deinen neuen Herrn ausschließlich mit ‚Master‘ anreden«, fuhr Jones fort. »Du wirst in seiner Gegenwart stets den Blick gesenkt halten. Nur wenn dein Master es dir gestattet darfst du ihn anblicken.«
Wie um diese Worte noch zu verdeutlichen versetzte eine der Wachen Luke einen harten Schlag gegen den Hinterkopf, so dass sein Kopf nach vorne sackte.
»Wenn du deinem Master entgegen trittst zeigst du ihm deine Demut, indem du vor ihm auf die Knie gehst.«
Luke war nicht darauf gefasst und stöhnte erneut, als der andere Wachmann ihm kurz hintereinander zuerst einen harten Schlag in den Magen und dann in die Kniekehlen versetzte. Gleichzeitig entließ der erste ihn endlich aus seinem Klammergriff. Luke krümmte sich vor Schmerz und hielt sich den Magen, beim zweiten Schlag fiel er hart auf die Knie.
»Onkel Char…«, stöhnte Luke, der Rest des Namens blieb ihm im Halse stecken, denn der Wachmann zu seiner Linken hatte ihm in den Magen getreten, so dass ihm die Luft weg blieb.
»Zwölf«, sagte Charles und blickte weiterhin auf seinen ehemaligen Neffen und zukünftigen Sergia herab, ohne eine Miene zu verziehen.
Während Luke noch immer stöhnend auf dem Boden kauerte, packte ihn der andere Wachmann an den Haaren und riss seinen Kopf so nach vorne, dass sein Kinn auf die Brust schlug. Fast im gleichen Moment spürte Luke einen schmerzhaften Stich im Nacken und schrie kurz auf.
»Dies ist ein GPS-Sender mit integriertem Personalisierungs-Chip. Der Chip wird sich in den nächsten Minuten mit deinem Rückenmark verbinden, eine Entfernung ist danach unmöglich. Mit einem Lesegerät ist es nun immer möglich, dich zu identifizieren. Außerdem wird der GPS-Sender aktiv, sobald du dich der Gebietsgrenze deines Masters näherst. Ein Fluchtversuch ist also sinnlos.«
Der erste Wachmann hielt Luke noch immer an den Haaren fest, während der andere ihm einen etwa zwei Zentimeter breiten, eng anliegenden Reif um den Hals legte. Es zischte kurz, der Reif wurde einen Moment fast unerträglich heiß, dann waren die beiden Enden miteinander verschmolzen.
Nun endlich entließ der Wachmann Luke aus seinem Griff.
»Dies ist ein Elektroschock-Halsband. Solltest du ungehorsam sein, ist dies eine weitere Möglichkeit deines Masters, dich zu maßregeln. Damit du seine Wirkung zukünftig richtig einschätzen kannst, werde ich es dir demonstrieren.«
Jones streckte die Hand aus, und deutete mit einer kleinen Fernbedienung auf Luke.
»Ich weiß, wie es wirkt«, keuchte Luke.
Der Wachmann zu seiner Linken trat ihm erneut in den Magen. Luke stöhnte und krümmte sich vor Schmerz zusammen.
»Ich weiß, wie es wirkt, SIR«, korrigierte Jones ihn scharf.
Er ließ Luke jedoch keine Chance seinen Fehler zu berichtigen. Stattdessen drückte er den kleinen Knopf in seiner Hand.
Fast augenblicklich fuhr ein heftiger Stromstoß durch Lukes Körper. Luke schrie vor Schmerz laut auf und griff mit beiden Händen panisch an den Ring um seinen Hals. Dies war jedoch ein Fehler. Sobald er ihn berührte, fuhr ein erneuter Stromstoß durch seinen Körper. Luke schrie erneut vor Schmerz. Nur unter höchster Selbstbeherrschung schaffte er es, seine Hände von dem Ring zu nehmen. Sofort hörte der Strom auf zu fließen.
»Versuchst du das Halsband zu entfernen, bestrafst du dich selbst«, fuhr Jones ungerührt fort.
Luke lag keuchend am Boden und rang nach Luft. Es dauerte einen langen Moment, bis der Schmerz seinen Körper endlich wieder verlassen hatte.
»Ich hoffe, du hast unsere Regeln soweit verstanden?«, fragte Jones als er sicher war, dass Luke wieder aufnahmefähig war.
Luke rührte sich nicht. Einer der Männer versetzte ihm einen harten Schlag gegen den Hinterkopf.
»Wenn man dir eine Frage stellt, wirst du sie beantworten. Ich hoffe, du hast unsere Regeln verstanden?«, sagte Jones.
»Ja«, keuchte Luke.
»Ja, SIR«, korrigierte Jones ihn sofort, während der Wachmann zu Lukes Linken ihm einen erneuten Schlag versetzte.
»Ja, Sir«, presste Luke hervor.
»Sehr schön. Ich denke, das ist genug für heute«, sagte Jones zufrieden.
»Haben Sie nicht noch etwas vergessen, Mr. Jones?«, schaltete Charles sich ein.
Jones blickte ihn fragend an.
»Sir?«
»Wenn ich richtig gezählt habe, stehen noch 12 Hiebe aus.«
»Oh ja, Sir. Wie konnte ich das nur vergessen«, antwortete Jones und gab seinen Wachen ein kurzes Zeichen.
Die beiden Männer zogen Luke auf die Füße und zerrten ihn zu der Mauer, die zu ihrer Linken war. Dort rissen sie ihm das Shirt vom Leib, so dass sein Oberkörper nackt war. Mit letzter Kraft riss Luke sich halb von ihnen los, drehte sich um, und starrte seinen Onkel verzweifelt an.
»Warum tust du mir das an, Onkel Charly?«, fragte er.
Seine Stimme zitterte und er kämpfte mit den Tränen.
»Fünfzehn«, sagte Charles kalt.
Luke rann eine Träne über die Wange.
Die beiden Wachen packten ihn erneut und stießen ihn hart gegen die Mauer. Etwa eine Armlänge über ihren Köpfen waren, im Abstand von etwa einem Meter, zwei Ketten mit Handschellen in die Wand eingelassen. Sie ketteten Luke an die Wand, so dass er mit über dem Kopf ausgebreiteten Armen und dem Gesicht zur Mauer, vor ihnen stand.
»Bitte, Mr. Jones«, sagte Charles, und deutete mit ausgestreckter Hand auf Lukes entblößten Rücken.