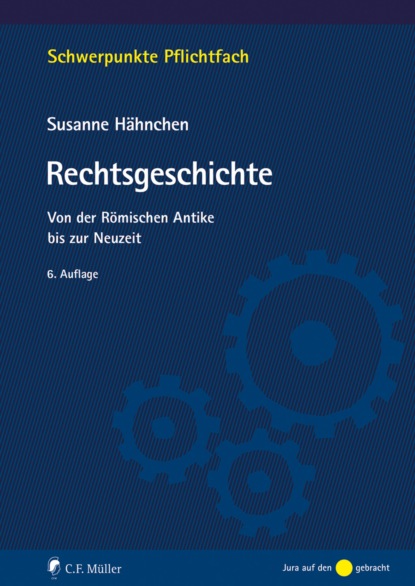- -
- 100%
- +
58
Eingangs ist nur von beweglichen Sachen die Rede. Wurde um ein Grundstück geklagt, so trug man symbolisch eine Erdscholle an den Gerichtsort und berührte sie mit der Lanze. Vieles spricht dafür, dass Prozesse um bewegliche Sachen und damit auch das private Eigentum an ihnen älter ist als das (individuelle) Grundeigentum.[16] Dafür spricht auch die sog. Allmende, die es bis heute noch vereinzelt gibt.
Kläger und Beklagter behaupteten und beschworen beide, sie seien Eigentümer und setzten eine sog. Wettsumme (sacramentum) auf ihren Eid. Diese Wette bzw. der Schwur war wesentlich, auch im Namen der Klage erwähnt und zumindest ursprünglich von religiöser Bedeutung. Der Einsatz des Verlierers ging an die Staatskasse; es handelt sich somit um eine Vorform des prozessualen Kostenrisikos.
Das Auflegen der Lanze (festuca, vindicta) wurde früher oft als Scheinkampf gedeutet, also im Sinne von symbolisierter Selbsthilfe. Wahrscheinlicher ist es aber, dass damit die Herrschaftsgewalt angedeutet werden sollte. Denkbar ist auch die Erklärung als symbolische Verletzungshandlung, zu der ebenfalls nur der Herr (Eigentümer) befugt war. Jedenfalls handelt entweder der Kläger oder der Beklagte unberechtigt und der nachfolgende Prozess soll zeigen, wer von beiden es war. Die Formel, die der Kläger aufsagen musste, war übrigens diejenige, die auch bei der Übereignung wirtschaftlich wichtiger Sachen (Rn. 68) vom Erwerber aufgesagt werden musste, nur dass dort der andere schwieg.
Die Klage in klassischer Zeit auf Herausgabe einer Sache wurde nach dem alten Ritual rei vindicatio genannt und so bezeichnet man bis heute § 985 BGB, obwohl es nicht mehr um eine Klage, sondern um einen Anspruch geht.
59
Zum Vollstreckungsverfahren bestimmten die XII Tafeln:
Tafel (tabula) III:
(1) Aeris confessi rebusque iure iudicatis XXX iusti dies sunto.
(2) Post deinde manus iniectio esto. In ius ducito.
(3) Ni iudicatum facit aut quis endo eo in iure vindicit, secum ducito, vincito aut nervo aut compedibus XV pondo, ne maiore, aut si volet minore[17] vincito.
(4) Si volet suo vivito. Ni suo vivit, qui eum vinctum habebit, libras farris endo dies dato. Si volet, plus dato.
(6) Tertiis nundinis partis secanto. Si plus minusve secuerunt, se (= ne) fraude esto.
Übersetzung:
(1) Bei anerkannter Geldschuld und rechtskräftig entschiedenen Sachen sollen 30 Tage [Frist] sein.
(2) Darauf soll die Handanlegung stattfinden. Er [Kläger] soll [den Schuldner] vor Gericht führen.
(3) Wenn er [Schuldner] das Urteil nicht erfüllt oder wenn niemand für ihn als Bürge eintritt, soll er [Kläger] ihn mit sich führen, gefesselt mit einem Strick oder mit Gewichten von 15 Pfund oder, wenn er will, weniger gefesselt.
(4) Wenn er [der Schuldner] will, kann er auf eigene Kosten leben. Wenn er nicht auf eigene Kosten lebt, muss ihm, wer ihn gefesselt hält, ein Pfund Spelt an jedem Tag geben. Wenn er will, kann er ihm mehr geben.
(6) Am dritten Markttag sollen sie [die Gläubiger] in Teile schneiden. Wenn sie mehr oder weniger abschneiden, soll es kein Unrecht sein.
60
Für die Vollstreckung bedurfte es schon damals grundsätzlich eines vorherigen Erkenntnisverfahrens (i. S. d. XII tab. 1, 1-9, Rn. 53). Leistete der Schuldner auf das Urteil hin innerhalb von 30 Tagen nicht freiwillig, wurde die Vollstreckung eingeleitet durch eine weitere legis actio (Rn. 56), die l.a. per manus iniectionem. Dadurch erhielt der Gläubiger den Schuldner in seine Gewalt (Personalexekution). Es wurde also nicht wie heute in das Vermögen vollstreckt, sondern man haftete für seine Schulden im wahrsten Sinne des Wortes persönlich. Heute hingegen bedeutet persönliche Haftung „nur“, dass man im vollen Umfang seines Privatvermögens haftet (Gegensatz: beschränkte Haftung, insb. dinglich, d.h. auf einen bestimmten Gegenstand beschränkt).
Der Schuldner blieb 60 Tage in Haft, als Zwangsmittel und letzter Aufschub vor der endgültigen Vollstreckung. Innerhalb dieser Zeit musste er an drei Markttagen dem Prätor vorgeführt und konnte durch Zahlung oder Eintreten eines vindex (Bürgen) ausgelöst werden. Die Veranstaltung dieser letzten „Zahlungsaufforderungen“ in aller Öffentlichkeit, war mit erheblichem sozialen Druck auf den Schuldner und auch auf seine Familie verbunden. Konnte man trotzdem nicht zahlen und hatte offenkundig auch keine finanzstarken Freunde, fand das partes secare (XII tab. 3, 6) statt. Wörtlich genommen wäre das so zu verstehen, dass der Schuldner getötet werden durfte und nicht einmal ein ordentliches Begräbnis erhielt. Manche moderne Autoren halten dies für ungeheuerlich und daher unmöglich; sie meinen, dass stattdessen das Vermögen aufgeteilt worden sei.[18] Ein konkreter Fall der Tötung ist nicht überliefert. Die wenigsten Gläubiger hätten wirklich etwas davon gehabt, den Schuldner zu zerschneiden. Jedenfalls bald wurde die Haftung durch den Verkauf in die Sklaverei realisiert, aber nicht in Rom sondern „über den Tiber“ (trans tiberim), d.h. über die durch den Fluss gebildete Stadtgrenze ins Ausland. Die Personalexekution wegen Schulden ist 326 v. Chr. durch die lex Poetelia jedenfalls eingeschränkt worden. Allerdings kennen wir den Inhalt dieses Gesetzes nicht genau. Darin soll auch die Fesselung des Schuldners verboten worden sein. Jüngere nichtjuristische Quellen können dahin verstanden werden, dass Schuldner ihre Schulden (freiwillig?) abgearbeitet haben.
1. Person und Familie
61
Person (persona) war im römischen Recht an sich jeder, auch ein Sklave. Rechte hatte man jedoch nur als freier Bürger, nicht als Sklave. Der Status als Sklave[19] (und damit als Sache, Rn. 67) beruhte auf Geburt oder Kriegsgefangenschaft. Vielleicht wurden Sklaven auch aus dem Ausland gekauft.
Römischer Bürger mit entsprechenden Rechten (Rn. 42) wurde man durch Geburt in einer rechtlich anerkannten Ehe (matrimonium iustum) unter Römern oder später auch, wenn die Mutter Römerin und mit einem Peregrinen verheiratet war, dem das Eherecht (connubium) verliehen worden war. Auch die nichteheliche Geburt durch eine römische Frau führte zum Bürgerrecht, weil man damals noch keine Möglichkeit hatte, die Vaterschaft (durch Gentest) zu bestimmen (pater semper incertus est). Außerdem konnte das Bürgerrecht durch Beschluss der Volksversammlung verliehen werden. Später führte auch die Freilassung (manumissio, Rn. 174) von Sklaven dazu.
62
An der Spitze der römischen Familie stand der pater familias, der männliche Hausherr mit ursprünglich praktisch uneingeschränkter Gewalt (patria potestas) über die familia (Ehefrau, Kinder, Sklaven). Kindern gegenüber war das die väterliche Gewalt – ein Begriff, den noch das BGB von 1900 kannte – und die Ehefrau hatte er in der manus-Gewalt (Rn. 65). Er entschied über die Aufnahme Neugeborener in die Familie oder ihre Aussetzung und hatte ein weitgehendes Züchtigungsrecht, das Recht über Leben und Tod (ius vitae necisque), das erst allmählich eingeschränkt wurde.
Nur die Familienväter, also ein sehr kleiner Teil der Bevölkerung, hatten nach heutiger Terminologie volle Rechtsfähigkeit, also die grundsätzlich unbeschränkte Fähigkeit, Träger von Rechten und Pflichten zu sein. Familienväter waren sui iuris (eigenen Rechts). Kinder, Ehefrauen und Sklaven waren alieni iuris (fremden Rechts).
63
Als verwandt im Rechtssinne galten nur Personen, die unter derselben patria potestas standen oder gestanden hätten, wenn ihr gemeinsamer pater familias noch lebte. Man nennt das agnatische Verwandtschaft, im Gegensatz zur heutigen kognatischen (Blutsverwandtschaft), die auch die an sich einzig sichere Mutterseite einbezieht. Mit der Emanzipation der Kinder (Rn. 64) entfiel die rechtliche Verwandtschaft jedoch und damit auch das auf ihr beruhende gesetzliche Erbrecht.
Die gens (Rn. 41) war die Großfamilie aller Verwandten, die (ohne sich der verwandtschaftlichen Beziehungen im Einzelnen noch bewusst zu sein) ihre Abstammung von einem gemeinsamen pater familias herleiteten. Die Mitglieder der gens führten einen einheitlichen Gentilnamen.[20] Es handelte sich also ebenfalls um einen agnatischen Personenverband. Nichteheliche (spurii) gehörten rechtlich keiner Familie an.
64
Die patria potestas über ein Kind dauerte an, solange der Vater lebte; es gab also keine der Volljährigkeit im heutigen Sinne entsprechende Altersgrenze (vgl. aber Rn. 175). Das Kind konnte jedoch emanzipiert, wörtlich: aus der Hand (manus) gegeben werden und damit rechtliche Selbstständigkeit erhalten. Die Manzipation (mancipatio) war ein altes Veräußerungsgeschäft, mit dem Eigentum übertragen wurde (Rn. 68). Der „Käufer“ erlangte über den später nur noch symbolischen Verkauf eine besondere Art von Gewalt, das mancipium. Zur Emanzipation von Hauskindern benutzte man den alten Satz:
XII tab. 4, 2:
Si pater filium ter venum duit, filius a patre liber esto.
(Wenn der Vater den Sohn dreimal verkauft, soll der Sohn vom Vater frei sein.)
Man muss sich das wohl so vorstellen, dass größere Hauskinder ähnlich wie Sklaven zur Nutzung weggegeben wurden, gegen Entgelt, aber nicht dauerhaft, z. B. über den Sommer als Erntehilfe. Danach ließ sich der Vater die Gewalt über den Sohn zurück übertragen. Ursprünglich war die Bestimmung in den XII Tafeln als Schutz des Hauskindes gegen Missbrauch der patria potestas gedacht, in dem Sinne, dass der Vater es eben maximal dreimal „verkaufen“ konnte. Noch Jahrhunderte später nutzte man die Bestimmung zur Emanzipation, indem man den Sohn dreimal unmittelbar hintereinander demselben Käufer bewusst zum Zwecke der Freilassung manzipierte (und dieser zurück); am Ende der Prozedur war der Sohn frei. Enkel und Töchter wurden übrigens nach Ansicht der alten Juristen schon durch einen einmaligen Verkauf frei (argumentum e contrario).
Eine andere Möglichkeit der Emanzipation entwickelte sich später aus dem Freiheitsprozess (vindicatio ad libertatem). An sich diente dieses Verfahren dazu, gerichtlich festzustellen, ob jemand Sklave oder freier Römer war. Ein einverständlich handelnder Kläger machte vor dem Prätor geltend, das Kind stehe nicht unter väterlicher Gewalt, der Vater widersprach nicht, und der Prätor erkannte auf Freisein von der patria potestas.
65
Die altrömische Ehe wurde begründet entweder durch confarreatio (ein rituelles Hochzeitsmahl), coemptio (Brautkauf mit mancipatio) oder usus („Ersitzung“ der Frau durch einjähriges faktisches Eheleben). Die Frau kam dadurch in die manus genannte Gewalt des Mannes (manus = Hand) und stand filiae loco, d.h. wie seine Tochter. Sie schied dadurch aus ihrer bisherigen (agnatischen) Familie aus. Es waren jedoch auch schon freie Ehen üblich, die den Personenstatus der Frau nicht veränderten.[21] Um die Ersitzung der Ehegewalt über die Ehefrau (usus) auszuschließen, musste sie nach einer Bestimmung der XII Tafeln jährlich während dreier aufeinander folgender Nächte dem Hause des Mannes fernbleiben (trinoctium, Rn. 113).[22]
Auch im öffentlichen Leben, insbesondere in juristischen Berufen, hatte die Frau weniger Rechte und Möglichkeiten als der Mann.[23]
2. Erbrecht
66
Tafel (tabula) V:
(3) Uti legassit super pecunia tutelave suae rei, ita ius esto.
(4) Si intestato moritur, cui suus heres nec escit, adgnatus proximus familiam habeto.
(5) Si adgnatus nec escit, gentiles familiam habento.
Übersetzung:
(3) Wie er [der Erblasser] über sein Vieh [Geld?] und die Vormundschaft über seine Sache [die Familie] verfügt, soll es rechtens sein.
(4) Stirbt jemand ohne Testament, der keinen Familienerben hat, soll der nächste Agnat das Familiengut haben.
(5) Wenn kein Agnat da ist, sollen die Gentilen das Familiengut haben.
Die XII Tafeln erkannten bereits die Testierfreiheit an und damit die über den Tod hinaus wirkende Verfügungsgewalt über das private Eigentum. Hinterließ der pater familias kein gültiges Testament, also keinen letzten Willen, so galt die gesetzliche Erbfolge der XII Tafeln. An erster Stelle standen die Hauserben (Kinder)[24], danach folgten die weiteren agnatischen, d.h. männlichen (Bluts-)Verwandten (XII tab. 5, 4) und wenn es auch keine solchen gab hilfsweise die gens (XII tab. 5, 5).
Unter der tutela (Fürsorge, Vormundschaft) des pater familias standen seine Kinder, die Ehefrau und die Sklaven, die ursprünglich auch zur familia gehörten (Rn. 62). Pecunia kommt vermutlich von pecus (Vieh), das in der frühen Tauschwirtschaft ein wichtiges Zahlungsmittel war, meint aber später in abstrakterem Sinne das Geld oder Vermögen. Zur Zeit der XII Tafeln gab es jedoch noch kein geprägtes Geld. Man sprach auch von familia pecuniave, also wohl im Sinne von Mensch und Vieh.
3. Eigentum
67
Ein weiterer rechtlich zentraler Begriff neben persona (Rn. 61) war res (Sache). Eigentum an einer Sache konnte nur der pater familias haben, zu dessen patria potestas das Eigentum gehörte. Hauskinder und Sklaven erwarben ggf. für ihren Herrn. Einen Begriff für das Eigentum gab es in dieser Zeit nicht und es war (noch) nicht klar vom Besitz unterschieden.
Die Sachen wurden in res mancipi und res nec mancipi eingeteilt.[25] Res mancipi, also Sachen die durch mancipatio (Rn. 68) wirksam übereignet wurden, waren Grundstücke in Italien, Sklaven (die also res und persona zugleich waren) sowie einheimische Zug- und Lasttiere (Rinder, Pferde, Maultiere, Esel). Außerdem gehörten dazu die nicht körperlichen Dienstbarkeiten an italischen ländlichen Grundstücken (Feldservituten). Es handelt sich zusammengenommen um die existentiellen Grundlagen der landwirtschaftlichen Produktion.
Alle anderen Sachen (re nec mancipi) wurden nicht durch mancipatio, sondern von alters her durch formlose traditio (Übergabe) übereignet.
68
Die Übereignung von res mancipi (Rn. 67) geschah durch das stark formalisierte Geschäft der Manzipation (mancipatio von manus = Hand und capere = ergreifen). Sie diente auch dem „Verkauf“ und der Freilassung von Hauskindern (Rn. 64). Verpflichtungs- und Erfüllungsgeschäft nach heutiger Terminologie, also Kaufvertrag und Übereignungsgeschäft, waren eine Einheit (formeller Barkauf). Dazu Gaius Inst. 1, 119:
Est autem mancipatio, ut supra quoque diximus, imaginaria quaedam venditio; quod et ipsum ius proprium civium Romanorum est, eaque res ita agitur: adhibitis non minus quam quinque testibus civibus Romanis puberibus et praeterea alio eiusdem condicionis, qui libram aeneam teneat, qui appellatur libripens, is qui mancipio accipit, rem tenens ita dicit hunc ego hominem ex iure quiritium meum esse aio isque mihi emptus esto hoc aere aeneaque libra; deinde aere percutit libram idque aes dat ei, a quo mancipio accipit, quasi pretii loco.
Übersetzung:
Die Manzipation ist aber, wie wir oben gesagt haben, eine Art Scheinverkauf; auch dieses Geschäft gehört zu dem Recht, das allein den römischen Bürgern eigen ist, und es wird wie folgt vollzogen: Unter Hinzuziehung von mindestens fünf mündigen römischen Bürgern als Zeugen und eines weiteren Mannes desselben Status, der eine bronzene Waage zu halten hat, dem sogenannten Waagehaltern spricht derjenige, der durch Manzipation erwirbt, indem er die Sache ergreift, wie folgt: Dass dieser Sklave nach dem Recht der Quriten mir gehört, behaupte ich, und er soll mir gekauft sein mit diesem Kupferstück und mittels der bronzenen Waage. Dann schlägt er mit dem Kupferstück gegen die Waage und übergibt demjenigen, von dem er durch Manzipation erwirbt, das Kupferstück gleichsam als Kaufpreis.
Der Bericht des Gaius stammt aus dem 2. Jh. n. Chr.; was er aus der späteren Perspektive (Rn. 126) als Scheinkauf mit Kupferstück bezeichnet, ist der Überrest des ursprünglichen Vorganges, der nicht nur symbolisch war, denn zur Zeit der XII Tafeln und bis mindestens 320 v. Chr. wurde das Metall als Zahlungsmittel tatsächlich abgewogen, weil es kein geprägtes Geld (und erst recht keine Geldscheine) gab. Wegen der verwendeten Waage (libra) bzw. dem Abwägen spricht man auch von einem Libralakt. Das quiritische Recht ist das Recht der römischen Bürger (quirites, cives); der Ausdruck wurde vor allem im sachenrechtlichen Zusammenhang verwendet. Alle Beteiligten an diesem ritualisierten Vorgang (Veräußerer, Erwerber, Waagehalter und fünf Zeugen) waren notwendigerweise römische Bürger und nur diese konnten Eigentum an res mancipi haben.
Die zu sprechende Formel erinnert auffällig an die legis actio sacramento in rem (Rn. 57 f). Über ihren Ursprung wissen wir nichts Sicheres. Es handelt sich jedenfalls um ein Produkt der frühen Priesterjuristen (Rn. 49 f). Der Veräußerer schwieg, wie ein Beklagter, welcher der Rechtsbehauptung des Klägers im Eigentumsprozess nicht widerspricht. Die Einhaltung der vorgeschriebenen Form ließ den Erwerber Eigentümer werden, weshalb man – ebenso wie für die Legisaktionen und die Stipulation (Rn. 72) – von Wirkformen spricht.
Neben der mancipatio bildete sich später die in iure cessio heraus. Dabei behauptete der Erwerber gleich einem Kläger sein Recht vor dem Prätor, der Veräußerer schwieg, und der Prätor sprach die Sache dem Erwerber zu.
4. Schuldrecht
69
Die Anfänge des Schuldrechts und zugleich wohl des staatlichen Rechts sind (nicht nur in Rom) im Delikt zu suchen. Taten wie Mord und Totschlag, Körperverletzung, Diebstahl und Beleidigung berechtigten den Geschädigten – oder falls er getötet worden war seine Familie – zunächst zur undifferenzierten Selbsthilfe (Rache). Diese milderte sich im Laufe der Zeit zur Talion, d.h. der Geschädigte durfte dem Täter das antun, was dieser ihm angetan hatte, aber nicht mehr (ähnlich im Alten Testament, Ex. 21, 23-25: Auge um Auge, Zahn um Zahn).
XII tab. 8, 2:
Si membrum rupsit, ni cum eo pacit, talio esto.
(Wenn er ihm ein Glied gebrochen hat und sich nicht mit ihm [auf Buße] einigt, soll die Talion stattfinden.)
Die Rache konnte also abgelöst werden, durch Sach- oder Geldbuße, z. B. wurde ein „Sündenbock“ anstelle des Schädigers ausgeliefert. Die Bußen wurden ursprünglich durch streitbeilegendeVereinbarung (pacisci, pactum, Rn. 54, 71) festgelegt, später im Interesse des inneren Friedens vom Gemeinwesen erzwungen. Zunächst waren es feste Bußsätze, später ging man zu Schadensersatz über (lex Aquilia, Rn. 108).
Strafrecht und privates Schuldrecht kann man auf der frühen Entwicklungsstufe noch nicht unterscheiden. Sowohl die Geldstrafe (heute Strafrecht) als auch der Schadensersatz (heute Zivilrecht) haben ihre Wurzeln in den Bußen. Gemeingefährliche Übeltäter wurden allerdings, sobald sich eine entsprechende Staatsgewalt herausgebildet hatte, für sacer (den Göttern geweiht, d.h. vogelfrei) erklärt oder mit dem Tode bestraft.
70
Hatte ein Hauskind, ein Sklave oder auch ein Tier einen Schaden angerichtet, so haftete der pater familias. Er konnte den Schaden ersetzen oder dem Geschädigten den Täter durch mancipatio ausliefern (noxae datio oder deditio, XII tab. 12, 2, Gaius Inst. 4, 75).
Die Verletzung von Sklaven war noch zusammen mit der von Freien geregelt, aber es gab nur die halbe Buße:
XII tab. 8, 3:
manu fustive si os fregit libero CCC, si servo CL poenam subito.
(Wenn einer mit bloßer Körperkraft oder mit einem Knüppel einem Freien einen Knochen gebrochen hat, so soll er [eine Strafe von] 300 [As] zahlen, wenn einem Sklaven, eine von 150 [As].)
71
Die Haftungsbegründung aus Vertrag hat ihren Ursprung offenbar beim pacisci (Sühnevergleich, Rn. 69), d.h. das Delikt ist älter als der Vertrag. Es gab zunächst nur eine persönliche Haftung in der Weise, dass der Täter oder eine an seine Stelle tretende Geisel, etwa ein Familienangehöriger oder Klient, vom Verletzten oder seiner Familie faktisch gefesselt und bei Nichtauslösung getötet wurde. Die Möglichkeit, eine Haftung nur durch reale „Bindung“ eines Menschen zu erreichen, konnte den wirtschaftlichen Bedürfnissen bald nicht mehr genügen. Die Obligation (obligatio = Schuldverhältnis) wurde daher zu einem geistigen Vorgang, einem rechtlichen Band (iuris vinculum), das eine Verurteilung des Schuldners und Vollstreckung auf Grund einer Vereinbarung ermöglichte. Die Haftung blieb aber noch persönlich (Rn. 60). Erst später haftete der Schuldner nur mit seinem Vermögen (Rn. 60).
72
Eine etwas jüngere Form zur Eingehung rechtlicher Bindung ist die Stipulation (stipulatio). Dabei handelte es sich um ein mündliches, einseitiges Schuldversprechen. Gläubiger und Schuldner mussten korrespondierende Erklärungen bei gleichzeitiger Anwesenheit abgeben. Der künftige Gläubiger (stipulator) fragte und die Antwort des Versprechenden (promissor) musste unter Benutzung des gleichen Verbs erfolgen. Ein Beispiel: Centum mihi dari promittis? Promitto. (Versprichst du, dass mir 100 geleistet werden? Ich verspreche.)
Abweichungen führten zur Unwirksamkeit des Versprechens. Auch hierbei handelt es sich daher um ein Formalgeschäft, eine Wirkform (Rn. 56). Weil die rechtliche Bindung durch die gesprochenen Worte (verba) entstand, spricht man auch von einem (einseitigen) Verbalvertrag. Die schuldrechtliche Wirkung der Stipulation wurde ursprünglich vermutlich durch eine magische oder sakrale Handlung (Opfer mit Versprechen) herbeigeführt. Der Schuldner kam dadurch unter die Gewalt der bei diesem Akt anwesenden Götter, deren Zorn er sich im Falle des Versprechensbruches aussetzte.
Wegen ihrer neutralen Form konnte die stipulatio zur Begründung von Verbindlichkeiten aus verschiedenen Anlässen dienen (Darlehen, Kaufpreis, Bürgschaft) und mit verschiedenen Inhalten (nicht nur Geld) verwendet werden. Eingeklagt wurde die Schuld dann mit der legis actio per iudicis postulationem (Rn. 56).
§ 3 Die entwickelte Republik
Literatur:
Zur äußeren Rechtsgeschichte: Bleicken, Geschichte der römischen Republik (6. Aufl. 2004) S. 40 ff; 150 ff; 287 ff; Waldstein/Rainer, Röm. Rechtsgeschichte (11. Aufl. 2014) S. 73 ff, 128 ff; Fögen, Römische Rechtsgeschichten. Über Ursprung und Evolution eines sozialen Systems (2002) S. 125 ff; Kunkel/Schermaier, Römische Rechtsgeschichte (14. Aufl. 2005) S. 19 ff; 48 ff, 81 ff; 107 ff; 128 ff; Kunkel/Wittmann, Staatsordnung und Staatspraxis der römischen Republik (1995); von Lübtow, Das römische Volk (1955) S. 232 ff; 530 ff; 635 ff; Wieacker, Römische Rechtsgeschichte Bd. I (1989) S. 343 ff; 531 ff.