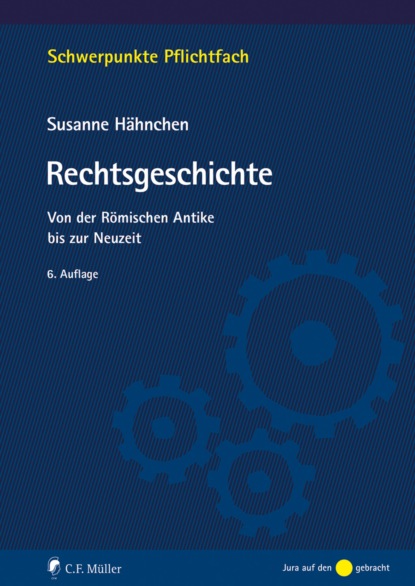- -
- 100%
- +
Zum Privatrecht und Prozessrecht siehe § 2.
I. Bis zum Revolutionszeitalter
73
Über die historischen Ereignisse in der entwickelten Republik, als Rom sich anschickte, zur Großmacht zu werden, aber am Ende große innere Krisen zu überstehen hatte, haben wir wesentlich detailliertere Informationen als über die Frühzeit. Zunächst ein kurzer Überblick:
Zeit allgemeines historisches Geschehen rechtshistorisch bedeutsam 367 leges Liciniae Sextiae ab 3. Jh. vorklassische Rechtswissenschaft 286/7 lex Aquilia 242 Praetor peregrinus 264-241 218-201 149-146 1. punischer Krieg 2. punischer Krieg 3. punischer Krieg 133-27 Revolutionszeitalter 90-88 Bundesgenossenkriege Ausweitung des Bürgerrechts 73-71 Sklavenaufstände (Spartacus) 48-44 Caesars Diktatur Entstehung der Rechtsschulen ab 27 v. Chr. Prinzipat des Augustus74
Zu Beginn des 4. Jahrhunderts v. Chr. hatte Rom als Stadt schon eine bedeutende Rolle in Mittelitalien gespielt. Danach (4./3. Jh.) beherrschte es allmählich ganz Italien. Mit dieser Ausdehnung waren wirtschaftliche und soziale Herausforderungen verbunden, die sich letztlich auch dem Recht stellten, das entsprechend angepasst werden musste.
Der Reichtum Roms ist maßgeblich auf seine Eroberungen zurückzuführen. Außerhalb Italiens wurde Sizilien 241 v. Chr. die erste Provinz. 180 v. Chr. entstand in Griechenland die Provinz Achaia. Die drei punischen Kriege gegen Karthago (beim heutigen Tunis) sicherten Roms Vorherrschaft im westlichen Mittelmeer.[1]
Die kleinbäuerliche Produktionsweise wurde von der Latifundienwirtschaft mit Sklaven (Kriegsgefangene) verdrängt. Trotzdem blieb der Kriegsdienst vornehmlich eine Last der römischen Bauern. Aber viele von ihnen wurden zu coloni (Pächtern), also zu (freien) Landarbeitern, die wenigstens zeitweise auf größeren Gütern gegen Lohn arbeiteten, oder sie gingen in die Stadt Rom, wo sie oft zur untersten Schicht der proletarii herabsanken.
Lohnende Verdienstmöglichkeiten im Großen entstanden durch die Entwicklung des Fernhandels, die Ausführung öffentlicher Aufträge sowie die Steuerpacht. Begleitet wurde diese wirtschaftliche Entwicklung vom Aufkommen des gemünzten Geldes (Rn. 68) und des Bankenwesens.
Auf kulturellem Gebiet öffneten sich die vornehmen Kreise Roms der griechischen Gedankenwelt. Beispiele sind der Scipionenkreis, der einflussreiche Stoiker Panaitios und der Historiker Polybios.
75
Den obersten Stand der Römer bildeten die nobiles (ordo senatorius). Die Angehörigen absolvierten üblicherweise die Laufbahn der hohen Staatsämter (Rn. 78), wurden danach Statthalter in den Provinzen und gelangten schließlich in den Senat. Grundlage ihrer gesellschaftlich-politischen Stellung war zunächst der Reichtum ihrer Familien, der durch Kriegsbeute erhöht wurde. Durch eine lex Claudia (218 v. Chr.) wurde Senatoren der Besitz größerer Seeschiffe untersagt, d.h. sie sollten keinen Seehandel größeren Ausmaßes mehr betreiben. Auch von öffentlichen Aufträgen und der Steuerpacht waren sie ausgeschlossen. Geldgeschäfte galten ihnen als unziemlich.
Zweiter Stand war der ordo equester, der sog. Ritterstand. Angeblich gehörten diesem zunächst Bürger an, denen wegen ihrer Verdienste ein equus publicus (Pferd für den Kriegsdienst auf öffentliche Kosten) gestellt wurde. Die equites der entwickelten Republik, die Angehörigen der Ritterzenturien, waren große Geschäftsleute, welche sich den profitablen Tätigkeiten widmeten, die dem Senatorenstand versagt waren. Ein Aufstieg in die Senatsaristokratie über die Ämterlaufbahn war lange quasi unmöglich. Seit dem zweiten punischen Krieg (218-201 v. Chr.) soll es 15 solcher Aufsteiger (homines novi; homo novus = wörtlich: neuer Mensch, im übertragenen Sinne: Emporkömmling) gegeben haben, unter ihnen der Popularenführer Marius, aber auch die profilierten Konservativen Cato der Ältere und Cicero.
Den dritten Stand bildete die „neue“ plebs, die Mehrzahl der freien römischen Bürger: Bauern, Gewerbetreibende in den Städten, auch Angestellte bei Höheren, niedere Beamte sowie von Getreidespenden und öffentlichen Spielen unterhaltene proletarii in der Hauptstadt.
Sozial bedeutend blieb das Klientenwesen (Rn. 41). Die Klientel spielte nicht zuletzt bei den Wahlen zu den Magistraturen (Rn. 89, 91) eine wichtige Rolle, denn faktisch waren Klienten verpflichtet, der Wahlempfehlung ihres Patrons zu folgen.
Rechtlich gesehen die unterste römische Bevölkerungsschicht waren die (unfreien) Sklaven. Ihr tatsächlicher sozialer Status wies allerdings große Unterschiede auf. Es gab in Fesseln gehaltene Feldarbeiter, aber auch Hauspersonal, Handwerker, Gewerbetreibende sowie qualifizierte Ärzte, Künstler und Gelehrte.
76
Frei, aber ohne römisches Bürgerrecht waren die Peregrine (Rn. 41). Sie stellten die Masse der Provinzbewohner und hatten immerhin ihr eigenes Bürgerrecht, es sei denn die Römer hatten ihr Gemeinwesen wegen besonders hartnäckiger Gegenwehr aufgehoben. Dann waren sie ohne jegliches Bürgerrecht (perigrini dediticii). So erging es z. B. den Karthagern nach der Eroberung Karthagos (146 v. Chr.) und den Juden nach der Zerstörung Jerusalems (70 n. Chr.).
Die im Zuge der römischen Eroberung Italiens unterworfenen latinischen Nachbarn erhielten meistens das römische Vollbürgerrecht (Rn. 42). Später entstanden Halbbürgergemeinden und Kolonien, deren Einwohner das commercium, oft auch das connubium hatten, aber kein suffragium oder ius honorum. Andere Gemeinden behielten ihr eigenes Bürgerrecht und wurden kriegsdienstpflichtige Bundesgenossen (socii).
Nach den gracchischen Unruhen (Rn. 96) wollte der Volkstribun Livius Drusus allen Bundesgenossen das römische Bürgerrecht verschaffen. Seine Gegner ließen ihn ermorden und gingen gegen seine Anhänger mit Hochverratsverfahren vor. Dadurch kam es 91 v. Chr. zum sog. Bundesgenossenkrieg. An seinem Ende wurde fast allen italischen socii das volle Bürgerrecht verliehen (90/89 v. Chr.). Ausgenommen blieben die Samniten, Lucaner und Bruttier, die erst später unterworfen werden konnten und denen ihr eigenes ursprüngliches Bürgerrecht genommen wurde; sie wurden peregrini dediticii.
1. Allgemeines
77
Die drei Elemente der (ungeschriebenen) republikanischen Verfassung waren der Senat, die Volksversammlungen und die Magistraturen (Rn. 45, 48). Die leges Liciniae Sextiae (Gesetze des Licinius und des Sextus – nach den Volkstribunen, die sie beantragten) von 367 v. Chr. entwickelten diese Verfassung weiter. Seither standen jeweils zwei Konsuln (ein patrizischer und ein plebejischer) an der Spitze des Gemeinwesens. Praktisch lag die Macht bei der neuen Adelsschicht aus Patriziern und aufgestiegenen Plebejern, versammelt im Senat (Rn. 47, 87). Auch die anderen Amtsträger entstammten dieser Schicht. Kennzeichnend für das frühere Stadium der politischen Entwicklung ist, dass kaum hervorragende Einzelpersönlichkeiten auftreten. Die Republik wurde lange von einer weitgehend homogenen Gruppe adliger Politiker und Militärs getragen. Diese Ordnung hielt sich bis zu den gracchischen Unruhen (Rn. 96), die 133 v. Chr. begannen und das sog. Revolutionszeitalter, das letzte Jahrhundert der Republik, einleiteten.
78
Für die Inhaber der Oberämter (magistratus) legte ein Gesetz von 180 v. Chr. die Laufbahn erstmals verbindlich fest. Zur Vermeidung von Alleinherrschaft wurden grundsätzlich alle Ämter doppelt besetzt (Kollegialität). Der Bewerber sollte sich zunächst zum Quästor wählen lassen, dann zum Volkstribunen oder Ädil, zum Prätor und schließlich zum Konsul. Zensur und Diktatur waren ehemaligen Konsuln vorbehalten. Das Mindestalter für den Quästor betrug (nach 10-jährigem Heeresdienst) 30 Jahre, für den Prätor 40, für den Konsul 43 Jahre.
Die römischen Oberämter waren unbesoldet, denn für das zeitgenössische Verständnis waren alle diese Ämter Ehrenämter. Gewählt wurde man jeweils für ein Jahr (Annuität) und zwischen den jeweiligen Ämtern lag eine Pause von mindestens zwei Jahren. Nach Absolvieren der Ämterlaufbahn gingen die früheren Amtsträger üblicherweise als Proprätoren oder Prokonsuln (Statthalter, Gouverneure) in eine Provinz, wo sie ihre bei den Wahlkämpfen geschmälerten Vermögen durch Ausbeutung der Provinzialen wieder aufbessern konnten. Bekannt wurde der Statthalter Verres wegen der gegen ihn gehaltenen Gerichtsreden Ciceros (in C. Verrem actiones prima et secunda).
2. Die einzelnen Ämter
79
Die beiden obersten Magistratsbeamten, die Konsuln, führten vor allem den militärischen Oberbefehl. Deshalb hatten sie die imperium genannte, höchste Herrschaftsgewalt. Damit verbunden war die coercitio (Recht zur Verhängung von Zwangs- und Strafmaßnahmen bis zur Todesstrafe) und die Befugnis, die Komitien (Volksversammlungen) einzuberufen sowie dort Anträge zu stellen. Jeder Konsul konnte gegen Anordnungen seines Kollegen sowie unterer Magistrate einschreiten (interzedieren: veto = ich verbiete). Normalerweise teilten die Konsuln ihre Amtsbereiche (provinciae) durch Vereinbarung oder Losentscheid auf, sofern nicht der Senat entschied.
Rechtsbehelf gegen die coercitio war zunächst die Interzession der Volkstribune. Eine lex Valeria aus dem Jahre 300 v. Chr. führte die provocatio ad populum (Berufung an die Volksversammlung) für jeden betroffenen Bürger ein. Sie galt zunächst nur innerhalb des pomerium, des alten Mauerringes der Stadt Rom, faktisch im zivilen Leben. Seit dem frühen 2. Jahrhundert v. Chr. galt sie auch außerhalb, also im militärischen Kommandobereich.
80
Das Amt des Prätors war vielleicht ursprünglich das höchste. Die Bezeichnung wird abgeleitet von prae-ire = vorangehen, vergleichbar dem deutschen Herzog (der vor dem Heere herzog). Seit 367 v. Chr. (leges Liciniae Sextiae) waren jedenfalls zwei Prätoren für das Rechts- und Gerichtswesen zuständig (Rn. 55). In seinem edictum, dem auf einer Holztafel (album) veröffentlichten Amtsprogramm, verlautbarte er die Klagen (actiones) und Einreden (exceptiones), die er den Prozessparteien gewähren wollte. Dabei wurde es später üblich, dass er (vor allem wohl durch seine Mitarbeiter) auch neue Formeln schuf, wodurch er ohne Volksgesetze aus eigener Machtvollkommenheit das Privatrecht weiterbildete (Rn. 18 f, 55 ff, 117 ff).[2]
Neben der Rechtsprechungsgewalt (iurisdictio) hatten die Prätoren wie die Konsuln die Kommandogewalt über das Herr (imperium), die Disziplinar- und Polizeigewalt (coercitio) und das Interzessionsrecht, mit dem sie Entscheidungen der Kollegen rückgängig machen konnten. Ein Prätor war aber collega minor gegenüber einem Konsul, diesem also nachgeordnet. Im Jahre 242 v. Chr. wurde das Amt des praetor peregrinus, also eines für Prozesse mit Nichtrömern zuständigen Prätors, von dem des für Rechtsstreitigkeiten unter Römern zuständigen praetor urbanus (von urbs = die Stadt = Rom) abgespalten. Seit dieser Zeit konnten auch Plebejer Prätoren werden.
81
Die Zensur war ein besonders ehrenvolles Amt, das nur alle fünf Jahre für 1 1/2 Jahre üblicherweise mit ehemaligen Konsuln besetzt wurde; wohl 367 v. Chr. (leges Liciniae Sextiae) war es vom Konsulat abgetrennt worden. Die Befehlsgewalt (potestas) der Zensoren war geringer als die der Konsuln und Prätoren.
Der Zensor stellte die für die Aufnahme in den Senat erforderlichen Listen auf (lectio senatus) und entschied über die Zuweisung der Bürger zu den einzelnen Klassen Rn. 89) entsprechend der Steuerkraft, also dem Vermögen des einzelnen. Ihm oblagen die Sittenaufsicht (cura morum) und gegebenenfalls die Erteilung einer Rüge mit finanziell belastenden und ehrenmindernden Konsequenzen für den Betroffenen. Außerdem stellte er den Staatshaushalt auf, organisierte die Verpachtung der Steuern und die Vergabe von öffentlichen Aufträgen.
82
Die Ädilität ist hervorgegangen aus einem plebejischen Sakralamt (aedes = Gebäude, Tempel) und entwickelte sich zur Aufsicht über die ursprünglich bei den Tempeln abgehaltenen Märkte („Marktpolizei“). Ab 367 v. Chr. (leges Liciniae Sextiae) erhielten die nunmehr zwei plebejischen und zwei patrizischen (kurulischen) Ädilen allgemeine Polizeigewalt (potestas) innerhalb des pomerium (Rn. 79). Die kurulischen Ädile waren für die Marktgerichtsbarkeit zuständig und erließen deshalb ein ädilizisches Edikt zum Kaufrecht, in dem die ersten Regelungen zur Mängelgewährleistung enthalten waren. Außerdem sorgten die Ädilen für die Getreideversorgung Roms (cura annonae) und die Ausrichtung öffentlicher Spiele (cura ludorum), wohlgemerkt auf eigene Kosten (Ehrenamt!).
83
Die Quästoren, die rangniedrigsten Magistrate in der Ämterlaufbahn, ausgestattet mit potestas, waren die Verwalter der Staatskasse und des Staatsarchivs.
84
Die Volkstribune hatten die Befugnis, gegen die coercitio der Imperiumsträger zu interzedieren (Rn. 79 f), die Versammlung der Plebs (Rn. 93) einzuberufen sowie dort Anträge zu stellen. Sie nahmen an den Senatssitzungen teil und wurden (erst) ab 102 v. Chr. wie andere ehemalige Amtsträger auch Senatoren. Als ursprüngliche Vertreter des einfachen Volkes im Ständekampf (Rn. 46), gehörten sie später derselben sozialen Schicht an wie die Magistrate und vertraten dementsprechend die politische Linie des Senats.
85
Ein außergewöhnliches Amt (magistratus extraordinarius) stellte die Diktatur dar. Der Diktator wurde für eine Dauer von bis zu 6 Monaten eingesetzt, zunächst für sakrale Aufgaben, später auf der Grundlage eines Senatsbeschlusses durch einen Konsulartribunen (Militärtribun mit konsularischer Gewalt) oder Konsul. Es handelte sich um ein institutionalisiertes, legitimes Amt zur Bewältigung von Staatskrisen, das vor allem im 4. Jh., aber auch in den ersten beiden punischen Kriegen genutzt wurde. Hierfür wurde das Prinzip der Kollegialität durchbrochen, um ein zügiges Handeln zu ermöglichen. Gleichzeitig war der Diktator immun; er konnte wegen Fehlentscheidungen – anders als andere Magistrate, die nur während ihrer Amtszeit immun waren – auch nicht nachträglich zur Verantwortung gezogen werden. Ursprünglich frei von der Intervention der Volkstribune und der Provokation wurde er ihnen nach dem Ende des zweiten punischen Krieges doch unterworfen. Damit entfiel seine besondere Machtbefugnis, und an Stelle der Diktatur operierte der Senat künftig mit einer Art Notstandsgesetz, dem senatus consultum ultimum (Rn. 87). Erst mit Sulla lebte das Amt am Ende der Republik wieder auf (Rn. 98).
86
Die Proprätoren und Prokonsuln waren in ihren Provinzen uneingeschränkte Alleinherrscher, faktisch allerdings dem Senat verantwortlich. Sie hatten keine interzessionsberechtigten Kollegen. In den Provinzen gab es auch keine provocatio an eine Volksversammlung. Die Provinzialstatthalter standen u. a. dem römischen Gerichtswesen ihrer Provinz vor, ähnlich den Prätoren in Rom. Für die nichtrömischen Einwohner blieben aber auch die Gerichte ihrer unter der Römerherrschaft fortbestehenden Gemeinwesen (Rn. 76) erhalten.
3. Der Senat
87
Im Senat war in der Republik die politische und gesellschaftliche Führungsschicht Roms versammelt. Er existierte wahrscheinlich schon in der Königszeit, als Versammlung der patrizischen Häupter. Seine Macht beruhte darauf, dass man – anders als bei den einzelnen Ämtern – einen Sitz im Senat auf Lebenszeit, also dauerhaft hatte. In den Senat gelangte man durch die lectio senatus der Zensoren (Rn. 81). Lange wurden nur ehemalige Konsuln und Prätoren Senatoren. Ab ca. 100 v. Chr. kamen auch Volkstribune, Ädile und Quästoren hinzu.
Die Senatsbeschlüsse (Singular: senatus consultum, Plural: senatus consulta) hatten ursprünglich nur beratende Funktion für die amtierenden Beamten, wurden später jedoch als eigenständige Rechtsquelle (Rn. 139) angesehen.[3] Tatsächlich beherrschte der Senat die Außenpolitik, entschied über Krieg und Frieden, Staatshaushalt, Rüstung, die Verteilung des militärischen Kommandos unter den Konsuln und die Besetzung der Statthalterposten in den Provinzen. Selbst Beschlüsse der Komitien unterlagen der Bestätigung durch den Senat (auctoritas patrum oder auctoritas senatus).
Ein rechtlich umstrittenes Mittel, eine Art Notstandsdiktatur zu errichten, stellte das senatus consultum ultimum (s.c. de re publica defendenda) dar: videant consules, ne quid detrimenti res publica capiat, d.h. die Konsuln mögen dafür sorgen, dass der Staat keinen Nachteil erleidet. Es verschaffte den Konsuln nach Auffassung der Senatskreise unbeschränkte Befugnisse und spielte in der letzten Phase der Republik eine große Rolle (Rn. 96, 100, 102).
4. Die Volksversammlungen
88
Es gab verschiedene Einteilungen, nach denen das römische Volk sich versammelte; eine davon erfolgte nach Kurien (Rn. 41, 43). Die Kuriatkomitien hatten aber wohl nie politische Entscheidungsbefugnisse. Ihre Funktionen waren vor allem sakraler Natur. Die von ihnen den Imperiumsträgern (Konsuln, Prätoren) erteilte Bestätigung (lex curiata de imperio) war politisch eine bloße Formalität.
89
Am wichtigsten waren die Zenturiatkomitien (Rn. 43), in denen die männlichen römischen Bürger in Hundertschaften (Zenturien) eingeteilt waren. Tatsächlich geschah die Zuweisung durch die Zensoren entsprechend dem Einkommen, der Klasse und eine Zenturie war zahlenmäßig nicht beschränkt. Es gab
18 Ritterzenturien (Reiter), 80 Zenturien der 1. Klasse (Hopliten), 90 Zenturien Leichtbewaffnete, 4 Zenturien Handwerker und Musikanten, 1 Zenturie der vermögenslosen proletarii (infra classem), die nicht im Heer dienten.Insgesamt waren es 193 Zenturien. Es wurde zunächst in den einzelnen Zenturien abgestimmt, wobei die einfache Mehrheit entschied. Das Ergebnis gab vor, wie die Zenturie insgesamt abstimmte. Wenn die Ritterzenturien und die der ersten Einkommensklasse sich einig waren, hatten sie zusammen bereits die Mehrheit. Die Stimmen der Reichen in Einheiten mit wenigen Mitgliedern hatten also weitaus mehr Gewicht als die der Ärmeren in den kopfstarken Zenturien (timokratisches Prinzip). Die Zenturien versammelten sich auf dem Marsfeld (im Tiberbogen, heute Innenstadt Roms).
Die Zenturiatkomitien waren zuständig für die Wahl der Konsuln, Prätoren und Zensoren, für die Verabschiedung von Volksgesetzen auf Antrag der Konsuln und Prätoren sowie die Entscheidung über Strafanträge dieser Imperiumsträger und die provocatio ad populum (Rn. 79). Aus dieser Anrufung des Volkes gegen die Gewalt der Imperiumsträger entwickelte sich der Strafprozess vor den Zenturiatkomitien. Außerdem gab es Sondergerichte für Strafverfahren, die von Fall zu Fall eingerichtet wurden (quaestiones extraordinariae, Rn. 560).
90
Unpolitische Alltagskriminalität hingegen wurde seit dem 3. Jahrhundert von einem Kollegium dreier prätorischer Hilfsbeamter (tresviri capitales) geahndet. Sie übten eine Polizeijustiz aus bei Tötung, Brandstiftung, Waffenansammlung und Giftmischerei in krimineller Absicht, aber auch bei Diebstählen.
91
In der Volksversammlung wurde nur abgestimmt. Der einzelne Bürger hatte kein Recht, Anträge zu stellen. Das Recht der Initiative lag vielmehr nur bei den Magistraten (Konsuln und Prätoren in den Zenturiatkomitien). Für Beratungen und Diskussionsreden waren Vor-Versammlungen zuständig.
Die Abstimmung über Gesetze und Verurteilungen in den Zenturiatkomitien erfolgte zunächst mündlich, ab 139 v. Chr. mit Tontäfelchen. Zuerst wurde die Mehrheit innerhalb der Zenturien ermittelt. Die Abstimmung hörte auf, sobald sich eine Mehrheit der Zenturien für oder gegen einen Antrag entschieden hatte.
Bei Wahlen schrieb der Abstimmende den Namen des Kandidaten auf ein Täfelchen; hier entschied die absolute Mehrheit.
92
Aufgrund der Einteilung nach Stämmen (Rn. 41, 43) versammelte sich das Volk auch in Tribuskomitien. Hier wurden die kurulischen Ädilen und die Quästoren gewählt. Gesetzgebung durch die Tribuskomitien war hingegen selten. 220 v. Chr. legte man die Zahl auf 4 städtische und 31 ländliche Tribus fest. In den ländlichen Tribus waren die Vornehmen, vor allem die Großgrundbesitzer eingeschrieben (durch die Zensoren), das gewöhnliche Volk in den kopfstarken städtischen Tribus. Neubürger und Freigelassene kamen ebenfalls in die städtischen Tribus. Einberufen wurden die Tribuskomitien durch die Höchstmagistrate.
93
Nach tribus gegliedert waren auch die Versammlungen der Plebejer (concilia plebis). Gewählt wurden die Volkstribune und die plebejeschen Ädilen. Das Recht zur Einberufung und Antragstellung lag bei den Volkstribunen. Die hier ergangenen Beschlüsse (Plebiszite) banden zunächst nur die Plebejer. Ab 287 v. Chr. (lex Hortensia) galten Plebiszite als Gesetze für das gesamte Volk, also auch für die zahlenmäßig relativ gesehen gering gewordenen Patrizier. Damit stieg die Bedeutung dieser Versammlung. Auch fungierte die concilia plebis später als Volksgerichte zur Aburteilung von Staatsverbrechen.
94
Die römische Republik war nach alledem von der Demokratie recht weit entfernt. Die Mehrheit der Bevölkerung des Reiches, nämlich Frauen, Peregrine, Sklaven, aber auch die Latini hatten keinen Anteil an den politischen Entscheidungen der Zentralgewalt. Rom war im Wesentlichen eine Aristokratie mit einer gewissen Teilhabe der übrigen männlichen römischen Bürger an der Macht. Dennoch pries der in der Staatsphilosophie Platons und Aristoteles' bewanderte griechische Historiker Polybios die römische Verfassung als ideal wegen ihrer ausgewogenen Elemente der Aristokratie (Senat), Monarchie (Magistraturen) und Demokratie (Volksversammlungen).[4] Cicero übernahm diese Charakterisierung als Grundlage für seine Schrift de re publica.[5]