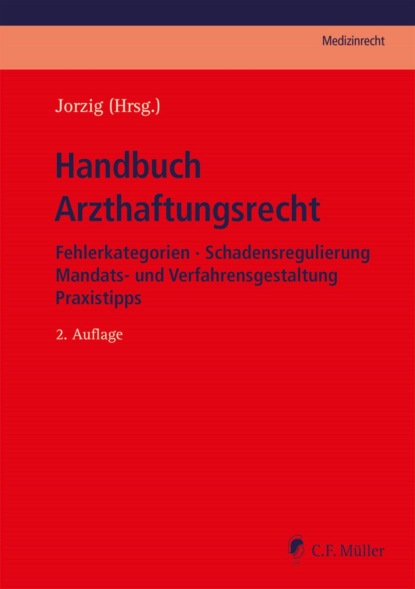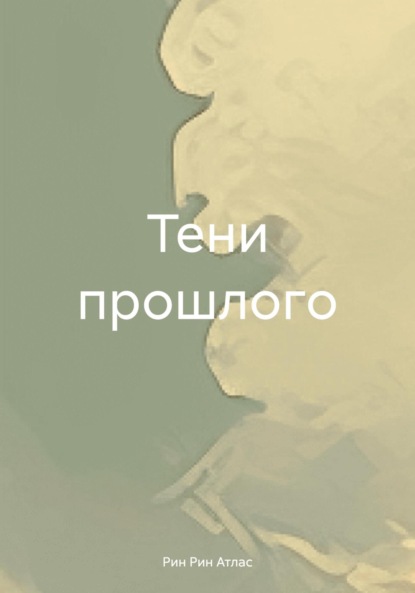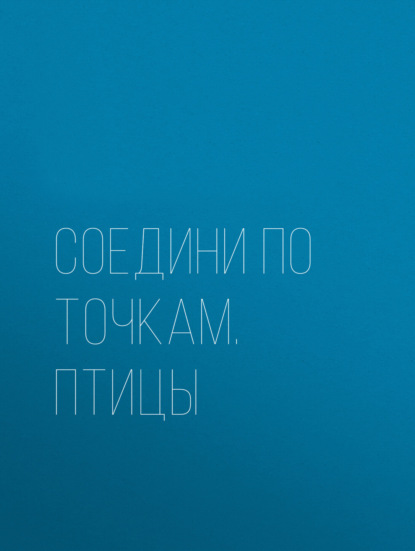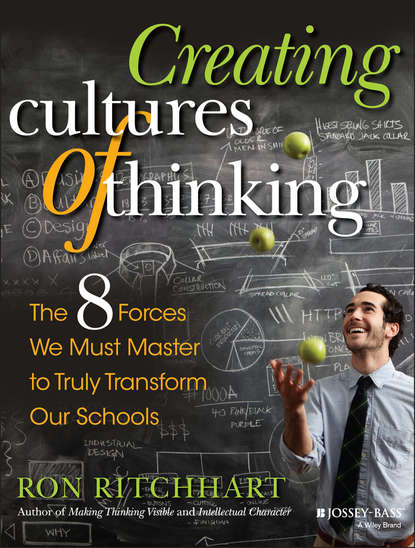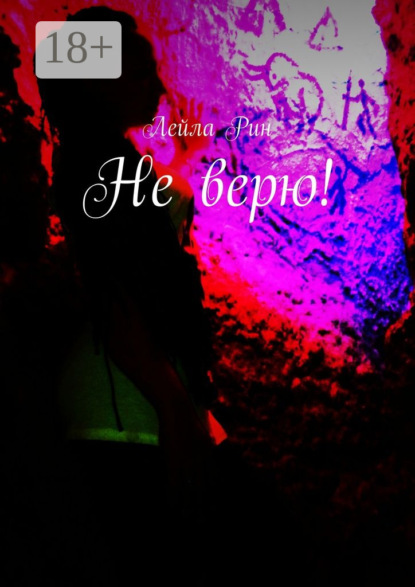Rechtssicher argumentieren!
Das Handbuch Arzthaftungsrecht erschließt systematisch die Besonderheiten des Arzthaftungsrechts auf der Basis des Patientenrechtegesetzes. Orientiert an der Praxisrelevanz erläutern erfahrene Praktiker umfassend die materiellrechtlichen und verfahrensrechtlichen Grundlagen und geben wertvolle Hinweise zum Mandatsmanagement auf Patienten- und auf Arztseite von Mandatsannahme bis -beendigung.
90 % der Haftungsfälle werden in außergerichtlichen Verfahren abgeschlossen, dort liegt ein Schwerpunkt bei der Tätigkeit des RA im arzthaftungsrechtlichen Mandat. Dementsprechend praxisrelevant sind die Tipps des Autorenteams für außergerichtliche Verfahren. Indem das Handbuch die Dogmatik des Arzthaftungsrechts herausarbeitet, gibt es Argumentationshilfen auch bei neuen Problemkonstellationen.
In der 2. Auflage werden neue Kapitel zu E-Health und zum Rettungsdienstrecht aufgenommen und die einschlägigen (höchstrichterlichen) Entscheidungen ausgewertet und kritisch beleuchtet, z.B. zum taggenauen Schmerzensgeld und zum Umgang mit Patientenverfügungen.
<br/>
Zum materiellen Recht:
<br/>
– Haftungsgrundlagen, Praxisbewährung des Patientenrechtegesetzes, Verjährungsproblematik
– Behandlungsfehler mit aktuellen Schwerpunkten Entlassmanagement, Geburtsschadensrecht sowie Zahnarzthaftung
– Aufklärungsfehler (Einwilligung, Entscheidungskonflikte, Beweislasten und Sonderprobleme)
– Schaden, Schadensarten und Schmerzensgeld mit Berechnungsbeispielen Zur außergerichtlichen Tätigkeit:
<br/>
– Mandatsmanagement auf Patienten- und auf Arztseite
– Strafverfahren und Compliance
– Arbeitsrechtliche Fragestellungen, z.B. Überlastungsproblematik und Auskunftsansprüche
– Arzthaftpflichtversicherung, insbesondere Deckungsschutz
– Mediation.Zum Verfahrensrecht:
<br/>
– Besonderheiten des Arzthaftungsrechts
– Passivlegitimation
– Sachaufklärung, Streitgegenstand und Beweiskraft
– Sachverständigenbeweis
– Prozessvergleich.
- Книги
- Аудиокниги
- Вебтуны
- Жанры
- Cаморазвитие / личностный рост
- Зарубежная психология
- Попаданцы
- Боевая фантастика
- Современные детективы
- Любовное фэнтези
- Зарубежные детективы
- Современные любовные романы
- Боевое фэнтези
- Триллеры
- Современная русская литература
- Зарубежная деловая литература
- Космическая фантастика
- Современная зарубежная литература
- Все жанры
- Бесплатные книги
- Блог
- Серии
- Черновики
Вход В личный кабинетРегистрация