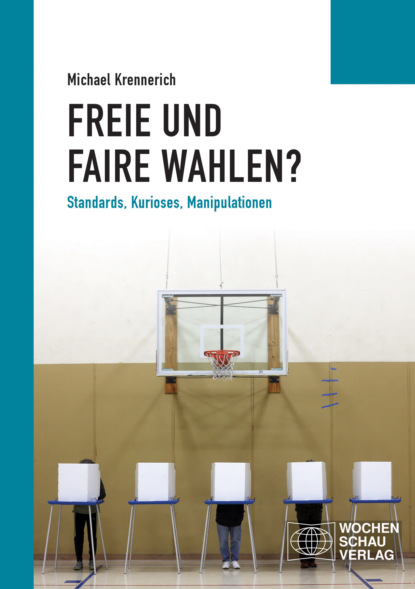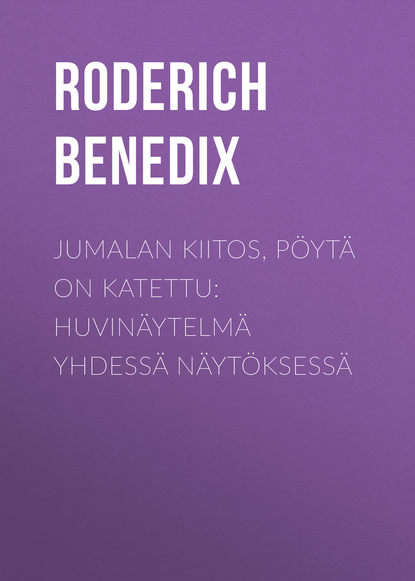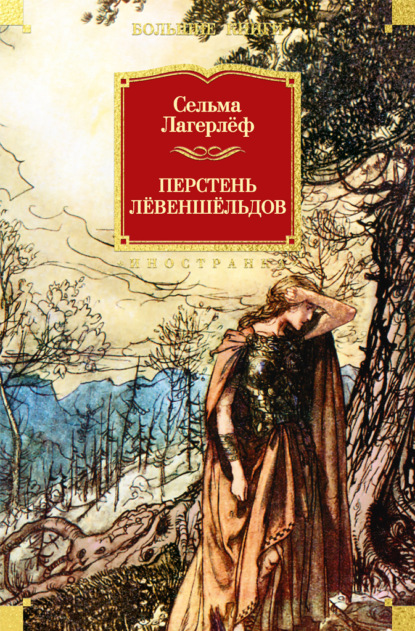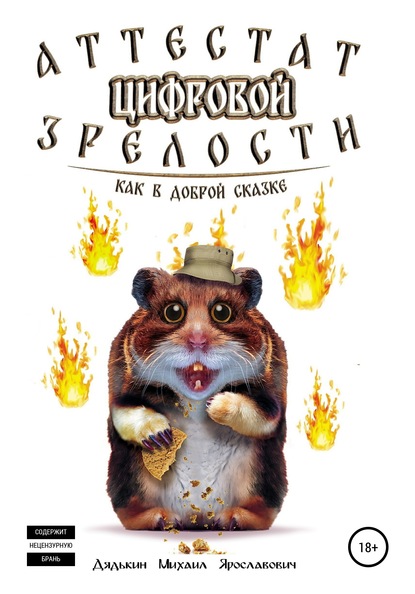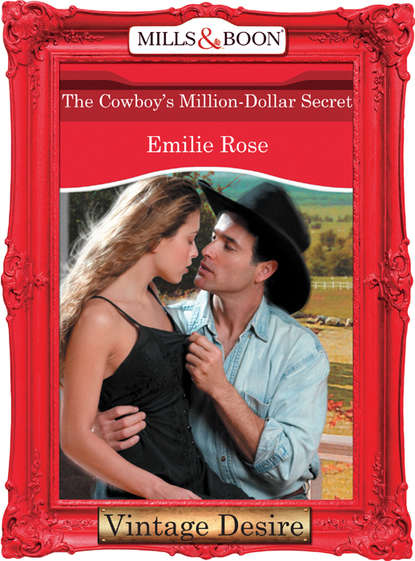- -
- 100%
- +
Bei den russischen Präsidentschaftswahlen im Jahr 2018 beispielsweise war zwar eine große ODIHR-Wahlbeobachtungsmission zugegen. Doch blieb etlichen anderen „unerwünschten“ ausländischen Wahlbeobachtungsorganisationen eine Einreise verwehrt. Auch lud die Regierung eigens rund 300 Personen (darunter auch AfD-Politiker aus Deutschland) zur Wahlbeobachtung ein, die hauptsächlich dazu dienten, die „Legitimität“ der Wahlen zu bestätigen. Da der Regierung an einer hohen Wahlbeteiligung gelegen war, nutzte sie ferner regimeloyale nationale Wahlbeobachtungsgruppen, um die Bürgerinnen und Bürger zur Wahlteilnahme zu bewegen.49 Regimekritische nationale Wahlbeobachtungsteams wurden hingegen schikaniert. Zugleich setzte die Regierung darauf, dass der eigentliche Wahltag, auf den sich die Hauptaufmerksamkeit von Kurzzeitwahlbeobachtungen richtete, vergleichsweise ruhig und geordnet verlief, was internationale Wahlbeobachtungsteams – trotz mancher Unregelmäßigkeit – auch bestätigten. Allerdings machte ODIHR deutlich, dass im Vorfeld der Wahlen deren Freiheit und Fairness unzulässig beschnitten worden waren. Noch deutlicher war dies bisher in Belarus der Fall, wo ebenfalls internationale und (vorwiegend regimeloyale) nationale Wahlbeobachtungsteams die Wahlbeteiligung erhöhen und einen geordneten Wahlvorgang bezeugen sollten.
Dass Wahlautokratien inzwischen gezielt versuchen, über ihnen genehme Wahlbeobachtungen Legitimation für nur beschränkt kompetitive Wahlen zu gewinnen, lässt sich auch für andere Länder feststellen. In Kambodscha sollten beispielsweise fragwürdige internationale und nationale Wahlbeobachtungsgruppen den Umstand kompensieren, dass etliche anerkannte internationale Organisationen keine Wahlbeobachtungsteams zu den schon im Vorfeld erkennbar undemokratischen Parlamentswahlen 2018 entsandten.50 Auch bei den Präsidentschaftswahlen 2019 in Kasachstan und den Parlamentswahlen 2020 in Aserbaidschan wurde von ODIHR die politische Unabhängigkeit manch nationaler Wahlbeobachtungsgruppen infrage gestellt. Dies zeigt einmal mehr, dass die Verantwortlichen in Autokratien gelernt haben, auch Wahlen für ihre Zwecke zu nutzen. Gleichwohl bleiben internationale und nationale Wahlbeobachtungen, sofern sie seriös und unabhängig durchgeführt werden, wichtige Garanten für die Durchführung freier und fairer Wahlen, vor allem in jungen und entstehenden Demokratien. Auch zeitigen sie Auswirkungen auf den Wahlwettbewerb in Autokratien.51
34 Vgl. Nohlen 1978, 2014, Krennerich 1993, 1996a und 2000.
35 Vgl. den Code of Good Practice in Electoral Matters des Europarates (CDL-AD (2002) 023rev2-cor) sowie die Wahlmanuals von OSCE/ODIHR (2012), der Europäischen Union (European Union 2016), der Organisation Amerikanischer Staaten (OEA 2008) und der Afrikanischen Union (African Union 2013) – sowie die Handbücher etlicher nicht staatlicher Organisationen, die Wahlberatung und Wahlbeobachtung durchführen, wie das Electoral Institute for Sustainable Democracy in Africa (EISA), International IDEA (Institute for Democratic and Electoral Assistance), die International Foundation for Electoral Systems (IFES), das Centro de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL) des Interamerikanischen Instituts für Menschenrechte (IIDH) oder auch die International Human Rights Law Group, für die Larry Garber bereits 1984 Richtlinien für Wahlbeobachtung erstellt hat.
36 Norris/Grömping 2019.
37 Zur Diskussion des dem Index zugrunde liegenden Konzepts der Integrität der Wahlen siehe etwa: Garrido/Nohlen 2019.
38 Vgl. Borneo 2000. Siehe auch Harneit-Sievers 1990, Tötemeyer/Wehmhörner/Weiland 1996.
39 Vgl. Krennerich 1993.
40 Datengrundlage: ODIHR Annual Reports.
41 Entsprechende Daten finden sich auf der Website des European External Action Service der EU.
42 Vgl. etwa Mair 1994.
43 Vgl. National Democratic Institute 1996.
44 Vgl. Middlebrook 1998.
45 Vgl. https://www.epde.org.
46 Vgl. https://gndem.org.
47 Das Kopenhagener Dokument (1990) besagt, dass sich alle OSZE-Teilnahmestaaten untereinander eine standing invitation zur Wahlbeobachtung aussprechen. So gesehen bräuchte es gar keine ausdrückliche Einladung mehr. Im politischen Tagesgeschäft hat sich jedoch eingebürgert, dass eine solche Einladung erfolgt.
48 Behnke/Grotz/Hartmann 2017: 40.
49 Das russische Wahlgesetz erlaubt, dass Kandidatinnen und Kandidaten, Parteien, Medien sowie seit 2017 sogenannte Zivilkammern nationale Wahlbeobachterinnen und -beobachter benennen.
50 Siehe Morgenbesser 2019: 168 ff.
51 Vgl. etwa Roussias/Ruiz-Rufino 2018.
3. DER ORGANISATORISCHE UND RECHTLICHE RAHMEN
Wer organisiert die Wahlen?
„Wer auszählt, gewinnt“, heißt ein alter Diktatorenspruch, der getrost auf die gesamte Wahlorganisation ausgeweitet werden kann. Die Freiheit und Fairness der Wahl hängen entscheidend davon ab, wer die Wahlen durchführt und kontrolliert.
Da Wahlen ein ureigener Akt staatlicher Souveränität sind, ist es zunächst wichtig, dass nationale Institutionen die Verantwortung für die Organisation von Wahlen übernehmen. Allenfalls in besonderen Situationen sollten internationale Organisationen in die Wahlorganisation eingebunden sein. Dies war besonders deutlich in Kambodscha der Fall: Nach dem Pariser Friedensabkommen von 1991 organisierte die United Nations Transitional Authority in Cambodia (UNTAC) die dortigen Wahlen von 1993, errichtete gewissermaßen eine Wahlinfrastruktur aus dem Nichts.52 So weit ging die Rolle der internationalen Staatengemeinschaft im Rahmen des Friedensprozesses in Bosnien-Herzegowina zwar nicht, aber immerhin waren dort bei den Wahlen 1997, 1998 und 2002 internationale Mitglieder, darunter der Leiter der OSZE-Mission, in die Provisional Electoral Commission einbezogen. Die nationalen Wahlen des Jahrs 2006 waren die ersten, die dort nach dem Zerfall Jugoslawiens ohne internationale Beteiligung durchgeführt wurden.
Wichtig ist weiterhin, dass die für die Wahlorganisation zuständigen Stellen unabhängig, professionell und transparent arbeiten. In vielen etablierten Demokratien, in denen Wahlen eine lange Tradition aufweisen, werden Wahlen von Behörden organisiert, die der Exekutive auf nationaler, regionaler und/oder lokaler Ebene unterstellt sind. Häufig spielt hier das Innenministerium eine wichtige Rolle. In Deutschland ist beispielsweise das „Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat“ formal die oberste staatliche Wahlbehörde. Mit der Vorbereitung, Durchführung und Überprüfung der Wahl beauftragte Wahlorgane sind allerdings der Bundes-, die Landes- und die Kreiswahlleiter sowie zur Überprüfung von Wahlbeschwerden ein Bundeswahl-, ein Landeswahl- und der Kreiswahlausschuss. Hinzu kommt ein Wahlvorstand für jeden Wahlkreis zur Feststellung der Briefwahlergebnisse. Die Bundeswahlleitung wird vom Innenministerium auf unbestimmte Zeit bestellt, die Landeswahlleitung, die Kreiswahlleitung und der Wahlvorstand von der jeweiligen Landesregierung (oder der von ihnen bestimmten Stelle).53
Im Fall einer professionellen, parteipolitisch unabhängigen Verwaltung ist ein governmental model of electoral management für gewöhnlich kein Problem. Gleichwohl haben einige etablierte Demokratien eigenständige Wahlkommissionen eingeführt, um die Unabhängigkeit vis-à-vis der Regierung zu stärken: so etwa Kanada (1920), Indien (1950) und Australien (1984). Vor allem in Staaten mit einer wenig entwickelten demokratischen Kultur oder autoritären Wahlerfahrungen sind von der Regierung ernannte und der Exekutive unterstellte Wahlbehörden oft nicht angebracht. Hier sind von der Regierung unabhängige Wahlkommissionen (independent model of electoral management) vorzuziehen, weil ansonsten die Gefahr besteht, dass die Regierung auf die Durchführung der Wahlen Einfluss nimmt, und zwar zu ihren Gunsten. Dementsprechend wurden weltweit im Zuge politischer Öffnungs- und Demokratisierungsprozesse regierungsunabhängige Wahlkommissionen gefordert und (wieder-)eingeführt, auch in Ost(mittel)europa.
Vorreiter ist hier jedoch Lateinamerika, wo die Bemühungen um saubere Wahlen eng mit der Entwicklung der Demokratie im 20. Jahrhundert zusammenhingen. Tatsächlich stellt Lateinamerika geradezu eine „paradigmatische Region“ für unabhängige Wahlkommissionen dar, die im Zuge der (Re-)Demokratisierung ab den 1980er Jahren ausgebaut und professionalisiert wurden.54 So verfügen alle lateinamerikanischen Staaten, die Mehrparteienwahlen durchführen, über eigenständige Wahlkommissionen, deren Unabhängigkeit zumeist verfassungsrechtlich garantiert ist. Mitunter fungieren sie sogar im Sinne eines Poder Electoral als vierte verfassungsmäßige Gewalt neben Exekutive, Legislative und Judikative. Die Wahlkommissionen in Lateinamerika sind dabei oft für die gesamte Wahlorganisation – von der Wählerregistrierung bis zur Anerkennung der Wahlen – zuständig, verfügen über eigene Haushaltsmittel und sind der Exekutive gegenüber nicht rechenschaftspflichtig. Vor allem werden ihre Mitglieder nicht von der Regierung bestellt. Damit unterscheiden sie sich von so manchen Wahlkommissionen in anderen Ländern, die nur über wenige Kompetenzen verfügen. Die „Nationale Autonome Wahlkommission“ im Senegal beispielsweise überwacht lediglich die Wahlen, organisiert sie aber nicht selbst.55
Formal unabhängige Wahlkommissionen gibt es inzwischen auch in vielen anderen Ländern weltweit – von „A“ wie Afghanistan bis „Z“ wie Zambia. Die Verfassung des Jahrs 2014 in Tunesien hat beispielsweise die Unabhängigkeit der Wahlkommission verankert. Dies heißt selbstverständlich nicht, dass formal unabhängige Wahlkommissionen tatsächlich immer unabhängig agieren, schon gar nicht in Wahlautokratien. Auch reicht es sicherlich nicht, nur ein Independent vor den Namen der Wahlkommission zu setzen, wie dies in Uganda 2015 geschehen ist, um die von der dortigen Opposition geforderte Unabhängigkeit der Wahlkommission zu gewährleisten. Auch ist stets zu prüfen, welche Aufgaben und Kompetenzen die Wahlkommissionen bei der Durchführung und Kontrolle der Wahlen innehaben – und ob sie diese mit Regierungsbehörden teilen (mixed model). Der Electoral Management Design Database von International IDEA zufolge orientierten sich die Wahlorgane in 215 Staaten und abhängigen Gebieten zu 63 % an einem independent model, zu 21 % an einem governmental model und zu 14 % an einem mixed model. Die übrigen 2 % hielten keine nationalen Wahlen ab.56
Während von der Regierung eingesetzte Wahlbehörden in der Regel von Verwaltungsbeamten geleitet werden, ist die Zusammensetzung eigenständiger Wahlkommissionen ein Politikum, zumal in solchen Ländern, in denen großes Misstrauen zwischen den politischen Kontrahenten herrscht. Reformbestrebungen zielen zunächst darauf ab, den Einfluss der Regierung auf die Zusammensetzung zurückzudrängen, um tatsächlich deren Unabhängigkeit zu gewährleisten. In einigen Ländern wurde oder wird nämlich selbst im Falle angeblich unabhängiger Wahlkommissionen der Regierung die Möglichkeit eingeräumt, eine gewisse Anzahl an Kommissionsmitgliedern zu benennen. Hier empfiehlt es sich, die Zahl der durch die Regierung ernannten Personen möglichst gering zu halten und eine Übermacht regierungsnaher Mitglieder zu vermeiden. Sinnvoll ist zudem, dass zumindest ein Teil der Mitglieder von unpolitischen Institutionen berufen wird, die als unabhängig wahrgenommen werden. Das können Gerichte sein, sofern diese nicht als korrupt gelten, oder andere Institutionen, die im Land Vertrauen genießen.
Falls alle oder einige Mitglieder der Wahlkommission vom Parlament bestellt werden, kann es zudem angebracht sein, dass diese mit qualifizierten Mehrheiten – etwa mit einer Zweidrittelmehrheit wie in Tunesien – gewählt werden. Soweit von Parteien entsandte Personen in die Wahlkommission eingebunden werden, ist eine ausgeglichene Balance zwischen Regierungs- und Oppositionsparteien sicherzustellen. Allerdings geht mit einer – selbst ausgeglichen – parteilichen Zusammensetzung der Wahlkommission die Gefahr einer Politisierung einher. So kann es sein, dass die Kommissionsmitglieder eher im Interesse ihrer Partei als im Sinne der Wählerschaft agieren. In Albanien, wo die Wahlkommission von den zwei größten Parteien im Parlament beherrscht wird, kam es in der Vergangenheit beispielsweise immer wieder zur Politisierung wahlorganisatorischer Probleme.57
Auf alle Fälle sollte das Wahlgesetz eindeutige und transparente Regelungen für die Nominierung der Kommissionsmitglieder beinhalten. Verstärkt eingefordert wird dabei auch eine angemessene Vertretung von Frauen, die in den jeweiligen Wahlkommissionen oft unterrepräsentiert sind. Anzuraten wäre gewiss auch die Einbeziehung von Menschen mit Behinderung. Eine feste Amtszeit sowie klare Regeln für eine Absetzung nur unter besonderen Bedingungen stellen zudem institutionelle Vorkehrungen zur Sicherung einer etwaigen Unabhängigkeit dar. Dies ist nötig, denn es kann Versuche geben, missliebige Kommissionsmitglieder aus dem Amt zu entfernen.
In Bezug auf die Arbeitsweise der Wahlkommissionen sind Transparenz und Inklusion geboten, um die Legitimität der Wahlen zu erhöhen. Die Vorgaben und Entscheidungen der Kommissionen sollten öffentlich nachvollziehbar sein und möglichst einvernehmlich zustande kommen. Zugleich sind die mit der Wahl betrauten Personen, gerade auch auf lokaler Ebene, gut zu schulen, zumal, wenn neue Wahlvorschriften oder Technologien zur Anwendung kommen. Mit der zunehmenden Digitalisierung der Wahladministration müssen die Wahlbehörden zudem Vorkehrungen treffen, um die Wahlinfrastrukturen vor Hacker-Angriffen zu schützen und die Datensicherheit zu gewähren. Entsprechende Schulungen und Trainingsprogramme werden, ggf. mit internationaler Unterstützung, durchgeführt. Im Idealfall werden auch umfassende Informationen zu den Wahlen oder dem Wahlprozedere im Rahmen sogenannter voter-education-Programme vermittelt, einschließlich von Maßnahmen zum kompetenten Umgang mit Desinformationen in sozialen Medien. Den mit der Wahlorganisation betrauten Organen kommt hierfür eine große Verantwortung zu. Wichtig ist dabei, dass die Wahlinformationen auch in der Sprache nationaler Minderheiten und für Menschen mit Behinderungen verfügbar sind.
Wahlgesetze – eindeutig, verständlich und anwendbar?
Die Durchführung demokratischer Wahlen bedarf eines klaren rechtlichen Rahmens. Grundlegende demokratische Wahlprinzipien sollten in der Verfassung verankert sein. Dort ist für gewöhnlich auch festgelegt, welche politischen Institutionen gewählt werden. Die meisten Aspekte des Wahlprozesses sind freilich gesetzlich geregelt. Vorzugweise sind die zentralen Regelungsbereiche in einem einzigen Wahlgesetz gebündelt und nicht über eine Vielzahl an Gesetzen und Dekreten verteilt, wie dies etwa in Italien der Fall ist. Auch beispielsweise in Großbritannien sind die Rechtsgrundlagen der Wahlen stark fragmentiert, unübersichtlich und schwierig anzuwenden.58 Ebenso wenig sollten Inkonsistenzen mit anderen Gesetzen auftreten, die für den Wahlprozess bedeutsam sind, wie etwa mit Parteien-, Medien- oder auch Strafgesetzen.
In Deutschland wird das vergleichsweise dünne Wahlgesetz, das in gerade einmal 52 gültigen Paragrafen die Durchführung der Bundestagswahlen regelt, durch die Bundeswahlordnung konkretisiert und durch weitere Gesetze, wie das Abgeordneten-, das Parteien-, das Wahlprüfungs- sowie das Wahlstatistikgesetz, ergänzt. Hinzu kommt die Bundeswahlgeräteverordnung. Auch einzelne Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs, des Strafgesetzbuchs und des Bundesverfassungsgerichtsgesetzes sind als Rechtsgrundlagen für die Bundestagswahlen maßgeblich. Entsprechend umfangreich ist der über 1.000-seitige Kommentar zum Bundeswahlgesetz.59
Im Idealfall umfassen die wahlgesetzlichen Regelungen den gesamten Wahlprozess. Gelegentlich weisen Wahlgesetze in Demokratien aber Regelungslücken auf oder enthalten, wie wir noch sehen werden, Bestimmungen, die für entstehende und junge Demokratien wenig angemessen erscheinen. Hingegen sind die Wahlgesetze vieler nicht konsolidierter Demokratien oder gar mancher Wahlautokratien oft umfassender und regeln detailreich den Wahlprozess. Dies ist nicht zuletzt auf das Betreiben von Wahlberatungs- und Wahlbeobachtungsorganisationen zurückzuführen, die immer wieder Wahlgesetzreformen anmahn(t)en. Dahinter steht die Idee, dass angesichts einer fehlenden oder sich erst herausbildenden demokratischen Wahlkultur mit den Mitteln des Rechts darauf hingewirkt werden soll, dass die Wahlen demokratischen Ansprüchen genügen. European Commission for Democracy Through Law heißt bezeichnenderweise die „Venedig-Kommission“ des Europarats, die zahlreiche neue Wahlgesetze in Mittel- und Osteuropa einer kritischen Prüfung unterzogen hat. In vielen Fällen hat dies zu einer erheblichen Verbesserung des rechtlichen Rahmens der Wahlen geführt; mitunter kann es aber auch zu einer Überregulierung kommen. Denn dort, wo alles im kleinsten Detail geregelt ist, bleibt kein Platz für notwendige Anpassungen durch die – im Idealfall unabhängig und professionell arbeitenden – Wahlbehörden und kommt es zwangsläufig zu Verstößen, wenn die Einhaltung der Wahlregeln nicht eingeübt ist. Dies wiederum kann von autoritären Machthabern genutzt werden, um politische Kontrahenten wegen Wahlverstößen zu belangen.
Letztlich sollten Wahlgesetze eindeutig, verständlich und leicht anwendbar sein. Im Falle des Wahlgesetzes in Albanien, um nur eines von vielen Beispielen herauszugreifen, kritisierte ODIHR beispielsweise einen Mangel an Klarheit einiger Bestimmungen. Auch ist es wichtig, dass die Wahlgesetze nicht andauernd und nicht unmittelbar vor den Wahlen geändert werden, es sei denn, es müssen schwerwiegende Mängel behoben werden. In Italien unterliegt das Wahlsystem ständigen Änderungen und wurden noch wenige Monate vor den Parlamentswahlen 2018 hastig Wahlreformen durchgeführt. Besonders problematisch ist, wenn der Verdacht aufkommt, dass kurzfristige Wahlgesetzänderungen der Regierungspartei zugutekommen, wie dies beispielsweise im Vorfeld der türkischen Wahlen von 2018 beanstandet wurde.60 Auch der – letztlich gescheiterte – Versuch der Regierung Polens, mittels einer Last-Minute-Umstellung auf eine reine Briefwahl den für sie günstigen Termin der Präsidentschaftswahl im Mai 2020 auch während der Corona-Pandemie zu halten, war politisch motiviert und stieß auf heftige Kritik der Opposition. Völlig verwirrend waren schließlich die vielen Veränderungen der Wahlregularien vor den Wahlen in Thailand 2019. Die dortige Militärjunta verschob nach dem Putsch von 2014 nicht nur mehrfach den angekündigten Wahltermin, sondern änderte auch verschiedentlich die Voraussetzungen für eine Wahlbewerbung.
52 Vgl. Sullivan 2016.
53 Siehe §§ 8 f. BWahlG.
54 Zovatto 2017; vgl. auch: Jaramillo 1994, Valdés/Ruiz 2019.
55 Vgl. Riedl/Samba Sylla 2019: 100.
56 https://www.idea.int/data-tools/data/electoral-management-design.
57 Vgl. die jeweiligen ODIHR-Berichte zu den dortigen Wahlen.
58 Vgl. Law Commission of England and Wales/Scottish Law Commission 2020.
59 Schreiber 2017.
60 Vgl. CDL-AD(2018)031.
4. DAS WAHLRECHT ALS BÜRGER- UND MENSCHENRECHT
Das Wahlrecht stellt ein grundlegendes demokratisches Recht dar. Vom Bundesverfassungsgericht wurde es ehedem als das „vornehmste Recht“ der Bürgerinnen und Bürger im demokratischen Staat geadelt.61 Es ist nicht nur in den meisten nationalen Verfassungen, sondern auch in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte (AEMR) von 1948 und in zahlreichen internationalen Menschenrechtsabkommen fest verankert. In der AEMR ist es dem Wortlaut nach als ein Menschenrecht ausgewiesen, das jedem Menschen zusteht. Gleichwohl ist es mit einer wichtigen Konkretisierung hinsichtlich des räumlichen Anwendungsbereichs versehen: Jeder Mensch hat das Recht, in seinem Land zu wählen und gewählt zu werden.
„Jeder [Mensch] hat das Recht, an der Gestaltung der öffentlichen Angelegenheiten seines Landes unmittelbar oder durch frei gewählte Vertreter mitzuwirken. […] Der Wille des Volkes bildet die Grundlage für die Autorität der öffentlichen Gewalt; dieser Wille muss durch regelmäßige, unverfälschte, allgemeine und gleiche Wahlen mit geheimer Stimmabgabe oder einem gleichwertigen freien Wahlverfahren zum Ausdruck zu kommen.“ (Art. 21 AEMR).
Der Internationale Pakt über bürgerliche und politische Rechte (kurz: UN-Zivilpakt) von 1966 (seit 1976 in Kraft) formuliert das Wahlrecht als einziges Menschenrecht bereits dem Wortlaut nach nur noch als Staatsbürgerrecht:
„Jeder Staatsbürger [sic] hat das Recht und die Möglichkeit, ohne Unterschied nach den in Artikel 2 genannten Merkmalen und ohne unangemessene Einschränkungen
1. an der Gestaltung der öffentlichen Angelegenheiten unmittelbar oder durch frei gewählte Vertreter teilzunehmen;
2. bei echten, wiederkehrenden, allgemeinen, gleichen und geheimen Wahlen, bei denen die freie Äußerung des Wählerwillens gewährleistet ist, zu wählen und gewählt zu werden; […]“ (Art. 25 UN-Zivilpakt)
Auch weitere internationale Menschenrechtsabkommen beinhalten das Wahlrecht. Nachdem das UN-Übereinkommen über die politischen Rechte der Frau von 1953 das gleiche aktive wie passive Wahlrecht für Frauen vorgesehen hatte, wurde dies beispielsweise nochmals im UN-Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung von Frauen aus dem Jahr 1979 (seit 1981 in Kraft) ausdrücklich garantiert. Die UN-Behindertenrechtskonvention von 2006 (2008) wiederum verpflichtet die Vertragsstaaten, die gleichberechtigte und barrierefreie Nutzung des aktiven und passiven Wahlrechts für Menschen mit Behinderungen sicherzustellen. Ebenso sehen die regionalen Menschenrechtsschutzsysteme in Europa, Amerika und Afrika das allgemeine aktive und passive Wahlrecht vor, freilich auch hier verstanden als gleiche Rechte, die jeder Mensch im eigenen Land ausübt. Indes gibt es auch eine Reihe unverbindlicher Empfehlungen, der ausländischen Wohnbevölkerung zumindest auf subnationaler Ebene das Wahlrecht einzuräumen.
Ungeachtet der völkerrechtlichen Vorgaben gewähren nicht alle Staaten ihren Staatsangehörigen das Wahlrecht, oder sie verwehren ihnen die Möglichkeit, dieses auszuüben. In manchen Staaten, etwa in Brunei, China, Katar, Saudi-Arabien oder den Vereinigten Arabischen Emiraten, sind gar keine allgemeinen und direkten Wahlen zum Parlament vorgesehen, in anderen Staaten wie etwa Eritrea oder Somalia, haben sie noch nicht (oder seit Langem nicht mehr) stattgefunden. Dort, wo sie stattfinden, ermöglichen Wahlen zudem nicht unbedingt die „freie Äußerung des Wählerwillens“ und entsprechen oft nicht den Standards, die inzwischen international an freie und faire Wahlen angelegt werden. Das gilt vor allem für Wahlen in Autokratien, in denen die Freiheit und Fairness der Wahlen bereits regimebedingt stärker beeinträchtigt sind als in liberalen Demokratien. Aber auch in jungen Demokratien kommt es immer wieder zu Unregelmäßigkeiten bei der Wahldurchführung und ist der übergeordnete politische Kontext dem demokratischen Bedeutungsgehalt der Wahlen nicht immer zuträglich. Selbst in etablierten Demokratien liegt mitunter einiges im Argen. Auch dort weisen das Wahlrecht und die Wahlpraxis gelegentlich Eigenarten auf, die überholt oder gar undemokratisch anmuten.
61 BVerfGE 1, 14 (33).
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.