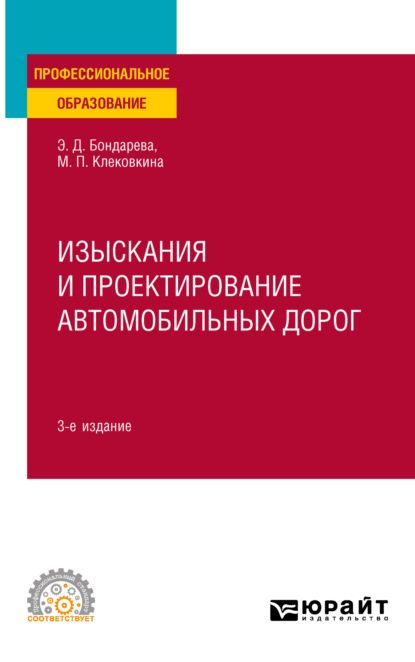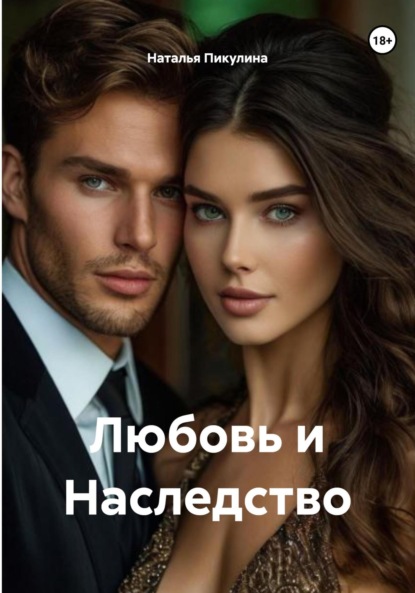Maritime E-Bibliothek: Sammelband Abenteuer und Segeln

- -
- 100%
- +
Mangrovensümpfe zum Verkaufen
Die besten Siedler und Landgewinner an den Küsten der tropischen Meere sind die Mangroven. Gegen sie nehmen sich selbst die Holländer mit ihrem Spruch: „Gott schuf die Welt, die Niederländer aber Holland!“ als Anfänger aus. Überall, wo es flache Küsten gibt, zu beiden Seiten von Flußufern oder in Sümpfen, haben sie sich angesiedelt und fangen mit ihren viel verzweigten Wurzelarmen wertvolle Sedimentstoffe des Meeres ab.
Normalerweise können Wurzeln im Wasser nicht atmen. Was macht also die Mangrove? Sie schnorchelt! Ihre Wurzeln schicken kleine Atmungsröhren in die Höhe, die den Sauerstoff in die Wurzelspitzen leiten.
In Florida kaufen die Grundstücksmakler Mangrovensümpfe auf, die noch ganz unter Wasser liegen. Ich sah aus diesen Mangrovenwäldern Schilder herausragen: FOR SALE – Zum Verkauf. Die Mangrove ist der stille und bescheidene Mitarbeiter der Grundstücksmakler. Tausende von Hektar Land schenkt sie der Menschheit; in vielen Teilen der Welt setzt man ihre Siedlungsarbeit fort, indem man den Mangrovenwald entfernt und Land aufschüttet. Ich konnte das in Lagos und in Miami beobachten.
Sausen Tornados oder Hurrikane über ein Gebiet, in dem Mangroven zu Hause sind, so werden andere Bäume entwurzelt, Häuser zerstört und ganze Plantagen niedergewalzt, die Mangroven jedoch erleiden kaum Schaden. Sie sind niedrige Bäume, selten werden sie höher als fünf Meter, ihre dünnen, auf Stelzwurzeln stehenden Stämme stemmen sie nicht gegen den Wind, sie wiegen sich im Sturm wie Kokospalmen. Die Mangrove ist vorsichtig und klug; reißt ein Wurzelanker, hat sie gleich Ersatz zur Hand: sie sendet von Stämmen und Zweigen immer neue Wurzeln in den Schlammgrund, die selbst wieder zu Bäumen werden. Ihr ganzes Leben steht sie auf Stelzen, die wie ein polnischer Weichselzopf unentwirrbar miteinander verflochten sind.
In dem stinkigen, schleimigen Mangrovenschlamm lebt eine Tierwelt für sich; sie lehnt es ab, sich anderswo aufzuhalten, nur in diesem Schlamm fühlt sie sich wohl. Da ist zum Beispiel ein Mangrovenkrebs, der seine Scheren immer dann zusammenschlägt, wenn man es am allerwenigsten erwartet; weil man bei diesem Geräusch erschreckt zusammenfährt, nennt man ihn auch „Pistolenkrebs“, obschon er eine zarte Garnele ist und kein Pistolenheld.
Fische klettern auf Bäume
Interessanter noch ist der Schlammspringer, den ich am Du-River in Liberia häufig antraf. Er hat Augen, die er beim Schwimmen wie ein Periskop über Wasser halten und in jede beliebige Richtung drehen kann, jedes Auge in eine andere. Er klettert mit Hilfe seiner Brustflossen auf Mangroven und springt bis zu einem Meter weit; sonnt er sich in der heißen Tropensonne, braucht er keine Sonnenbrille, kann er seine Augen doch ganz in die Augenhöhlen zurückziehen. Hält er sich an der Land-Wasser-Grenze auf, steckt er seinen Schwanz ins Wasser, um zu „atmen“: der Schwanz ist voller Blutgefäße, die dem Wasser Sauerstoff entziehen können und auf diese Weise die dicht verschließbaren Kiemen ersetzen. Der Schlammspringer fängt wie ein betrunkener Gecko Fliegen und schwimmt wie ein kranker Fisch! Bloß fliegen kann er noch nicht – zoologisch gesehen ist er ein Fisch!
Weitere Vertreter der Tierwelt im Mangrovensumpf sind die Milliarden von Moskitos und kleinen Stechgnitzen, gegen deren Bösartigkeit man sich kaum schützen kann, schlüpfen sie doch selbst durch Moskitonetze hindurch. Die Indianer Floridas lebten jahrhundertelang in von diesen Moskitos verseuchten Sümpfen; sie rieben sich zum Schutz mit dem Extrakt einer Pflanze ein, der die Insekten vertreibt. Auch diese Art von Moskitos hat sich an die eigenartige Umwelt angepaßt: ihre Larven gedeihen bestens im Salzwasser.
Stehen Mangroven im klaren Wasser, so wachsen manchmal Austern an ihren Wurzeln – als treibendes Plankton setzten sich die Schalentiere in ihrer Jugend an den Wurzeln fest und beginnen zu wachsen.
Die Mangrove ist eine Landpflanze, die im Laufe von Millionen von Jahren ihre Liebe zur See entdeckte und von der Land- in die Randzone übersiedelte, in die Gezeitenzone. In dieser langen Zeit hat sie auch genügend Muße gefunden, sich an ihre neuen Aufgaben im salzigen Wasser zu gewöhnen. Wie, zum Beispiel, pflanzt sie sich fort? Fruchtkapseln würden doch ins Meer hinausgetrieben, wie sollten sie je den Boden erreichen?
Mutter Natur hat vorgesorgt: die Mangrove bekommt „Junge“, sie ist sozusagen lebendgebärdend, denn ihre Früchte keimen bereits auf den Bäumen. Die jungen Pflanzen haben dann die Form einer länglichen Bombe; fallen sie in den Schlammgrund, bilden sie sofort Wurzeln und wachsen weiter. So geschieht es bei Ebbe; bei Hochwasser hingegen fällt der Sämling ins Wasser und kann irgendwo an fernen Ufern angetrieben werden, viele Meilen vom Mutterbaum entfernt. Es gibt sogar Forscher, die vermuten, die afrikanischen Mangroven seien durch Äquatorialströmungen nach Südamerika gelangt; demnach müßten die Sämlinge wochenlang auf dem Meer treiben können, ohne ihre Lebensfähigkeit zu verlieren.
Auch nach ihrem Tode hat die Mangrove noch Wert für den Menschen, sei es, daß man ihre bizarren Wurzelgeflechte zu dekorativen Zwecken ins Zimmer stellt, zu Leuchtern, Aschenbechern und Blumentopfhaltern umarbeitet, oder sei es, daß Eingeborene die Rinde der roten Mangrove zum Lohen von Netzen und Segeln benutzen.
Tollwütige Vampire
Ganz im Gegensatz zu meiner sonstigen Gewohnheit schlief ich in Trinidad nicht im Cockpit, sondern in der Kajüte, deren Bullaugen ich sorgfältig mit Moskitonetzen verhängte. Das hatte seinen besonderen Grund: Vampire!
Ursprünglich verstand man unter einem Vampir die unstete Seele eines Toten, die nachts in eine Tiergestalt schlüpfte, um in ländlichen Gegenden nach Opfern zu suchen, denen sie Blut absaugen konnte. Als Oviedo dann im 16. Jahrhundert aus Trinidad Fälle beschrieb, in denen 40 Spanier vom Fledermäusen gebissen wurden und später daran starben, nannte man diese blutsaugenden Fledermäuse ebenfalls Vampire.
Vampire beißen im tropischen Amerika seit langen Zeiten vor allem Rinder und zapfen ihnen jährlich so viel Blut ab, daß man damit einen Tanker füllen könnte.
Ich hatte nicht etwa Angst davor, ein paar Tropfen Blut zu verlieren – meist merkt man das sowieso nicht –, ich wollte mich lediglich vor der Tollwut schützen, die diese Vampire, auch große Blutsauger genannt, übertragen. Jährlich fallen im tropischen Amerika eine große Anzahl von Rindern auf diese Weise der Tollwut zum Opfer.
Der Große Blutsauger ist ein ausgezeichneter Chirurg; die Zähne dieses häßlichen Tieres, dessen Gesicht dem einer tollwütigen Bulldogge ähnelt, werden wie Messer benutzt, die die Haut mikrotomisch fein durchschneiden. Der Speichel des Vampirs verhindert, daß das Blut, welches mit der Zunge aufgeschlappt wird, gerinnt.
Die Vampire scheinen sich an ihre Opfer zu gewöhnen, denn sie fallen häufig immer wieder über die gleichen Menschen und Tiere her. Bei einer Untersuchung ist festgestellt worden, daß in manchen Dörfern Trinidads die Hälfte aller Kinder nachts von Vampiren gebissen wurden.
Der Asphaltsee
Bevor wir das trotz Moskitos und Vampiren gastliche Trinidad verließen, mußten wir ein touristisches Soll erfüllen und uns den Pitch Lake, den Asphaltsee von La Brea, ansehen. Er ist kein See, zu dem man mit dem Badezeug in der Tasche fährt, sondern eine „Asphaltmine“, die im Tagebau abgebaut wird.
Auf dem Weg nach La Brea fuhren wir wieder an Mangrovensümpfen vorbei, die dem Slumbezirk von Trinidad, der Shanty Town, gegenüberliegen. Wir benutzten eine Autostraße, von der man sagt, sie schwämme auf morastigem Grund. Es ging durch Zuckerrohrfelder, auf denen Ostinder Zuckerrohrstengel auf kleine, von Wasserbüffeln gezogene Karren warfen, vorbei an großen ölraffinerien und durch die frühere Hauptstadt San Fernando, in der mehr Ostinder als Schwarze arbeiten sollen.
Schließlich erreichten wir das La Brea-Kap. Nicht weit vom Meer liegt der beinahe kreisrunde „See“. Ein Führer gab uns Antwort auf meine Fragen – Sir Walter Raleigh habe hier schon kurz vor der Wende des 16. zum 17. Jahrhunderts seine Schiffe mit Asphalt aus diesem See abgedichtet! 100 Meter sei das „Gewässer“ tief; täglich lasse man etwa 400 Tonnen harten Asphalts ab, und eine Schwebebahn könne in 24 Stunden 1500 Tonnen Asphalt vom See zum Meer transportieren. Aber von den winzigen Fischen, die im dunklen Wasser der engen Ritzen schwimmen, wußte er leider nichts. Trotz eifrigen Suchens konnte auch ich keine entdecken, dennoch hausen sie dort, und ich halte das fast für ein ebenso großes Naturwunder wie die Existenz des Asphaltsees überhaupt.
Auf dem See gibt es einige weiche Stellen, denen man aber ausweichen kann, weil man sie ohne weiteres erkennt. Gerade vor wenigen Tagen war ein Polizist am Rande des Asphaltsees brusttief eingesunken, konnte aber wieder befreit werden.
Außer dem See spielen im Wirtschaftsleben Trinidads vor allem das öl und der Fremdenverkehr eine große Rolle. Calypso sänger fördern beträchtlich den Tourismus; in allen besseren Unterhaltungslokalen, am Strand und sogar auf den Straßen trifft man sie an und wird von ihnen besungen. Niña hörte so viele Komplimente von diesen Berufssängern, daß sie davon auf hoher See noch zehrte.
In Port of Spain hatten wir ein Erlebnis, das sich uns in ähnlicher Form noch öfter in Westindien bot: unser Gastgeber machte uns vor einem Museum stolz auf einen Anker aufmerksam, den Kolumbus auf seiner ersten Reise an den Küsten Trinidads verloren haben soll. Ich versagte mir höflich den Hinweis, daß Kolumbus auf seiner ersten Reise von der Existenz der Insel noch gar nichts wußte, daß er sie erst auf seiner dritten Fahrt entdeckte und ihr einen Namen gab. Auf mehreren Karibischen Inseln rühmt man sich eines solchen Ankers; man könnte meinen, Kolumbus habe eine erkleckliche Anzahl von Ankern als Souvenirs mitgeführt.
Sturmfahrt zur Gewürzinsel
Von der Chaguaramas Bay, dem amerikanischen Stützpunkt auf Trinidad, starteten Niña und ich unsere gemeinsame Fahrt durch die Kariben. Freunde hatten uns zum Abschied noch ein fertiges Essen an Bord gebracht, das wir auf der Ausfahrt durch die Boc a de Monas, das Affenmaul, verzehrten. Niña freute sich besonders auf diese Fahrt von Insel zu Insel; sie ahnte nicht, daß es auch in der Karibischen See mit Sturmesstärke blasen kann, sobald man aus dem Windschutz der Inseln herauskommt. Sie sollte es bald spüren.
Kaum hatten wir die Nase aus dem „Affenmaul“ herausgesteckt, da überfiel uns ein so wütender Nordostpassat, daß wir am liebsten gleich wieder umgekehrt wären. Als es dazu noch fürchterlich zu regnen begann, verzog sich Niña in die Kajüte und bereute das gute Essen, das sie soeben verzehrt hatte. Ausgerechnet hier mußte der Regen fallen, wo doch Port of Spain schon seit Monaten auf Wasser wartete und unter Buschbränden litt.
Die LIBERIA IV bolzte sich hart am Wind nach Norden vor. Wir hatten unseren Landfall auf Grenada für die erste Morgenstunde geplant, der steife Passat jedoch ließ uns unser Ziel noch in der Nacht erreichen. Nach 14 Stunden hatten wir rund 90 Seemeilen durcheilt.
Als wir am Morgen erwachten, schien schon die Sonne über die hohen Hänge auf die bunten, sauberen Häuschen von St. George auf Grenada, der „Gewürzinsel“. St. George’s Harbor ist einer der malerischsten Häfen in den an Schönheiten gewiß nicht armen Antillen; es gleicht mehr einer riesigen Theaterkulisse als einem arbeitsamen Hafen. Von den Gewürzen, Zimt, Muskatnuß, Ingwer und Nelken, vom Sapotebaum, aus dessen Milchsaft Kaugummi hergestellt wird, und von den Tonkabohnen konnten wir auch auf unserer Fahrt durch die Insel nichts sehen; wohl aber glaubte Nifia, die Gewürze da und dort zu riechen.
Auf den 60 Seemeilen zwischen Grenada und der nächsten, etwas größeren Insel, St. Vincent, liegen die Grenadinen, eine Gruppe von etwa hundert Inseln, Felsen und Felsenriffen. Da wir auf dieser Strecke heftigsten Gegenwind hatten, erholten wir uns in einer stillen unbewohnten Bucht der Union-Insel. Nach dem furchtbaren Gebolze gegen die anlaufenden Seen tat uns die Abgeschiedenheit und Ruhe dieser Bucht gut, die durch steile Felsenhänge von der bewohnten Ostseite der Insel abgetrennt und nicht leicht zugänglich ist. Wir hörten auf unserem Boot Rußseeschwalben rufen, hörten das Rauschen von aufgescheuchten Fischen, Echos von Vogel rufen, das Plätschern eines Gebirgsrinnsals – glaubten, auf einem See in den Bergen zu sein, nicht auf dem Meer.
Auf der „Brotfruchtinsel“
Bereits am Morgen des folgenden Tages standen wir vor St. Vincent, dessen grüne Hänge uns mit ihren Rindern und Farmhäusern von weitem an eine Almlandschaft in den Alpen erinnerte. Der Hafen von Kingstown ist wunderhübsch von den Hängen einer riesigen Bucht eingerahmt. Wie bevorzugt von der Natur sind doch alle diese Naturhäfen im Vergleich zu den westafrikanischen offenen Reeden!
Mit einem Einheimischen machten wir einen Ausflug durch die „Brotfruchtinsel“, wie man St. Vincent nennt, seit der berüchtigte Kapitän William Bligh Brotfruchtbäume und auch andere Pflanzen von den Pazifikinseln hierher brachte, von wo aus sie sich auf die Nachbarinseln verbreiteten. Noch heute findet man im Botanischen Garten von Kingstown einen Baum, dem man ansieht, daß er schwere Zeiten durchgemacht hat – wahrscheinlich auf der „Bounty“ – und der von den Schößlingen des Kapitäns abstammen soll.
St. Vincent ist als Hauptlieferant der Pfeilwurzelstärke berühmt, die sehr leicht verdaulich ist und deshalb zur Herstellung von Kindernahrung gebraucht wird. Das Pfeilwurzelmehl wird mit Wasser aus den zerkleinerten Knollen und Wurzeln der Pflanze ausgeschlämmt; zu seiner Gewinnung hat man auf der Insel teilweise sogar alte Zuckerrohrmühlen umgebaut.
Zur Abwechslung nahm ich mal wieder einen eingeborenen Mechaniker an Bord, der versuchen sollte, die Umsteueranlage zum Laufen zu bringen. Er interessierte sich für alles, für die Lichtbatterie, für die Brennstoffpumpe, nur nicht für die Umsteueranlage. Als wir abfuhren, lief denn auch nichts mehr, selbst das elektrische Licht an Bord hatte er durch Kurzschlüsse und Fehlanschlüsse – einige Drähte ließ er einfach ins Leere baumeln, andere verband er falsch – zum Stillstand gebracht. Darin unterschied sich das tropische Amerika in nichts von Afrika.
Da wir möglichst viele Inseln sehen wollten, sich aber die Hurrikanzeit näherte und zur Eile gebot, segelten wir nur nachts und besichtigten tags die Inseln. Das war besonders für Niña sehr hart, weil sie jede Nacht ihre Wache stehen mußte; aber solche Leistungen werden weniger durch Muskelkraft als durch Einsicht und guten Willen erzielt, und an bei den mangelte es ihr nicht.
In den Morgenstunden erreichten wir St. Lucia.
Deutsches U-Boot vor St. Lucia
Von den vielen schönen Karibischen Inseln ist St. Lucia ohne Frage eine der schönsten. Die Einfahrt zum Hafen Port Castries erinnert an einen Fjord. Auf den Bergen der Nordseite wachen Befestigungen, moderne Villen liegen auf der Südseite, etwa zwanzig größere Yachten ankerten in einem Arm der tiefeingeschnittenen Bucht, an deren Ende Port Castries auftaucht.
Siebenmal haben die Franzosen die Insel besetzt, siebenmal die Engländer; heute gehört sie der westindischen Föderation an. Die Ortsnamen auf St. Lucia sind vorwiegend französisch, selbst in Kultur und Sprache schienen die Einwohner uns mehr französisch zu sein als britisch, obwohl die Insel jetzt schon seit rund 150 Jahren in ununterbrochenem Besitz der Briten war.
Als 1942 zwei britische Frachter ein deutsches U-Boot, das vor dem Hafen auf ihr Herauskommen lauerte, über Gebühr lange warten ließen, tauchte das U-Boot kurz entschlossen in den engen Hafen und versenkte die beiden Dampfer an Ort und Stelle. Dann kam es an die Oberfläche und suchte das Weite. Sofort setzte eine Verfolgungsjagd ein – das U-Boot jedoch blieb verschwunden; man nimmt an, es habe in einer kleinen Bucht einige Meilen südlich von Port Castries solange auf dem Meeresgrund gewartet, bis die Jagd abgeblasen wurde.
Wir lagen inmitten von Yachten aus aller Welt. Die meisten waren Amerikaner, einige ßriten, andere Kanadier, Belgier und Südafrikaner. Den einen diente ihre Yacht lediglich als schwimmendes Haus, sie wagten sich alle Jahre nur einmal aus dem Schutz der Insel heraus; die anderen segelten auch, und zu ihnen gehörte Bob Elliot, das Baby unter den Einhandseglern: er hatte als Neunzehnjähriger den Atlantik allein überquert. Ich hatte ihn bereits in Las Palmas kennengelernt. Er wollte nun auf St. Lucia sein Boot überholen und wieder nach Europa zurücksegeln, allerdings mit einem Mitsegler. Das Einhandsegeln hatte er sich leichter vorgestellt.
Wir wurden zu einer Party auf einem großen kanadischen Boot eingeladen. Eine lustige Gruppe von Seglern gab sich alle Mühe, im Schatten eines Sonnensegels das dauernde Flüssigkeitsdefizit der Tropen durch genügende Mengen von Alkohol wieder auszugleichen. Man tanzte an Bord, man flirtete und benahm sich ungeniert. Eine Seglerin empfing mich mit den Worten: „Ah, da kommt der bestgehaßte aller Hochseesegler!“
„Wie meinen Sie das?“ fragte ich sie verwundert.
„In früheren Zeiten wurden die Hochseesegler als Helden betrachtet, seitdem Sie aber in einem Einbaum und in einem Faltboot über den Ozean segelten, sind wir blamiert, erniedrigt und infolgedessen beleidigt. Das einzige, was uns zu unserer Ehrenrettung übrig bleibt, ist, Sie für verrückt zu erklären!“
Da die Dame offensichtlich ein ganz schönes Flüssigkeitsdefizit ausgeglichen hatte, tröstete ich sie mit dem Versprechen, sie bestimmt mitzunehmen, wenn ich je wieder in einem Einbaum über den Atlantik segeln wollte.
Anderntags lernten wir einen Kollegen kennen, der früher in Amerika eine blendende Praxis besessen, sich dann aber plötzlich hierher zurückgezogen hatte. Er hängte den Arztkittel an den Nagel, kaufte sich einen kleinen Berg am Rande des Hafens und züchtet jetzt Hühner und Obstbäume und lebt mit einer hübschen Schwarzen zusammen.
Der Exkollege schrieb uns einige Zeilen in unser Bordbuch und unterzeichnete mit „TTT“. Als wir ihn fragten, was für ein akademischer Grad das sei, schrieb er die drei Buchstaben aus: „Typischer tropischer Tramp“.
Menschen wie ihn findet man in fast jedem Tropenroman, tatsächlich aber auch auf fast jeder Tropeninsel. Der Geschäftsführer des Hotels, in dem wir aßen, war aus Europa zur überprüfung der Bücher nach St. Lucia geschickt worden und für immer hier geblieben. Ein kanadischer Arzt hatte seinen Urlaub hier verlebt und war nicht mehr nach Kanada zurückgekehrt. Auf den amerikanischen Jungferninseln lernten wir diese harmlosen „Tramps“ später in noch größerer Anzahl kennen; diese Inseln schienen ein Hort für Tropentramps aus den Vereinigten Staaten zu sein.
Nachdem sich halb St. Lucia bemüht hatte, die Umsteueranlage der LIBERIA IV zur Arbeit zu bewegen – für kurze Zeit klappte es sogar –, segelten wir schließlich nach Pigeon Island, das ein bis zwei Kabellängen1 im Nordwesten von St. Lucia liegt.
Ein weiblicher Robinson
Miss Josset Legh, die einzige Dauerbewohnerin der Insel, hatte uns kommen sehen. Sie empfing uns in ihrer geräumigen, zum Meer hin geöffneten, afrikanischen Palaverhütte. Ehe wir das aufgebaute Fernrohr, mit dem sie ihre Gäste schon von weitem beobachtet, sowie die vielen Fischernetze, Kanonen, Korallen, vor allem aber ihre Bambusbar betrachten konnten, über der Fotografien von Yachten aus aller Welt hingen, hatte sie uns schon einen Drink serviert und prostete uns ein Willkommen zu.
Wir kamen schnell ins Gespräch. Niña wollte wissen, ob Josset sich so allein auf dieser Insel nicht fürchte, sich nicht einsam fühle?
Die alte Dame beugte sich über die Theke und flüsterte uns zu: „Wissen Sie, ich bin niemals allein hier. Mein Kind ist bei mir und leistet mir Gesellschaft. Obwohl es schon lange tot ist, haben wir stets Kontakt miteinander. Und dann höre ich immer Musik in der Luft; die Wellen des Kosmos tragen mir Melodien zu, Orchestermusik, wie sie kein Mensch besser empfangen kann.“
„Wie hat es Sie denn hierher verschlagen?“ erkundigten wir uns.
„Ich war früher Schauspielerin in London. Mein ganzes Leben lang habe ich von einer Tropeninsel geträumt und bin glücklich, daß mein Traum in Erfüllung gegangen ist. Diese Insel ist mein Werk, alle diese Hütten habe ich mit meinen eigenen Händen gebaut.“
Unwillkürlich schauten wir auf ihre kräftigen, muskulösen Hände. Mir schien sie überhaupt mehr einem englischen Richter mit weißer Perücke als einer Frau zu gleichen. Weiblich war jedoch ihr kurzes Strandkostüm, das an Nacken, Armen und Beinen ihre feste braun gegerbte Haut frei ließ. Immer noch sah man Josset an, daß sie vor 40 Jahren oder so eine blendende Schönheit gewesen sein muß.
Sie fuhr fort: „Früher half mir meine Mutter, vor kurzem aber fiel sie vom Dach, als sie es mit Zitronellagras ausbessern wollte. Sie brach sich ein Bein und starb.“
„Und wie alt war Ihre Mutter, als sie vom Dach fiel?“
„93 Jahre. Ich habe sie hier beerdigt.“
Spökenkieker unter Palmen
Mich interessierten Jossets merkwürdige Anschauungen aus dem Bereich des Mystizismus, und um das Gespräch in diese Richtung zu lenken, erzählte ich ihr ein eigenes Erlebnis parapsychologischer Art.
„Dies ist eine Insel, auf der vieles passiert, das sich nicht mit dem Verstand erklären läßt“, sagte Josset. „Geister gehen hier umher und treiben ihr Unwesen. Manchmal brennt nachts auf den Hügeln ein Licht, und wenn ich dann den Berg hinaufklettere, ist kein Licht mehr da. Manchmal finde ich morgens abgeschlagene Bäume vor. Ich frage Sie: wer hat Interesse daran, hier mit dem Haumesser Bäume zu fällen!?“
Niña und ich schauten uns fragend an, wir wußten es nicht.
„Nur die Seelen der Toten; sie wollen nicht vergessen sein. Die Insel wimmelt von Toten; unter jeder Krume Erde liegen Gebeine –, von den Indianern, die ihre Toten von St. Lucia hierherbrachten, von den Briten, die hier eine Garnison errichteten und deren Soldaten wie die Fliegen an Malaria, Dysenterie, Gelbfieber und anderen Krankheiten starben.“
Josset war ganz in ihrem Element, eine Geistergeschichte folgte der andern. Ich hörte gespannt zu, Niña jedoch zog die Brauen hoch. Später lachte sie mich aus: „Typisch Mann! Du hast nicht einmal gemerkt, daß sie uns Theater vorspielte – sie ist eine gute Schauspielerin.“
Am Nachmittag tollten wir auf der Insel umher. Während Niña auf Rodneys Fort ein Sonnenbad nahm, kletterte ich in einsame Buchten, um nach dem Schatz zu suchen, den französische Seeräuber – wie Josset uns anvertraut hatte – hier deponiert haben sollen …
Nach dem Abendessen bei Josset wollte Niña gern in einem der verwunschenen Häuser schlafen. Warum auch nicht? Ich mußte jedoch auf mein Boot zurück, weil der Ankergrund bei starken Winden nicht sicher genug war. Als ich Niña am nächsten Morgen in ihrem Wunschhaus mit dem Palmendach abholen wollte, fand ich sie noch schlafend im Bett. Sie sah erschöpft aus, und ihre Finger umklammerten krampfhaft eine Parfümflasche. Plötzlich flog eine Taube gegen die Tür, und Niña fuhr hoch, als wollte ihr jemand an die Kehle.
„Gottseidank – du bist’s!“ rief sie, als sie mich sah. „Ich habe eine furchtbare Nacht gehabt! Stell’ dir vor, kaum war ich ins Bett gegangen, da rüttelte es an den Türen, polterte es gegen die Fensterläden und plumpste es aufs Dach, daß mir angst und bange wurde. Ich rief nach Josset, aber sie antwortete nicht. Dann habe ich dir mit der Lampe Blinkzeichen gegeben, aber du hast wohl schon geschlafen, und ich hätte den Weg zu dir durch den Dschungel nicht mehr gefunden. Der Spuk ging immer weiter; der Wind heulte, das Meer donnerte zu Füßen dieser verflixten Hütte, und schließlich sprang mit lautem Knarren die Tür am Kopfende des Bettes auf. Da hatte ich endgültig genug. Ich wanderte ruhelos durch das Haus. Der einzige Raum, den man abschließen konnte, war der Duschraum. Dort habe ich mich schließlich auf den Boden gelegt und den Riegel vorgeschoben. Erst als es dämmerte, bin ich wieder ins Bett zurückgeschlichen. Mein Gott, kann eine Nacht lang sein! Da, schau mal hier ins Bett: da wimmelt und krabbelt es nur so von winzigen roten Insekten. Und auch das Bettzeug riecht noch muffiger als bei uns an Bord. Scheußlich, sag’ ich dir!“