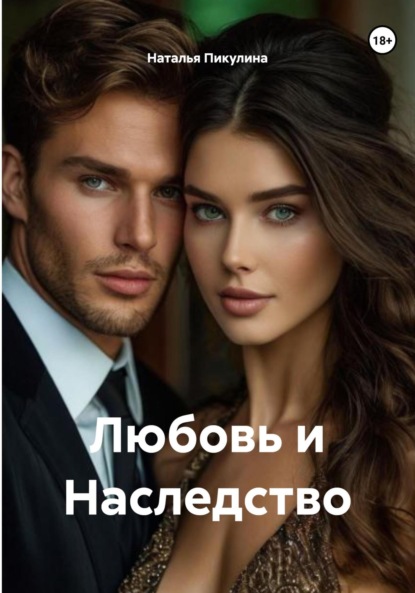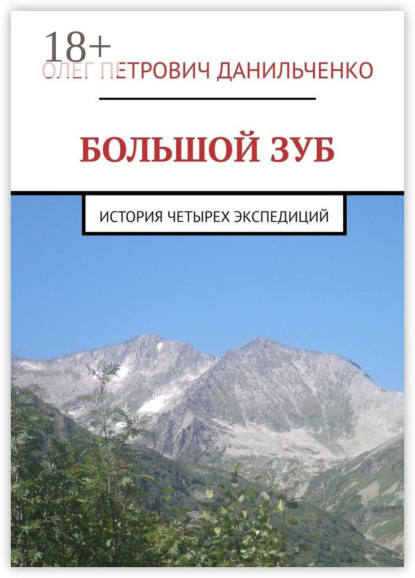Maritime E-Bibliothek: Sammelband Abenteuer und Segeln

- -
- 100%
- +
»Nein«, sagte Elga. »Das wäre ja Flugnavigation. Bleib der Seefahrt treu, Junge!«
Meine Begeisterung brach ab. Ich suchte nach einem Platz, der möglichst hoch, möglichst trocken, möglichst ruhig einen von den Segeln ungehinderten Blick zur Sonne zuließ. Ich fand keinen. Schließlich setzte ich mich auf das Heck. Dort saß ich tief, fast trocken und überhaupt nicht ruhig.
Ich fixierte die Sonne durch den Sextanten und brachte ihr Spiegelbild auf die Kimm, die immer wieder vom Seegang verdeckt wurde. Nichts stand fest außer der Sonne im Himmel. Ihr Spiegelbild tanzte, das Schiff schlingerte, die Kimm war nur für Sekunden sichtbar. Ich folgte allen Bewegungen, Bruchteile von Sekunden zu spät.
»Achtung!« sagte ich. Das Schiff hob sich, die Kimm wurde sichtbar. Ich korrigierte die Sextanteinstellung – zu spät. Ein Brecher zog vorbei.
Endlich klappte es. »Null!« rief ich. Elga betätigte die Stoppuhr. Ich arbeitete mich in die Kajüte zum Kartentisch zurück, wo ich zunächst den Sextanten vorsichtig in seinen Kasten stellte. Dann las ich das Chronometer ab. »Achtung – stopp!«
»1 Minute und 3 Sekunden«, meldete Elga.
Unter Berücksichtigung dieser zwischen Sonnenmessung und Chronometerablesung abgelaufenen Zeit machte ich die Eintragung meiner Beobachtung ins Logbuch. Für einen Augenblick träumte ich wieder von dem hohen, sanft schwingenden Deck meines Flugzeugträgers, wo mehrere Navigatoren nun ihre abgelesenen Werte vergleichen konnten – meine Messung stand ungeprüft im Logbuch. Ich stieg an Deck und übernahm die Pinne.
Elga wertete die Beobachtung aus, eine logarithmische Rechenarbeit von etwa 20 Minuten Dauer.
Durch die geöffnete Niedergangsluke konnte ich sie dabei heimlich beobachten, während ich laut, falsch und scheinheilig »La Paloma« pfiff. Sie saß gut verkeilt am Tisch, umgeben von den ebenfalls verkeilten Tafeln und Büchern. Nur unser großes, grünes Radiergummi konnte frei liegen und rutschte nicht. Ihr Gesicht war ernst und konzentriert, während sie kleine Zahlen eilig und sauber in das Beobachtungsbuch schrieb.
»So«, sagte sie schließlich, packte die Bücher ins Fach und kam zum Niedergang, an dessen Stufen sie sich festhielt. »Ich bin müde. Gute Wache!«
»Schlaf gut!«
»Brauchst du noch etwas?«
»Danke, nein.«
Mittags weckte ich Elga, die das Ruder übernahm. Ich holte den Sextanten, suchte einen Platz, der sich jetzt auf dem Bug niedrig, feucht und sehr bewegt anbot. Von dort beobachtete ich die Kulmination der Sonne, ihren höchsten Stand im Mittag.
Diese Mittagshöhe wertete Elga zusammen mit dem Ergebnis des Vormittags zum Mittagsbesteck aus. Sie kam anschließend mit der Seekarte an Deck.
»Hier sind wir«, sagte sie und zeigte auf das Bleistiftkreuz. »Wir haben eine Versetzung von 12 Seemeilen nach Südsüdwest. Etmal 121 Seemeilen.«
Ich sah mir die Karte an. »Setz den Kurs gut westlich von den Selvagem Inseln ab. Zu Mitternacht sind wir frei von ihnen. Dann gehen wir auf den direkten Kurs zur Nordspitze von Gran Canaria.«
Elga kletterte zum Kartentisch und sagte nach einigen Minuten: »186° am Kompaß – ab Mitternacht dann 166°. Verstanden?«
Ich wiederholte die Kurszahlen und rief dann: »Hunger!«
»Es gibt heute Haferflocken mit Pfirsichkompott«, verkündete Elga gelassen, wobei sie sich festhalten mußte, weil »Kairos« überholte.
Ich schildere das alles so genau, damit man sich unseren Alltag auf See vorstellen kann. Es ist ein Alltag in ständiger Bewegung, ein Alltag, eingegrenzt von der Reling unseres Schiffes, erfüllt von unserer Bordroutine, die Wache um Wache und Arbeit um Arbeit vorschreibt. Unaufhörlich zieht »Kairos« seinen Weg: schäumend teilt sein Bug die See, gurgelnd fließt das überkommende Wasser durch seine Speigatten ab, willig wölben sich seine Segel in den Wind – vorwärts, vorwärts: ziehender Punkt im Ozean.
Am nächsten Tag lösten sich die Konturen der Insel Gran Canaria aus Dunst und Wolken.
Es würde nichts ausmachen, wenn das Ziel noch nicht so nah vor dem Steven liegen würde. Denn so lange Wind weht und Wasser unter seinem Kiel wogt, wird ein Schiff segeln – vorwärts, weiter und weiter. Schiffe brauchen kein Ziel, wie wir Menschen, die sie bedienen. Schiffe sind um des Segelns willen da. Sie tun es ohne Ermüdung, wenn man sie richtig behandelt. Es liegt etwas unsagbar Überzeugendes in ihrer Stärke. Gewiß sind sie wie Auto, Eisenbahn oder Flugzeug Konstruktionen, die der Fortbewegung dienen. Aber ebenso gewiß sind sie mehr als diese. Ihr segelndes Bestehen ist nur gesichert, wenn es in völliger Harmonie mit den Menschen, die sie führen, und mit der Natur geschieht, die sie umgibt. Diese Wechselwirkung scheint Segelschiffen eine Seele einzugeben, scheint sie zu Lebewesen werden zu lassen, die man liebt. In jeder Liebe sucht und findet der Mensch sein Spiegelbild ebenso wie seine Selbstlosigkeit. Und kein Ding auf dieser Erde schenkt dem Menschen sein Spiegelbild so klar und fordert so unbedingt Selbstlosigkeit wie ein Segelschiff.
Eigentlich spreche ich gar nicht von »Schiffen«, sondern von »Kairos«. Wir leben seit unserer Ausreise nun 140 Tage und Nächte auf diesem Schiff, Tage und Nächte, deren größter Teil seiner Wartung und Bedienung galt. Er hat uns sicher und zuverlässig getragen. Nie hatten wir auf ihm, dem winzigen Punkt im Ozean, das Gefühl von Enge und Verlorenheit.
Verlangen diese Tatsachen nicht, daß man sich mit dem »Ding« auseinandersetzt? Plötzlich hat es Seele und ergänzt mit ihr das wundersame Hundeleben, das man führt.
Elga kommt nun mit dem Schlauchboot vom Bootssteg des Real Club Nautico angerudert. Ich helfe ihr, die Einkäufe an Bord zu bringen, nachdem sie das Boot längsseits gebracht hat.
Wir essen kalt zu Mittag. Kochen würde die Temperatur in der Kajüte unerträglich machen. Die warme Mahlzeit bleibt dem Abend vorbehalten.
Anschließend erzählt Elga von ihrem Gang in die Stadt.
»Lebensmittel sind billig. Wir werden alles kaufen können, was für die Atlantiküberquerung notwendig ist. Nur die Werften – sie sind irrsinnig teuer, und sie lassen nicht mit sich handeln.«
Wir sitzen einen Augenblick schweigsam und denken an die zahllosen Arbeiten, die am Schiff getan werden müssen, um es für die 2700 Seemeilen über den Atlantik klar zu machen. Es muß geslipt werden, damit wir den Bewuchs am Unterwasserschiff entfernen können. Je wärmer das Wasser, desto schneller und üppiger wachsen Gras und Muscheln am Kiel.
»Was wollen wir machen?« fragt Elga. »Uns trockenfallen lassen während der Ebbe?« Sie zeigt zum Strand neben dem Clubgebäude.
»Nein«, sage ich, »zu viele Steine. Außerdem kommen wir danr. nicht an die Unterseiten von Kiel und Ruder. Das Ruder muß geprüft werden, gründlich. Da war ein Geräusch, das ich weder erklären noch orten konnte, als wir hierhersegelten. Außerdem, wenn hier eine Dünung aus Süd einsetzt, haben wir auf dem Strand Ärger.«
Elga sieht mich an. »Die wollen 3000 Pesetas haben, das ist eine Menge Geld.«
»Gewiß. Aber ›Kairos‹ ist unsere einzige Lebensmöglichkeit auf See. Er muß absolut zuverlässig sein.«
Elga nickt ein wenig verzweifelt. »Ob wir den Preis noch ’runterhandeln können? Ich glaub’ es nicht!«
In der Frage nach einer Slipmöglichkeit kamen uns die Bootsleute des Clubs zu Hilfe. Elga unterhielt sich oft mit ihnen, und sie waren bereit, so glaube ich, sich für die Señora aus dem Norden vierteilen zu lassen. Die armen Kerle wurden nicht sehr freundlich von den speedboatfahrenden Söhnen reicher Clubmitglieder behandelt. Sie verdienten etwa DM 5,- am Tag. Damit kann selbst auf den Kanarischen Inseln niemand ein sorgenfreies Leben führen.
Elga brachte eines Tages den Vorschlag der Bootsleute. »Sie haben einen Slipwagen, der ihnen geeignet erscheint. Sie haben den Besitzer dieses Wagens um Erlaubnis gefragt und sie erhalten, da er sich einen neuen bauen läßt. Der Wagen wurde bisher für ein Motorboot von 3 Tonnen benutzt. Sie wollen 500 Pesetas für die Arbeit haben.«
Wir sahen uns am nächsten Tage den Wagen, den Slip und alle Einzelheiten an. Der Wagen schien ein wenig schwach – »Kairos« wiegt 5 Tonnen. Alle anderen Dinge waren in Ordnung.
Immer wieder vermaß ich den Wagen. Die vier Bootsleute erklärten mit leuchtenden Augen – ich weiß nicht was, sicherlich, daß die »Queen Mary« hier aufgedockt werden könnte.
»Männer«, sagte ich schließlich und sie verstummten, »Männer der See – eh, mariñeros! Trägt dieser Wagen 5 Tonnen?«
Sie starrten mich fassungslos an.
Ich versuchte es auf spanisch: »Cinco, eh – also, cinco toneladas? Dieser Wagen, eh, also – este para cinco toneladas?«
»Si, si, si, señor!« sagten sie beschwörend und erklärten alles ganz genau. Ich verstand nicht einmal die Hälfte. Elga stand stumm, wohl in Bewunderung meiner so plötzlich zutage tretenden Sprachkenntnisse.
Ich zweifelte nicht an den Fähigkeiten der Bootsleute. Die Frage lag in der Beurteilung des Wagens, und in dieser Hinsicht mißtraute ich den Spaniern. Wir gingen alle noch ein paar Mal um den Wagen herum. Aber dadurch wurde er auch nicht größer und stabiler.
»Oha, oha!« sagte ich zu Elga. »Was sagst du?«
Sie schwieg.
»Morgen bei Hochwasser.«
»Mañana con la marea alta«, wiederholte Elga meine Entscheidung.
Die Bootsleute jubelten.
Mir war zumute, als hätte ich einen Exekutionsbefehl gegeben.
Ächzend, schwankend, auf quietschenden Rädern brachte der Wagen »Kairos« aus dem Wasser. Mit den Drahtseilen der handbetriebenen Winsch zogen wir ihn bis zur Hochwasserlinie. Dann fand keiner mehr den Mut, diese Maus unter einem Elefanten weiterzubewegen. Das Schiff wurde mit bereitgelegten Pallhölzern von den Bootsleuten abgestützt, während ich sofort begann, das stark bewachsene Unterwasserschiff zu reinigen. Damit fing es an.
Und Tag für Tag ging es mit den Arbeiten weiter. Farbekratzen, Spülen mit Süßwasser eimerweise, da der Schlauch nicht lang genug war, Schleifen mit Sandpapier, Spachteln, Vorstreichen mit Grundfarbe, Streichen mit Unterwasserfarbe. Wiederholung dieser Arbeiten in ähnlicher Weise an den Bordwänden, Streichen mit Lackfarbe.
Der Schweiß rann in Strömen bei 28° im Schatten. Blasen platzten auf. Bei Hochwasser arbeitete ich bis zu den Knien im Wasser, bei Niedrigwasser lag ich auf dem Rücken und malte am Kiel. Abends nach schweigsamer Mahlzeit an einem schiefen Tisch – die Schiffslänge lag parallel zur schiefen Ebene des Slips – fiel ich in eine schiefe Koje, aus der ich mich morgens mit immer noch schmerzendem Rücken erhob.
Elga erging es nicht besser. Sie machte kleine Malarbeiten. Hauptsächlich jedoch fertigte sie endlose Meter von Schamfielings an: auf Band gezogene Kardeelenden, die um Wanten und stehendes Gut gewickelt werden, wo Segel scheuern und sich dadurch beschädigen können. Die Arbeit mit dem widerspenstigen Tauwerk verursachte auch bei ihr schmerzendes Aufplatzen von Blasen. Ihrem Rücken erging es nicht besser als meinem.
Bald fühlten wir uns erschöpft und deprimiert. Wozu das alles? Für 2700 Seemeilen leeres Meer, für Einsamkeit und Kräfteverschleiß, für Müdigkeit und Ungewißheit.
Bei Hochwasser donnerte für Tage die Brandung eines fernen Sturmes auf den Slip und ließ das Schiff zittern. Sie störte Arbeit und Schlaf in gleicher Weise. Wozu auch das noch? Um nach Wochen großer Mühsal mit brennenden Augen eine Insel jenseits des Atlantik auftauchen zu sehen.
Motoröl wechseln, Bilge reinigen, Luken lackieren, Achterpiek malen, Wantspanner fetten. Frag nicht, halt durch.
Es ist vorüber! »Kairos« strahlt wie ein Neubau im Glanz seiner frischen Farben. Ein Schaden an der Ruderhalterung wurde entdeckt. Seine Beseitigung gab uns unsere alte Freude und Zuversicht wieder: säßen wir nicht, schief und müde, auf diesem Wagen an der Wassergrenze des Ozeans, wir hätten ihn nicht entdecken und beseitigen können. Und morgen geht’s zurück ins Wasser!
Beim Abslippen neigten sich die Querstreben des Wagens so stark, daß sie die Räder blockierten. Wie festgeschweißt stand der Wagen. Es begann zu ebben. Fieberhaft takelten wir mit den Bootsleuten eine vierfache Talje, mit deren Kraftübertragung es gelang, den bockenden Wagen slipabwärts zu zwingen. Eisen schrie auf Zement. Der Wagen wankte und ebenso »Kairos«. Im rostbraunen Eisen der hinteren Querstrebe sprang ein hellgrauer Riß auf. So endet eine Reise, dachte ich – so schnell? Frag nicht, halt durch.
Nach zwei Stunden schwerster Arbeit konnten wir unter Maschine zu unserem Ankerplatz laufen. Die Bootsleute winkten glücklich, als sie das, was einmal ein Slipwagen gewesen war, aus dem Wasser holten. Und wir winkten ebenso glücklich zurück, während wir unser Schiff von den Gefahren des Landes fortsteuerten.
Auf der Reede vor dem Jachtclub waren inzwischen einige neue Jachten angekommen, andere ausgelaufen. Den Gesprächen mit anderen Jachtsleuten zufolge hatten etwa 15 Jachten die Absicht, in diesem Jahr über den Atlantik zu den Westindischen Inseln zu segeln. Da waren Amerikaner, Franzosen, Holländer, Schweden, Engländer, Australier. Es herrschte ein reger Bootsverkehr zwischen den Jachten. Manche Bekanntschaft wurde gemacht, die sich zu Freundschaft vertiefte.
»Gestern ist die ›Takebora‹ ausgelaufen«, sagte Bryan, als er in seinem Dinghi vorüberruderte. Mit seiner Sloop »Askadil« wollte er ebenfalls zu den Antillen, begleitet von seiner Frau und seinem zweijährigen Töchterchen. Und er fügte hinzu: »Mal sehen, wie’s der Maurenbrecher« – er hatte große Schwierigkeiten mit diesem holländischen Namen – »einhand schafft. Übrigens: kommt ’rüber heute abend zum Drink! Bob und Sheila von der ›Bella Donna‹ sind auch da. Wir laufen morgen zusammen aus!«
Es wurde ein lustiger Abend – o ja! Am nächsten Morgen standen Elga und ich auf dem Deck und winkten der »Askadil« und der »Bella Donna« nach, deren Segelsilhouetten schon in der Hafenausfahrt so erschreckend klein wurden. Wir fühlten uns verlassen. Und bald würden auch unsere Segel winzig überm Horizont dort zu sehen sein …
»Wir treffen sie wieder«, sagte ich zu Elga. »Drüben, auf Barbados, auf Antigua, irgendwo ganz bestimmt. Und jetzt heiß mich, bitte, in die Takelage.«
Während zweier Tage saß ich im Bootsmannsstuhl, prüfte das Rigg und brachte die von Elga hergestellten Schamfielings an. Dann kauften wir nach den von Elga aufgestellten Listen Proviant ein. Karton nach Karton mit insgesamt 100 Konservendosen und über 50 kg loser Verpflegung wurden an Bord gerudert, sortiert und zu den alten, gelichteten Beständen gestaut. Das kostete Elgas Geduld und meinen Schweiß: was ich wegpackte – es ging nur Dose für Dose in unserem kleinen Schiff – das wurde von ihr auf Staulisten verzeichnet, um es später auf See wiederfinden zu können. Abends arbeiteten wir die Handbücher des Atlantik, der Westindischen Inseln sowie die Pilotcharts durch. Es entstand der Plan, der die Gegebenheiten von Wind und Strom berücksichtigte und unsere entsprechenden Kurse über den Atlantik festlegte. Erfahrungen von anderen Jachtsleuten, bei vielen Gesprächen gehört, wurden ebenfalls berücksichtigt. Oft sprachen wir während der Arbeit von jenen fernen Inseln. Wir sagten ihre Namen, die uns noch gar nichts bedeuteten, deren Klang jedoch so schön, so verlockend, so geheimnisvoll war.
Die Bestände von Trinkwasser, Benzin, Petroleum wurden ergänzt.
»Wir haben jetzt alles an Bord«, sagte Elga. »Wann wollen wir auslaufen?«
Das war sie, die Frage, auf die wir gewartet hatten. Seit wir die Reise planten und vorbereiteten, seit 8 Jahren also, wußten wir um sie. Und um die Antwort wußten wir ebenso.
»Morgen«, antwortete ich.
Wir gingen frühzeitig zu Bett. Ich lag wach und blickte aus der halb aufgestellten Vorderluke zu den Sternen. Meine Gedanken segelten suchend über den Atlantik. Machen wir eine gute Überfahrt – finden wir den Passat bald – steuert »Kairos« sich selbst ohne unsere Ruderwachen – ist alles stark genug: Wanten, Spannschrauben, Bolzen, Winschen, Blöcke, Spleiße, Schoten, Segel, Muskeln, Herzen, Seelen – treten Schäden ein – beheben wir sie – kommen wir an. Fragen waren es ohne Fragezeichen, weil sie mehr beteten als fragten.
Ich drehe mich zur Seite und schließe die Augen. Wir haben alles getan, was wir tun konnten. Morgen gibt es nur noch eines: segeln.

Steuerbord achteraus hob der Pico de Teide, höchster Berg der Kanarischen Inseln, in 40 Seemeilen Entfernung den schneebedeckten Gipfel aus Wolken und Dunst: ein letzter Gruß der Welt diesseits des Atlantik. Wie würde das Land aussehen, das jenseits seiner Wasserwüste in Sicht kommen würde?
Uns blieb wenig Zeit, um solche Fragen zu beantworten. »Kairos« verlangte unsere ungeteilte Aufmerksamkeit. Auf Südwest-Kurs mit Wind und Seegang von Steuerbord querein rollte er heftig, das Steuern war anstrengend. Gischt wehte über Deck.
Trotz Seekrankheits-Tabletten fühlten wir uns miserabel. Ich fluchte kläglich beim Messen der Sonnenhöhe, weil der Sextant naß wurde und ich das Instrument in der Kajüte gründlich trocknen mußte. Nach ihrer Rechenarbeit zeigte auch Elga ein grünblasses Gesicht. Wegen des Seegangs mußten wir alle Luken geschlossen halten. Die Luft in der Kajüte wurde stickig-feucht.
»Ich mag nichts essen«, sagte Elga. »Du? Ich kann auch nichts vorbereiten hier unten.«
»Etwas essen müssen wir –«
Sie schloß die Luke, weil Gischt übers Schiff geworfen wurde. Nach einem Augenblick reichte sie mir lächelnd eine halbe Tafel Nußschokolade heraus. Das Lächeln konnte die Anspannung ihres Gesichtes kaum mildern.
»Iß du auch etwas!« schrie ich. Sie hatte die Luke schon wieder geschlossen. »Und schlaf, so gut du kannst!« Wir brauchten Stärkung in diesem chaotischen Beginn.
Ich aß von der Schokolade, ohne wahrzunehmen, wie sie schmeckte. In mir wuchsen Übelkeit und Angst vor der vorausliegenden Ungewißheit. Umkehren, dachte ich, laß uns umkehren. Zwar wußte ich, daß wir das niemals tun würden, aber dieses Wissen half nichts. Kurs Südwest, Atlantik, 2700 Seemeilen, es ist zum Kotzen, dachte ich, und tat es. Dann aß ich den Rest der Schokolade.
Abends ließ der Wind nach. Die See beruhigte sich. Wir refften aus. Übelkeit und Angstzustände besserten sich. Elga kochte mit Anstrengung das Abendbrot – Corned Beef mit geschmorter Gurke und Makkaroni. Es schmeckte. Unsere Widerstandskraft festigte sich.
Während der folgenden Tage und Nächte beobachteten wir gespannt den Wind, der weiterhin abflaute, auf Nord drehte, einige Schauer brachte – Passat? – und doch wieder auf Nordwest zurücksprang und aufbriste. Es war noch nicht der Passat.
Wache folgte auf Wache. Unsere Müdigkeit nahm schnell zu. Doch gleichzeitig wuchs unser Selbstvertrauen. Unser Anpassungsvermögen machte das Leben auf dem nie bewegungslosen Schiff jeden Tag etwas erträglicher. Wir wurden froh des Windes und des Schiffes, das sprühend durch die blauen Seen zog als Zeichen unseres Willens im Dreiklang von Wasser, Horizont und Himmel. Achteraus versank, so wie vor Tagen die Kanarischen Inseln, was belastend und hemmend auf unseren Seelen gelegen hatte. Wir waren auf See, eingespannt in unser geordnetes Bordleben, eingelassen in eine Freiheit, die der Atlantik mit grenzenlosem Raum vor uns ausbreitete.
Am Morgen des vierten Tages setzten heftige Schauer ein, nach deren Durchzug der Wind auf Nordost drehte und stetig blieb. Es war der Passat!
Ich setzte nun zum ersten Male unsere Passatsegel – zwei Vorsegel, die mit je einem Spinnakerbaum nach den Seiten ausgestützt werden. Von den Nocken der Bäume laufen Leinen über Blöcke und Taljen zur Ruderpinne. Unter dieser Besegelung kann sich das Schiff vor dem Winde selbst steuern. Gleich stark fällt der Wind von achtern in beide Segel und drückt sie nach vorn. Dieser Druck, der dem Schiff Fahrt gibt, überträgt sich gleichzeitig als Zug auf die Leinen und damit auf die Ruderpinne, die das Ruder mittschiffs hält. Läuft das Schiff aus dem Ruder, d. h. ändert es aus irgendeinem Grunde den Kurs, so wird der Winddruck im Segel jener Seite stärker, zu der das Schiff dreht. Die Folge ist, daß die Pinne dem verstärkten Zug von Leine und Talje folgt, den Kurs also berichtigt, bis der Druck auf beiden Seiten in den Segeln wieder gleich stark ist. Das Ganze ist ein Balancesystem, dessen ausgleichende Kraft der Wind erzeugt. Die Manövrierfähigkeit des Schiffes ist unter den Passatsegeln stark eingeschränkt. Es kann nicht wenden oder hoch am Wind segeln. Nähern wir uns Land, so müssen die Passatsegel gegen die konventionelle Besegelung gewechselt werden.
Es kostete mich etwa zwei Stunden Arbeit, bis die Passatsegel gesetzt waren und in voller Wirkungskraft die üblichen, jetzt festgemachten Segel ersetzten. Den Nachmittag verbrachten wir dann neben den Routinearbeiten damit, die Zugkraft der beiden Segel so auf die Pinne zu bringen, ihre noch nicht einwandfrei ausbalancierte Arbeitsleistung so zu verbessern, daß sich das Schiff selbst steuerte. Wir hatten ja keinerlei Erfahrungen in dieser Sache. Die Konstruktion beruhte auf meinen theoretischen Zeichnungen und auf dem, was andere Segler in ähnlicher Weise gemacht und beschrieben haben. Es war manche Änderung notwendig. Wir arbeiteten ohne Pause.
Abends lag Elga müde in ihrer Koje. Ich saß zerschlagen im Niedergang, halb ihr, halb dem Kompaß zugewandt. Wir tranken spanischen Wein und waren schweigsam froh – zu mehr reichte es nicht.
Aber »Kairos« steuerte sich selbst auf Westsüdwest-Kurs. Wie von Geisterhand bewegt, ging die Pinne hin und her, über Taljen und Blöcke eingespannt in den Wechselzug der Passatsegel. Es war großartig!
»Ich werde während der ersten Nachthälfte stündlich Ausguck halten, Schlummertier«, sagte ich zu der schläfrigen Elga. »Du dann in der zweiten. Einverstanden?«
Elga drehte sich behaglich auf die Seite. »Sechs Stunden ohne Wecken! Oh, das ist gut.«
»Kairos« segelte.
Ich saß noch für eine Weile und blickte übers Meer. Die Nacht sank. Der Kurs nach Barbados, dort an der Westseite des Atlantik, lag an. Ich setzte die Lichter für die Nacht und legte mich zu einer kurzen Ruhepause in die Koje. Die zweite Nachthälfte schlief ich ununterbrochen durch. Elga hielt stündlich Ausguck. Die Fron der Ruderwachen waren wir los.
Unser Bordleben änderte sich nun von Grund auf. Um 08 Uhr – Elga hatte meist schon den Kaffeetisch gedeckt, wenn der Seegang es zuließ – sah man den Kapitän ein Duschbad nehmen: Lufttemperatur 26°, Wassertemperatur 23°. Nach dem gemeinsamen Frühstück, anfangs noch Toast und Eier, später Hartbrot, stets mit Kaffee, Marmelade und Dosenbutter, ging ein jeder seinen Aufgaben nach. Elga wusch ab und räumte auf, ich erledigte die zahlreichen kleinen Arbeiten, die ein segelndes Schiff fordert. Hier waren Fallen nachzusetzen, dort Scheuerstellen zu schützen; die Selbststeuerung mußte korrigiert und neu eingestellt werden, wenn sich der Wind verändert hatte; kleine Reparaturen standen immer auf der Warteliste.
Dann war es Zeit für die erste Höhenmessung der Sonne geworden. »Achtung – Null« und »Achtung – stopp« ging es, damit Elga die Unterlagen für ihre Rechenkünste hatte. Danach konnten wir uns in die Kojen legen, um Schlaf nachzuholen, wenn uns danach zumute war. Auch lasen wir viel in jenen paradiesischen Tagen.
Mittags kam der wichtigste Augenblick des Tages. Nach der Kulminationsbeobachtung der Sonne errechnete Elga das Mittagsbesteck – den »wahren Ort« nach geographischer Breite und Länge. Ein kleines Kreuz wurde in die Seekarte gezeichnet: in aller Unermeßlichkeit wußten wir nun, wo wir waren.
Mit Lesen oder kleinen Arbeiten verging der Nachmittag. Bei Sonnenuntergang »versammelte« sich die Besatzung im Cockpit, um ein oder zwei Gläser Wein zu trinken. Dabei sprachen wir über die Ereignisse des Tages, bewunderten die Farben des Abendhimmels, die sich im Meer vielfältig spiegelten.
Tag auf Tag, Nacht um Nacht zog über uns dahin. »Kairos« segelte und der Kurs lag an. Himmel und Wasser, Wolken und Gestirne: der Raum des Ozeans hatte uns aufgenommen. Wir lebten in einem Dasein, das wunschlos macht. Längst hatten wir uns an die Schiffsbewegungen gewöhnt. Das ging so weit, daß uns nun der Horizont als »schief« erschien, wenn wir aus der Kajüte an Deck kamen.