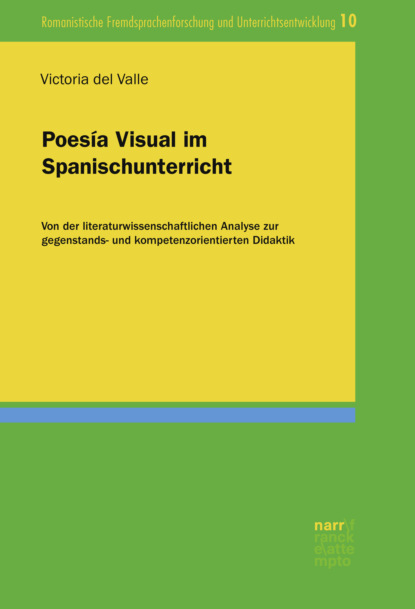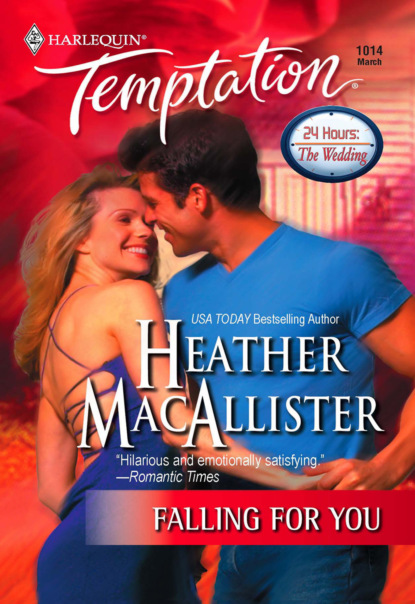Maritime E-Bibliothek: Sammelband Abenteuer und Segeln

- -
- 100%
- +
Die Linie unserer Mittagsstandorte zählte 16 Kreuze, 1700 Seemeilen lagen hinter uns, wir begannen schon spielerisch mit unserer Ankunftszeit auf Barbados zu rechnen, als sich das Wetter änderte. Aus Norden schob sich eine ungewöhnlich lange Schauerfront herauf. Als ihre ausgefransten Wolkenränder über uns standen, schwieg der Wind.
Der Passat wehte nicht mehr! Das Barometer fiel tiefer, als es üblich ist im Auf-und-ab eines tropischen Tagesablaufs.
Aus solchen Passatstörungen entstehen zur Jahreszeit der tropischen Wirbelstürme oftmals Hurrikane. Außerhalb der Jahreszeit ziehen die Störungen meist harmlos mit böigem Schauerwetter weiter. Seit 69 Jahren hat man nur drei Wirbelstürme außerhalb der Jahreszeit zwischen Mai und Oktober in diesem Seegebiet festgestellt.
Und wenn diese Störung nun den vierten in 70 Jahren einleiten würde? Obwohl keine Annäherungszeichen eines Hurrikans sichtbar wurden, lähmte diese Frage unser ganzes Denken. Ich schlug Sturmsegel an.
Nach einer wilden Nacht mit Schauerböen aus nördlichen und nordwestlichen Richtungen und entsprechenden Segelmanövern, die uns viel Schlaf nahmen, wurden die Winde flau und umlaufend. Wir mußten Ruderwachen gehen.
Und das Meer war nicht mehr dunkelblau und brechergeschmückt unter dem Wehen des Windes. In bleierner Trägheit dünte es, ließ »Kairos« hilflos rollen. Erbarmungslos schlugen Blöcke und Segel. Jeder Schlag zitterte durchs ganze Schiff. Grenzenlosigkeit dehnte sich ringsum, da nichts in unserer Nähe geschah. Bleiern das Meer, gläsern der Himmel, der Horizont ausgelöscht. Gewitterwolken drohten. Sie zogen nicht, sie standen tags im Sonnenlicht, nachts in Mondschein und Wetterleuchten. Über ihnen schwebte Federbewölkung von Süd herauf. So blieb es tagelang.
Unsere Müdigkeit wuchs. Die Ruderwachen wurden zur Qual. Wir hatten diese Wetteränderung inmitten eines Gebietes, das regelmäßigen Passatwind während des ganzen Jahres aufweist, nicht erwartet. Sie traf uns völlig unvorbereitet, was unsere Umstellung erschwerte. Gestern noch in einem Paradies geträumt und heute in der Hölle aufgewacht: so war’s! Wir machten uns in suggestiver Eindringlichkeit klar, daß jeder Meter, jeder Meter und wieder jeder Meter das Schiff dem Ziele näher brachte und daß es unsere Aufgabe sei, jeden dieser Meter so zu steuern, als wäre er eine Seemeile.
So saßen wir am Tage in goldener Hitze und während der Nacht im blauen Wetterleuchten bewegungsloser Gewitter, Wache um Wache, während »Kairos« über eine Fläche torkelte, die aus zähem Öl gemacht schien. Wir konnten nichts tun als sitzen und steuern, dann schlafen, dann essen, dann wieder sitzen und steuern – Tag für Tag.
Unsere Müdigkeit nahm überhand. Hatte mich Elga abgelöst, so schlief ich bereits, bevor ich überhaupt das Bettzeug meiner Koje fühlte. Und kaum war ich eingeschlafen, so schien es, weckte mich Elgas Ruf. Waren vier Stunden vergangen? Ja – sie waren in todähnlichem Schlaf wie zu Sekunden geworden. Benommen stieg ich an Deck.∗
»Wind?«
»Kaum. Ein Knoten Fahrt«, sagt Elga.
Ich übernehme die Pinne, beginne auf den Kompaß zu starren.
»Ich hab’ eine Menge Bi-dem-Winder gesehen«, erzählt Elga stockend, »weißt du, diese Quallen, die segeln. Blau und rosa sind sie und fast durchsichtig. Wie die wohl von unten aussehen?«
Ich versuche, das gedanklich zu erfassen. »Keine Ahnung … sie treiben …« Ich blicke über die dünende See. Die Segel schlagen, der Mast zittert, die Blöcke poltern.
»Zum Abendbrot mache ich einen Eintopf«, fährt Elga aufmunternd fort, wobei ihr fast die Augen zufallen.
Sie steigt zur Kajüte hinab. Da unten ergeht es ihr so wie mir: sie wird schon schlafen, ehe sie das Bettzeug fühlt. Und mein Ruf nach vier Stunden wird wie nach vier Sekunden kommen.
Während der Wache, die wiederum keinen durchstehenden Wind brachte, fing ich mit der Pütz einige vorbeitreibende Bi-dem-Winder. Als ich Elga dann wecken mußte, fand sie die Tiere und konnte sie einer eingehenden Betrachtung unterziehen. An ihrer Unterseite hatten sie lange, nesselnde Fangfäden. Elga freute sich. Es half ihr etwas über die Müdigkeit hinweg.
Wind? – immer noch kein Wind. Einige Stunden später: Wind? – immer noch kein Wind. Einige Tage später: Wind? – immer noch kein Wind. Nur immer ein Hauch – aus Ost, aus Nord, aus Süd und West: falsche Versprechungen, die den Rudergänger zu einsamer Verzweiflung trieben.
Achteraus, wo früher einmal das Kielwasser geleuchtet hatte, zeigten sich jetzt nur einige lächerliche Blasen. Voraus, wo die Bugwelle bis zum Deck hinaufgesprüht hatte, geschah nichts als unbeholfenes Plantschen. Sollten wir schreien in Verzweiflung und Einsamkeit, zusammenbrechen unter der Last des Nichts? Wie stark waren eigentlich unsere Nerven?
Wir sprachen miteinander. Unsere Worte drangen durch die Sphären unserer Müdigkeit und weckten Zuversicht. Sie blieb stärker als die äußeren Zeichen unserer Fahrt. Sie mußte uns auch ohne Bugwelle, die gischtet, und ohne Kielwasser, das leuchtet, dem Ziele näher bringen. Durch sie wurden die Meter wirklich zu Seemeilen. Wir kamen ja immer noch voran, langsam zwar – Herrgott, wie langsam! – aber voran. Am zehnten Tage, nachdem Schauer und Böen – und unsere große Angst – die flauen Winde eingeleitet hatten, kam endlich der Passat wieder. Wir waren nun 26 Tage auf See – doch hatte das geringe Bedeutung.
Von Bedeutung war, daß sich der Wind aus Nordnordost stärkte. Die Ruderpinne war nicht mehr ein Stück totes Holz. Die schlaffen Segel formten sich, wölbten sich, begannen zu arbeiten. Eine Bugwelle zauberte neben die Bordwände Schaumstreifen, die sich verdichteten, zu knistern anhuben und schließlich eine leuchtende Spur hinterließen. Der Passat erreichte seine alte Kraft. Die schweren Wolken hoben sich. Aus ihren bewegungslosen Massen lösten sich kleine Schönwetterwolken und zogen, zogen mit dem erwachten Winde.
Wir fühlten Erleichterung.
Uns wurde alles neu geschenkt, der Tag, die Nacht, das Schiff, die Segel, der Himmel, die See – sogar unsere Müdigkeit. Denn endlich geschah etwas ringsum. Unsere Stimmung löste sich aus ihrer Verbissenheit. Es konnte geschehen, daß der müde Rudergänger ein Lied sang.
Wir mußten weiterhin unsere Ruderwachen gehen, da der Wind zu seitlich einkam, um das Setzen der Passatsegel zu gestatten. Aber »Kairos« lief wieder 4 bis 5 Knoten Fahrt. Das gab uns neue Kraft. Kompaßrose und Steuerstrich, von den übermüdeten Augen kaum noch erfaßt, brannten sich ins Gehirn ein.
»Kairos« segelte.
Wir fürchteten, daß unsere Müdigkeit Fehler in der Navigation verursachen könnte, Ablesungsfehler an Sextant und Chronometer, Rechenfehler – immer wieder kontrollierten wir uns gegenseitig.
»Kairos« segelte durch die schnell grob werdende See. Manchmal fiel die Müdigkeit von uns ab. Geschah es gleichzeitig bei beiden, so sprachen wir von der plötzlich nah gerückten Ankunft. Noch 400 Seemeilen bis Barbados! Die große Freude der Erfüllung begann, unsere Seelen zu stärken. Wie schön war es doch, auf einem guten Schiff einem guten Ziel entgegenzufahren; wie schön war es, gemeinsam in aller Einsamkeit den richtigen Weg zu finden; wie schön, täglich der Natur gegenüberzustehen und ihre Gesetze verstehen zu lernen. Und wir sprachen über den Preis, den der Mensch dafür zu zahlen hat. Einsamkeit, Erschöpfung, Müdigkeit und Angst – in der Erfüllung wandelt sich alles zum Guten.
»Kairos« segelte.
»Wenn wir nach unserer Fahrt gefragt werden, wie sie war«, sagte ich am Abend vor unserem Landfall, »so werden wir die Fragen beantworten können – gewiß. Fragen von Seglern, von Reportern, von Navigatoren, von Romantikern –« Ich nahm Elga die Pinne ab, denn meine Wachzeit hatte begonnen. Die Segel über uns standen wie schwarze Flügel vor dem Leuchten im Westhimmel. »Aber werden unsere Antworten etwas Wahres aussagen können, ich meine: über das Ganze? Wir waren doch nur ein Teil. Das Ganze war der Atlantik.«
Wir blickten zurück, wo unser leuchtendes Kielwasser nach kurzem Schäumen spurlos verschwand. Die Nacht hob sich dort über den Horizont. In ihr beschlossen lag der Aufbruch des nächsten Tages – aller Tage, der vergangenen wie der kommenden.
Als ich morgens an Deck kam, um meine Morgendusche zu nehmen, sah ich backbord achteraus drei Tölpel fliegen, die in charakteristischen Sturzflügen Fische fingen. Diese Vögel nisten an Land und fliegen tagsüber zum Fischfang seewärts.
Eine Stunde später sichtete Elga einen Tanker 5 Seemeilen entfernt auf Gegenkurs. Wie gebannt starrten wir zu der Erscheinung hinüber. Außer uns und unseren Dingen an Bord hatten wir ja seit 30 Tagen nichts Menschliches gesehen. Da zog er seinen Kurs, hob sich in den Seen, fiel gischtend in die Wellentäler und war richtig schön anzusehen.
Mittags kam die letzte astronomische Standortbestimmung. Schon am Vortage hatten wir unseren Standort von der Atlantik-Karte, auf der Barbados ein winziger Punkt ist, in die Ansteuerungs-Karte übertragen, die Barbados in allen Einzelheiten zeigt.
»Noch 36 Seemeilen bis zur Nordspitze!«
Elga rief es mir aus der Kajüte vom Kartentisch zu. Ich blickte vom Kompaß auf – eigentlich nur, um meine brennenden Augen zu entspannen. Als sich die Augen an die Ferne des Horizonts gewöhnt hatten und schon wieder zurückkehren mußten zu der flimmernden Enge der Kompaßrose – da sahen sie im Westen einen schmalen, grauen Strich. Er war ganz unbedeutend unter der Fülle hoher Kumuluswolken. Aber er war trotzdem nicht zu verkennen.
Und ich sagte es zu Elga, so wie man von einem Wunder spricht: »Elga, es ist Land voraus.«
Sie kam an Deck und blickte nun auch zu dem schmalen, grauen Strich. Dann ging sie zum Bug und stand dort lange wie angenagelt. Und dann kam sie zurück und weinte und sagte: »Ja, es ist wirklich Land.«
Es ist von unserer Atlantikfahrt nun nicht mehr viel zu berichten. Im Laufe des Nachmittags wurde aus dem grauen Strich eine Insel, auf deren Nordspitze wir zusteuerten. Unsere Navigation war so genau, daß wir den Kurs nicht zu korrigieren brauchten. Das beruhigte uns.
Während die Sonne unterging, konnten wir schon Einzelheiten an Land erkennen. Als wir ins Lee der Insel liefen, blinkten bereits Leuchtfeuer. Durch die Landmasse aufgehalten, verlor der Passat an Kraft, wehte schließlich gar nicht mehr. Der Seegang ließ nach. Stille umgab uns.
»Riechst du die Blumen?« fragte Elga aufgeregt.
Wir drehten »Kairos« bei und legten uns schlafen, nachdem wir uns überzeugt hatten, daß er leewärts abtrieb. Denn das Einlaufen in die Carlisle Bay vor Bridgetown wollten wir am Tage erleben. Wir wollten das neue Land sehen und es sollte uns sehen: mit allen Flaggen gesetzt! Ein Fest sollte uns das werden, ein Finale unter flatternden Farben und mit rasselnder Ankerkette als Schlußakkord.
So geschah es dann am Sonntag, dem zweiten Advent. Der Anker fiel. Die Kette lief aus und warf vertrocknete Krumen kanarischen Sandes aufs Deck. Wir stießen sie lachend über die Reling, wo sie ins glasklare Wasser fielen und langsam zu Boden sanken.

Wir ankern in der Admiralty Bay vor Port Elizabeth an der Leeseite der Insel Bequia. Namen sind Schall und Rauch. In dieser Admiralitätsbucht haben in vergangenen Jahrhunderten gewiß mehr Piraten als Admiräle geankert. Und Port Elizabeth besteht aus einer Handvoll Negerhütten um eine steinerne Kirche.
Es ist heiß. Wir haben unser Sonnenpersennig aufgetakelt, das vermittels starker Holzlatten vom Mast bis zum Heck und über die ganze Breite des Schiffes gespannt werden kann.
Die Bucht liegt vollkommen windlos, still wie ein See. Die Berghöhen mit ihren Spiegelungen auf der teilweise silbrig geriffelten Wasserfläche, die Fächerlinien der Palmen, das Weiß des Strandes, die Negerhütten mit blau aufsteigendem Rauch, die Insel-Schooner und eine amerikanische Ketsch vor Anker: es ist ein Bild, wie es noch nicht gemalt wurde.
Der Frieden der eleganten Palmenkronen am nahen Ufer wird in einer plötzlichen Regenbö zum Flirren fechtenden Widerstandes. »Kairos« reißt an der Ankerkette. Hastige, weißblasige Wellen springen über das Wasser. Niederströmender Regen löscht alle Bilder aus.
Als er abzieht, glänzt die Bucht für Minuten in Silbergrau. Dann bricht die Sonne hervor und verklärt Wasser, Ufer, Berge zu neuer Schönheit.
Wir sitzen und schauen. Diese Inseln mit ihren Buchten strahlen eine unerhörte Betäubung aus. Ihre Schönheit wirkt wie ein Rauschgift. Mit diesem Wissen muß man sich wappnen, will man sich ihrer Schönheit hingeben. Mehr als nur eine Weltumsegelung fand hier ihr vorzeitiges Ende.
»Jacht läuft ein!« sagt Elga.
Ich schrecke auf aus meinen Träumen. »Es ist Peter mit seiner ›Kinya‹.«
Peter Sch., Segler und Exportkaufmann, unser bester Freund, ließ sich nach einer Segelreise von Hamburg nach Südamerika auf Barbados nieder. Er baute sich dort eine Existenz auf und verwirklichte dabei den Traum seines Lebens: zwischen diesen Tropeninseln kann er Geschäftsreisen mit seiner Jacht machen.
Zehn Meter neben uns geht die »Kinya« vor Anker. Nachdem Peter das Deck aufgeklart hat, kommt er mit dem Dinghi zu uns herübergerudert.
»Frohe Weihnachten!« sagt er. »Laßt uns gleich baden, mir ist heiß.« Wir tun es und –
So sind diese Inseln. Ihre zauberhafte Gegenwart löscht Vergangenheit und Zukunft aus. Ich wollte über den Fortgang unserer Reise erzählen, sitze aber nun hier und träume und bade.
Wir blieben 14 Tage auf Barbados und lebten recht komfortabel, größtenteils in Peters Bungalow. Unser Freund kam am Nachmittag unseres Ankunfttages in die Carlisle Bay gesegelt, ging genauso wie eben jetzt zu Anker und brachte uns unsere Post, außerdem einen Karton mit frischem Brot und Obst, Butter in einer kleinen Eisbox: ein Segler weiß, was Seglern nach langer Fahrt fehlt. Die Begrüßung war stürmisch, wir hatten uns zwei Jahre lang nicht gesehen.
»Paßt auf, Leute«, sagte Peter. »Ich weiß nicht, wie eure Pläne sind. Ich wohne nördlich von Bridgetown in einem Bungalow am Strand. Wie wär’s, wenn ihr dort neben ›Kinya‹ auf der Reede ankert? Ist der Ankerplatz zu unruhig, könnt ihr im Bungalow wohnen. Tagsüber hab’ ich mein Geschäft, aber die Abende sind unser.«
»Großartig!« sagten wir. »Dann können wir einander endlose Seegeschichten erzählen.«
»Ja. Und Weihnachten feiern wir gemeinsam auf Bequia!«
Am nächsten Tage verholten wir »Kairos« zum Ankerplatz vor Peters Bungalow. Damit begann für uns ein Amphibienleben. Mit dem Schlauchboot pendelten wir zwischen Schiff und Bungalow hin und her. Elga konnte an Land Wäsche waschen, während ich mit den Instandhaltungsarbeiten an Bord begann.
Wir hatten plötzlich einen Eisschrank, eine Terrasse, einen Vorgarten mit schneeweißem Sand zum Wasser hin, einen palmenumrahmten Blick übers Meer – und abends unseren Freund, der das alles so großzügig zur Verfügung stellte. Da oft Seegang um die Nordspitze der Insel herumlief, der »Kinya« und »Kairos« auf der Reede schwer rollen ließ, blieben wir auch nachts an Land und schliefen im Wohnraum des Bungalows.
Wir fuhren mit Peter über die Insel. Wir sahen, was Zuckerrohr ist. Grün wie Gras, hoch wie zwei Männer, dicht wie Schilf wächst der Reichtum in ausgedehnten Feldern. Auf den Straßen zwischen den Feldern fuhren wir wie durch Schneisen: undurchdringliche Rohrmauern zu beiden Seiten.
Die Negerhütten der Dörfer schienen alle direkt aus »Onkel Toms Hütte« zu stammen. Vier Lattenwände sind durchaus nicht immer gleichmäßig zusammengenagelt worden mit je einer Fensteröffnung ohne Glas und einer Tür an der Vorderseite. Darauf ist ein Wellblechdach gesetzt. Braucht man mehr, um glücklich zu sein?
Im Hause leben Großeltern, Eltern, fünf, neun Kinder – es kommt wirklich nicht auf ein paar mehr oder weniger an. Alle sind froh und heiter. Da mit Petroleum gekocht und vielfach auch beleuchtet wird, geschieht es häufig, daß so ein Holzhaus Feuer fängt. Brennt es ab – wie herrlich, diese Abwechslung! – so zieht die Familie mit Kind und Kegel zu Verwandten. Brennt es nicht ab, löscht die wohlgeübte Feuerwehr, so ist es auch gut – haha! Man zieht mit Kind und Kegel wieder ein.
Die Neger hier lieben die Arbeit nicht, aber am Sonntag wird gefaulenzt. Vor der Haustür, unter einer Palme, unter den Goldbuchstaben eines Denkmals aus der Kolonialzeit, auf einer alten Seeräuberkanone saßen, lagen, hockten, kauerten sie, die Nachfahren schwer arbeitender Sklavengenerationen. Sie schliefen, träumten oder unterhielten sich, wobei sie die entspannte Körperlage hin und wieder fachmännisch wechselten. Zum Abend rafften sie sich auf und holten ihre Musikinstrumente.
»Wovon leben sie?« fragte Elga.
»Sie arbeiten in der Stadt«, sagte Peter, »als Schauerleute, Taxifahrer, Ladengehilfen, Omnibusschaffner, Boten – ach, so alles mögliche. Auf dem Lande arbeiten sie als Plantagenarbeiter. Sie arbeiten, wenn sie Lust haben oder Geld brauchen. Lust haben sie nie, Geld brauchen sie immer.«
»So ging’s mir auch«, sagte ich mit Nachdruck.
»Man kann sich nicht auf sie verlassen«, sagte Peter.
»In welcher Hinsicht?«
»Sie denken anders als wir. Also – ein schwarzer Lagerhalter ist angewiesen, Meldung zu machen, wenn ein Artikel ein bestimmtes Minimum erreicht hat. Es geschieht, daß der Lagerbestand dann doch plötzlich geräumt ist. Zur Rede gestellt, sagt unser großer, schwarzer Lagermeister: ›O mistarr, das ist schrrecklich, ich weiß. Aberr gesterrn warr noch viel zu viel da!« Es handelt sich um einen Artikel, der seit Jahren einen völlig gleichmäßigen Abgang hat.«
»Die Regierung ist schwarz?« fragte ich. »Wie geht denn das Regieren?«
Peter bremste das Auto scharf, weil eine hoffnungsfrohe Negermammy in schneeweißem Kleid und unter einem Federhut riesigen Ausmaßes mit drei schokoladenfarbigen Kleinkindern gravitätisch über die Straße zur Kirche schritt.
Dann sagte er: »Regierungs- und Verwaltungsleute werden in England ausgebildet. Manchmal kommt bei ihrem Regieren und Verwalten etwas heraus, als ob sie zuviel gelernt haben – manchmal, als ob sie alles vergessen haben.«
Weitere Kirchgänger kamen uns entgegen. Die meisten Frauen und Mädchen waren sonntäglich weiß gekleidet. Alle trugen Hut, Schirm, Handtasche und Stöckelschuhe. Dicke Mammies freilich gingen barfuß, trugen aber die viel zu kleinen Schuhe in der Hand. Und alle hatten sorgfältig gesträhntes Haar.
Glattes Haar, wie es weiße Frauen haben, das ist der höchste Wunsch jeder schwarzen Eva. Wenn’s mit Gewalt und Pomade nicht geht – und es geht meist nicht – muß ein Zopf gemacht werden. Und ist das Krusselhaar nicht mit einem Zopf zu bändigen, dann tun es eben mehrere.
»Sieh, sieh bloß!« rief Elga. »Die hat fünf – nein, sieben Zöpfe!« Sie fiel ins Rückenpolster zurück. »Und alle mit kleinen roten Schleifen.«
Was bei den Frauen die Frisur, war bei den Männern der Hut. Es gab keine Farbe und keine Form, die nicht getragen wurde. Der Vielfalt war nichts hinzuzufügen und auch nicht dem Stolz, mit dem diese Hüte getragen wurden.
»Sie sind großartig«, sagte ich. »Ich mag sie!«
»Die Hüte?« fragte Elga und schnappte nach Luft.
»Nein, nein. Die Schwarzen, die Neger. In dieser Schicksalsstunde beginne ich eine tiefe Zuneigung zu farbigen Menschen zu fassen – jawohl!«
Peter seufzte. »Du hast noch nie mit ihnen arbeiten müssen.«
Meine neue Völkerliebe war zu allem bereit. »Na, und?« fragte ich aggressiv. »Ich habe ihre Frisuren und Hüte gesehen. Was ist das schon: mit ihnen arbeiten – mit ihnen lustig sein will ich!«
»Das kannst du haben«, sagte Peter.
»Ich nehme dich beim Wort, Seemann. Wann?«
»Heute abend.«
Wir fuhren durch Zuckerrohrfelder zur Ostküste, wo der Atlantik in riesenhafter Brandung zu stäubender Gischt verdampfte.
Elga starrte ängstlich-fasziniert auf die donnernde See. »Da zu stranden – na, ich danke.«
»Für die Besatzung ein böses Ende, ja«, antwortete Peter. »Gewinn freilich für den, der das Strandgut birgt.«
Wir sahen ihn fragend an.
»Es ist ein Märchen«, erklärte Peter, »ein karibisches Märchen – grausam, piratenhaft, gewinnbringend. – Laßt uns hier picknicken.«
Auf einer Hangwiese verzehrten wir das von Elga vorbereitete Essen. Peter erzählte: »Vor zweihundert Jahren lebte ein Mann namens Sam Lord hier auf der Insel. Er ließ sich ein festungsähnliches Haus an der Südspitze bauen, direkt am Strande hinter dem Cobbler Reef. Er gewann seinen sagenhaften Reichtum dadurch – also, er hatte auch Zuckerrohrplantagen, die großen Gewinn abwarfen. Aber nebenher pflegte er Schiffe mit falschen Feuern aufs Cobbler Reef zu lenken. – Noch heute heißt das Haus Sam Lords Castle. Ein Amerikaner hat es kürzlich gekauft und natürlich ein Luxushotel daraus gemacht.«
Die Südspitze der Insel schob sich flach ins Wasser. Viereckig festungsgleich steht auf ihr ein Haus, in grauen Steinquadern erbaut. Von der Gartenmauer am Strand sahen wir das Riff. Es lag etwa eine Seemeile vor der Küste. Die See tobte über ihm.
Sam Lord vor zweihundert Jahren brauchte nichts weiter zu tun, als hier an Land einige Lichter wie Ankerlaternen von Schiffen aufzuhängen. Bei den groben Navigationsmethoden seiner Zeit genügte das, um das Opfer zumindest unsicher zu machen.
»Mann, merkwürdige Lichter. Gefallen mir nicht«, mag der Kapitän eines zur Carlisle Bay bestimmten Schiffes gesagt haben.
»Es müssen Ankerlichter sein, Sir«, antwortet der Maat. »Die Schiffe liegen ruhig. Das ist bereits im Lee der Insel.«
Die beiden Männer starren in die Nacht.
»Lassen Sie die Bramsegel wegnehmen und schicken Sie einen Mann nach vorn zum Loten«, ordnet der Kapitän an. »Ausguck in den Vortopp! Ja, es scheint der Ankerplatz zu sein.«
Die Segel werden festgemacht. Von vorne klingen bald die ausgesungenen Lotmessungen. Aber das Riff springt steil zur Oberfläche.
»Brecher« brüllt der Ausguck im Vortopp plötzlich. »Brecher voraus!«
»Abfallen, Gott im Himmel!« Der Kapitän mag selbst rasend in das Steuerrad gegriffen haben.
Es ist zu spät. Mit knirschender, splitternder Präzision vollzieht sich die Strandung. Von Land kommen Boote, Sam Lords Boote, um zu bergen, was zu bergen ihnen nach dem Strandrecht zusteht. Menschenleben stehen nicht hoch in Kurs bei diesem Bergungsunternehmen.
In der Halle des Hotels standen wir vor Sams Bild. Es war nicht gut gemalt, aber gerade darum zeigte es primitive Dämonie. Sams Gesicht ist völlig ausdruckslos. Was war er für ein Mensch? Saß er so, wie das Bild ihn zeigt, am Fenster und betrachtete unbewegt die Katastrophe? Sprang er selbst in eines der Boote, um die Beute im geborstenen Laderaum zu prüfen? Wurde sein Treiben niemals durchschaut? Überlebte kein Zeuge die Strandungen?
Die Palmen am Strande beantworten diese Fragen nicht; ebensowenig die See, die sich über dem Riff zu Brechern formt und schäumend zerbricht, was ihr widerstehen will. Unzählige Fragen dieser Art heben sich mit den Brechern, die die Karibische See auf ihre Inseln wirft – Fragen, die in Gier und Mordlust, in Leid und Blut ihren Ursprung haben und ohne Antwort bleiben werden bis zum Jüngsten Tag.
Abends saßen wir in dem Schuppen einer Negerbar und tranken Rum mit Cola. Wir konnten unsere Füße nicht stillhalten, denn der Rhythmus des Kalypso war hinreißend. Er ist Volksgesang in bestimmter Taktfolge, in die hinein der Text vom Sänger improvisiert werden muß. Zu Zeiten des Karnevals werden Sängerkriege zwischen Kalypsosängern ausgetragen, bei denen das Publikum bis zur Raserei mitgeht. King Fighter, Lord Sivers, Big Sir Bell sind die Künstler-, besser Kriegsnamen berühmter Sänger. Glorious Cry war im letzten Jahr unbestrittener Matador gewesen. Ihn erwarteten die Schwarzen hier in schnatternder Ausgelassenheit.
Er kam in grauer Hose, rot-grün karierter Jacke, lila Schlips und mit einem Hut, der seinem jüngsten Sohn zu klein gewesen wäre. Er hatte ein kluges Pferdegesicht und aufmerksame Augen. Er strahlte vor Freude. Das Publikum war bereits von seinem Anblick begeistert.
Glorious Cry sang. Die Zuhörer belohnten ihn mit Toben, Aufspringen, Mitsingen, Tanzen. Wir waren in eine Vorhölle der Freude geraten. Wir lachten und klatschten ebenfalls.