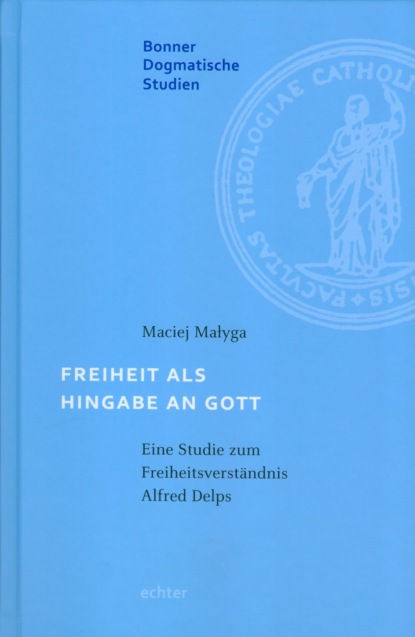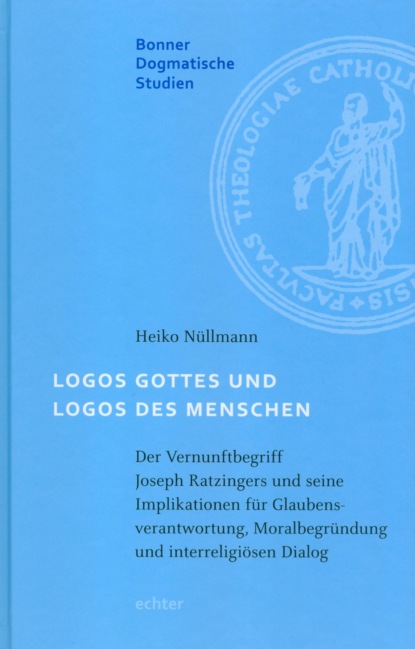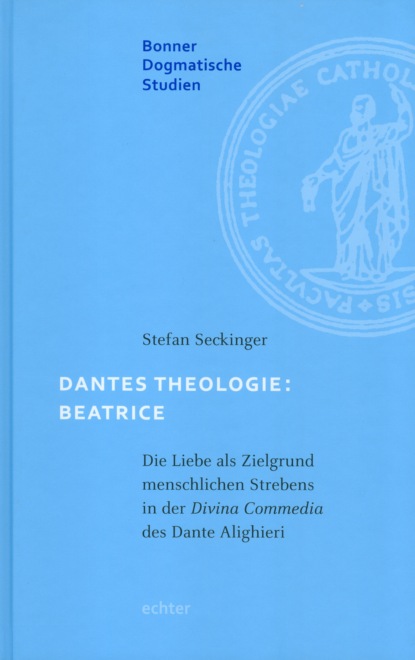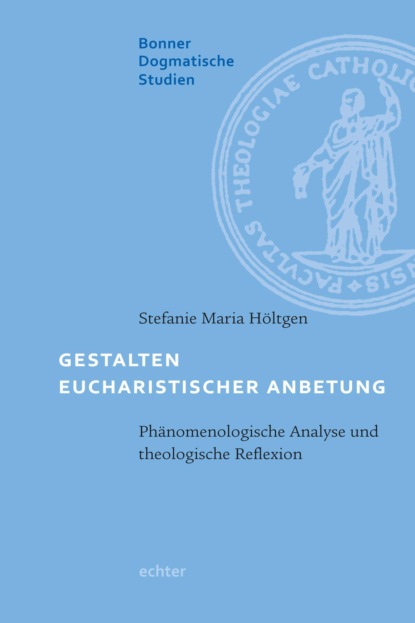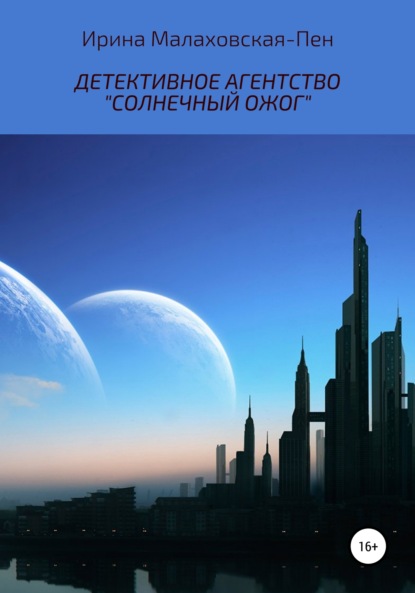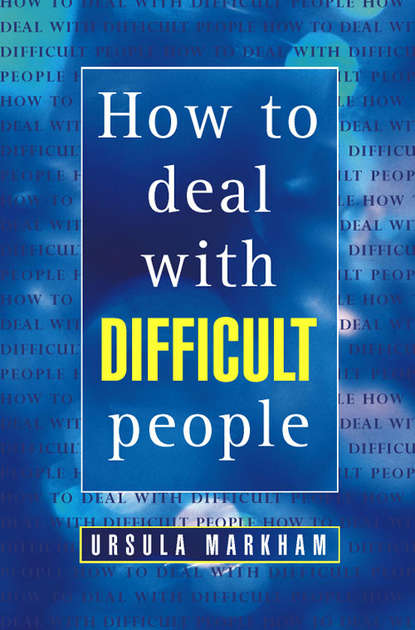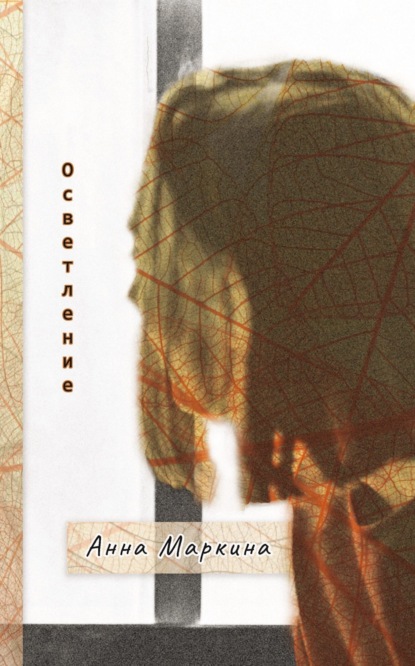- -
- 100%
- +
Die sich aus seinen Schriften ergebenden Ideen müssen – in Ermangelung eines vollständigen Systementwurfs – genügen, um sein Denken zu begreifen. Dies betrifft notwendigerweise auch sein Freiheitsverständnis. Zwar gibt es Texte wie der gerade erwähnte Der Mensch und die Geschichte, wo die Frage nach der Freiheit große Beachtung findet, oder die im Gefängnis geschriebene Meditation zum dritten Adventssonntag, die eigentlich sein ganzes Freiheitsverständnis zusammenfasst,31 aber letztlich bleiben seine Freiheitsaussagen fragmentarisch und verstreut über eine Vielzahl von Schriften.
Einige wenige Werke über Alfred Delp liegen bereits vor. Unter den uns interessierenden Arbeiten zu Delps philosophischem Werk erwähnen wir an erster Stelle das Buch von Richard Schaeffler. Dessen 1978 veröffentlichte Frömmigkeit des Denkens? Martin Heidegger und die katholische Theologie bezieht sich nicht allein und vornehmlich auf Delp, sondern betrachtet das Verhältnis der katholischen Theologie zum Denken Heideggers überhaupt. Die dem Verfasser von Tragische Existenz gewidmeten Passagen spielen aber für uns eine wichtige Rolle. Sie würdigen nämlich Delp entgegen der ‚Katholischen Heideggerschule‘ als philosophisch ernst zu nehmenden Interpreten.32
Die erste Monographie, die ausschließlich dem Denken Delps gewidmet ist, wurde von Karl H. Neufeld 1983 vorgelegt. In Geschichte und Mensch. A. Delps Idee der Geschichte. Ihr Werden und ihre Grundzüge zeichnet Neufeld ein breites Panorama des Curriculums, welches Delp durchlief, berichtet ausführlich von dessen Lehrern und Einflüssen. Im Kontext der Erörterung von Delps Standpunkt hinsichtlich der Probleme der Geschichte und des Menschen kommt auch das Thema der Freiheit zur Sprache. Als eine theologische Auseinandersetzung mit Delp und dem Freiheitsbegriff ist die Arbeit von Andreas Schaller, Lass dich los zu deinem Gott. Eine theologische Studie zur Anthropologie von Alfred Delp SJ (2012) zu erwähnen. Ein noch stärkeres Echo fand Delps soziologisches Denken in den Studien von Michael Pope, P. Alfred Delp SJ im Kreisauer Kreis. Die Rechts- und sozialphilosophischen Grundlagen in seinen Konzeptionen für eine Neuordnung Deutschlands (1994) und Petro Müller, Sozialethik für ein neues Deutschland. Die „Dritte Idee“ Alfred Delps – ethische Impulse zur Reform der Gesellschaft (1994). Gut dokumentiert ist das Leben Delps besonders in der Biographie von Roman Bleistein, Alfred Delp. Geschichte eines Zeugen (1989).33 Größere Beachtung fand Delps Engagement gegen den Nationalsozialismus innerhalb des Kreisauer Kreises.34 Außerdem liegen viele populärwissenschaftliche Schriften vor,35 die sein Denken und Leben einem breiteren Leserkreis nahebringen wollen.
Insbesondere zu Delps Freiheitsverständnis findet sich allerdings noch keine Untersuchung. Vieles ist bezüglich seiner Auseinandersetzung mit Heideggers Sein und Zeit nach wie vor unaufgearbeitet.36 Mit unserer Studie zur Frage nach Delps Freiheitsverständnis versuchen wir, dieses Desiderat zu erfüllen.
Die vorliegende Arbeit bietet also eine Rekonstruktion des Delp’schen Freiheitsverständnisses und ist demgemäß zuallererst als historische Studie zu verstehen. Freilich muss sie dazu auch systematische Züge annehmen, weshalb sie die teils von Delp selbst nicht mehr vollendeten Entwürfe und Gedanken ergänzen und weiterführen muss.
Vorab jedoch sind die für unser Thema wichtigsten Entwicklungen im Leben Delps biographisch zu skizzieren, insofern sie für dessen Werk einen wichtigen hermeneutischen Hintergrund darstellen. Wir fragen nach dem Denken, das ihn während des Studiums prägte, und suchen nach den Ereignissen, die sein Freiheitsverständnis gestalteten. Die folgenden drei Bezugspunkte werden für das Verständnis der Delp’schen Freiheitshermeneutik bestimmend sein: Zunächst (1.) untersuchen wir die sich um die Gottesfrage konzentrierenden Auseinandersetzungen mit Heidegger und der nationalistisch geprägten Deutschen Glaubensbewegung, dann (2.) fragen wir nach Delps Verhältnis zur Ideologie des Nationalsozialismus. Schließlich (3.) richten wir unseren Blick auf die letzten Monate von der Verurteilung bis zur Hinrichtung Delps, jene so kurze und dabei dem Denken überaus fruchtbare Zeit.
Die weitere Struktur der vorliegenden Untersuchung drängt sich nach der Lektüre von Delps Schriften geradezu auf. Delp sieht die zwei möglichen Wege der Entwicklung der Freiheit: (1.) in der Immanenz oder (2.) im Verhältnis zu einem transzendenten Du, das der absolute Gott ist. Wir werden uns daher im zweiten Kapitel mit der rein immanent gedeuteten Freiheit auseinandersetzen, um im Anschluss daran im dritten Kapitel seine Sicht auf die Freiheit innerhalb des Gottesglaubens zu thematisieren.
In diesem zweiten Hauptteil der Arbeit werden wir außerdem Delps Kritik am Freiheitsdenken der Neuzeit rekonstruieren. Die Auseinandersetzung mit Heideggers Sein und Zeit spielt hierfür eine wesentliche Rolle, weshalb dieses Werk Heideggers in den thematisch relevanten Grundzügen zunächst dargestellt werden muss. Eine wichtige Aufgabe wird dann sein, Delps von der primären Intention von Sein und Zeit abweichende Sicht herauszuarbeiten und auf seinem damaligen Hintergrund nachvollziehbar zu machen. Vor dem Hintergrund der neuzeitlichen Philosophie, vor allem in Bezug auf Heidegger und eine sich von seinem Denken ableitende Weltanschauung des tragischen Heroismus, fragen wir nach den Wesenszügen der von Delp kritisierten Art der Autonomie. Die Frage, wie eine so verstandene Freiheit sich in der Geschichte vollziehen kann, werden wir mit Delps eigenen Beobachtungen beantworten. Der Jesuit konstatiert nämlich ein Phänomen der Selbstverneinung der Freiheit und legt es philosophisch aus. Diese Feststellung bildet zugleich den Schwerpunkt seiner Kritik an der nationalsozialistisch orientierten Gesellschaft.
Im dritten Hauptteil rekonstruieren wir zuletzt Delps eigenes Freiheitsdenken. Dieses wird von ihm einerseits als eine Reaktion auf die Krise des sich an seinem Ende befindenden neuzeitlichen Autonomieverständnisses begriffen, anderseits versteht er seinen Freiheitsentwurf als ein Vermächtnis christlicher Tradition. Wir werden mit Delp (1.) ein Fundament der Freiheit im Sich-selbst-transzendieren-Können des menschlichen Geistes ausfindig machen, (2.) werden die Welt im Sinne einer vorgegebenen Ordnung, die eine absolute Freiheit ausschließt, eine bedingte Freiheit hingegen zulässt, als den eigentlichen Ort des Freiheitsereignisses darstellen. Im Kern der Arbeit steht die Frage, warum Delp die Selbstverwirklichung des menschlichen Wesens, welche für ihn allein in Gott in umfassender Weise gelingen kann, als das Ziel der Freiheit begreift. Dies bedingt, dass weniger die menschliche Freiheit sowie das freie Wirken Gottes in der Geschichte an sich angefragt sind, sondern vor allem und zuletzt das Zusammenspiel beider Größen betrachtet wird. Letztendlich versuchen wir mit Delp zu zeigen, wie diese Freiheit in der konkreten Existenz gelebt werden kann. Diese Explikation der Kernfrage wird wesentlich auf zwei Begriffen des Delp’schen Denkens ruhen, die in ihrer Einfachheit eine ihnen eigene Tiefe haben: Anbetung und Hingabe.
1 Vgl. ECKERT, Freiheit: 99–100. Siehe auch SCHLIER, Zur Freiheit berufen: 216–233.
2 Vgl. WARNACH, Freiheit: 1064–1083.
3 Vgl. OEING-HANHOFF, Zur thomistischen Freiheitslehre: 274–276. Vgl. auch PESCH, Freiheit: 1083–1088.
4 Vgl. KASPER, Autonomie und Theonomie: 22f.
5 Vgl. KANT, Kritik der praktischen Vernunft: 30–33,124–132.
6 Vgl. AUER, Autonome Moral und christlicher Glaube: 205–236.
7 Vgl. KASPER, Autonomie und Theonomie: 23–31.
8 Vgl. SPAEMANN, Freiheit: 1088–1098.
9 Vgl. HEIDEGGER, Beiträge zur Philosophie: 138–141.
10 Vgl. SARTRE, Das Sein und das Nichts: 764.
11 Vgl. PRÖPPER, Freiheit: 100–105.
12 Vgl. PRÖPPER, Freiheit als philosophisches Prinzip der theologischen Hermeneutik: 15.
13 Vgl. SECKLER, Fundamentaltheologie: 351–357.
14 BLEISTEIN, Lebensbild Delps: 41. Die Werke Delps werden wir im Folgenden nach den 1982–1988 in fünf Bänden erschienenen, von Roman Bleistein herausgegebenen Gesammelten Schriften unter Angabe des Titels, des Veröffentlichungsdatums und des jeweiligen Bandes mit der entsprechenden Seitenzahl angeben.
15 Vgl. DELP, Tragische Existenz: II,126, ebd.: 131f. Siehe auch ders., Der kranke Held (in: Stimmen der Zeit, 1939): II,205.
16 Vgl. ders., Das gegenwärtige Weltverständnis (Vortrag, 21. November 1942): I, 289. An der Schwelle einer neuen Epoche wird das Denken Delps auch von Thomas Merton erörtert, der im Oktober 1962 in der Einleitung zur englischsprächigen Ausgabe der Gefängnisschriften schreibt: „Fr. Delp reminds us that somewhere in the last fifty years we have crossed a mysterious limit set by Providence and have entered a new era … there has been a violent disruption of society and a radical overthrow of that modern world which goes back to Charlemagne”, siehe MERTON, Introduction: xxi–xxii.
17 Vgl. PIEPMEIER, Die Moderne: 54–62.
18 Bleistein erwähnt als die vier Hauptthemen Delps: der zwischen Transzendenz und Immanenz lebende Mensch; die Welt der sozialen Gerechtigkeit, in der der Mensch als Person leben könne; der Mensch gewordene Gott Jesus Christus; die Kirche als Sakrament. Siehe BLEISTEIN, Geschichte eines Zeugen: 430–433.
19 Vgl. DELP, Epiphanie (Gefängnismeditation, Januar 1945): IV,216.
20 Vgl. ebd.: 217.
21 Thomas Merton bezeichnet die Gefängnisreflexionen Delps als mystisch und betont zugleich ihre Verbundenheit mit der alltäglichen Existenz des Menschen: „Fr. Delp was at the same time profoundly mystical and wide open to the broadest ideals of Christian humanism. It was by the gift of mystical intuition that he not only found himself in God but also situated himself perfectly in God’s order and man’s society”, siehe MERTON, Introduction: xxxviii, vgl. auch xli.
22 Vgl. ders., Das Schicksal der Kirchen (Gefängnisreflexion, 1944/45): IV,318.
23 Vgl. NEUFELD, Einleitung zu den Texten: 15.
24 DELP, Der Krieg als geistige Leistung (in: Stimmen der Zeit, 1940): II,239–248.
25 Vgl. NEUFELD, Einleitung zu den Texten: 11,20,33.
26 Vgl. DELP, Gestalten der Weihnacht (Gefängnismeditation, Dezember 1944): IV,213.
27 Im Folgenden SZ mit Angabe der Seitenzahl.
28 DELP, Tragische Existenz: II,39–147.
29 Ders., Der Mensch und die Geschichte (1943): II,349–429.
30 Ders., Im Angesicht des Todes (1947), Zur Erde entschlossen (1949), Der mächtige Gott (1949).
31 Vgl. ders., Dritter Adventssonntag (Gefängnismeditation, Dezember 1944): IV,161–176.
32 Vgl. SCHAEFFLER, Heidegger und die katholische Theologie: besonders 48–54.
33 Vgl. BLEISTEIN, Begegnung mit Delp. Siehe auch die persönlichen Erinnerungen von Delps Freund, MATZKER, Begegnung und Erfahrung mit Alfred Delp.
34 Siehe BLEISTEIN (Hg.), Dossier Kreisauer Kreis (1987), ders., Die Jesuiten im Kreisauer Kreis. Ihre Bedeutung für den Gesamtwiderstand gegen den Nationalsozialismus (1990), FUCHS (Hg.), Glaube als Widerstandskraft (1986), NEUFELD, Katholik und Widerstand (1985). Siehe auch MERTON, Introduction: xxi–xlii.
35 Vgl. LÜCK, Alfred Delp (1984), SALTIN, Durchkreuztes Leben (2004), HAUB/SCHREIBER, Held gegen Hitler (2005), FELDMANN, Leben gegen den Strom (2006), ENDRAß, Gemeinsam gegen Hitler (2007), SCHULTE (Hg.), Delp. Programm und Leitbild für heute (2007), HAUB, Beten und Glauben (2007), LEHMANN/KISSENER, Das letzte Wort haben die Zeugen (2007). Im Auftrag der Alfred-Delp-Gesellschaft von Mannheim wird seit 2007 von R. ALBERT, R. HARTUNG und G. SALTIN ein Alfred-Delp-Jahrbuch herausgegeben, das die Erforschung des Lebens und des Denkens des Jesuiten zu fördern und sein Werk in dessen aktueller Relevanz zu erschließen versucht.
36 Vgl. SALTIN, Biographische Ergänzungen und Forschungsdesiderata: 114.
I. Die „Zwangsjacke“ der Geschichte und das Kreuz der Freiheit – der Lebenslauf Alfred Delps
Das Freiheitsverständnis Alfred Delps wurde so stark durch die Erfahrungen seines Lebens geprägt, dass es gerechtfertigt und sogar notwendig ist, seine Biographie in den für sein Denken entscheidenden Zusammenhängen darzustellen.1 Wenn er über die Geschichte schreibt, dass sie gleichsam zu einer „Zwangsjacke“ werde, so dass der Mensch sich um der eigenen Freiheit willen an das Kreuz nageln lassen müsse,2 dann spiegelt sich darin vor allem auch der Weg seines eigenen Lebens wider. Diese über das bloße biografische Nacherzählen weit hinausgehende Perspektive wird dadurch möglich, dass Alfred Delps Lebenslauf – etwa in der bereits erwähnten, von Roman Bleistein verfassten Biographie – gründlich dokumentiert ist.
Die folgende Skizze des Delp’schen Lebenslaufes konzentriert sich deshalb, ohne auf die Darstellung der wichtigsten biografischen Fakten zu verzichten, auf seinen Denkweg durch die Philosophie, die Theologie und die im Allgemeinen für unser Verständnis des Jesuiten relevanten Entwürfe. Sie zeigt bestimmte Lebensereignisse als Anhaltspunkte für seine Freiheitsreflexion und versucht vor allem seinen Denkprozess nachzuzeichnen. Aus diesem Grund lassen sich die einzelnen Etappen nicht immer scharf voneinander abgrenzen. Die Quelle der Darstellung ist uns vor allem Delp selbst. Wir erkennen dabei eine gewisse Steigerung in der „Denkbiographie“ Delps: Der Takt seines Werkes schlägt anfänglich langsamer, er steigert sich allmählich, bis er in den letzten Tagen seines kurzen Lebens das rechte Tempo gefunden zu haben scheint.
1. Herkunft und Ausbildung (1907-1938)
Alfred Delp wurde am 15. September 1907 in Mannheim geboren. Am 11. März desselben Jahres wurde Helmuth James von Moltke geboren, der später sowohl innerhalb des Kreisauer Kreises als auch vor Gericht Delps Schicksalsgefährte sein wird.3 Der spätere Präsident des höchsten Gerichtshofes des Dritten Reiches und zukünftige Scharfrichter der beiden Genannten, Roland Freisler, besuchte damals als 14-jähriger Schüler das Kaiser-Wilhelm-Gymnasium in Aachen.4 Der 18-jährige Freiburger Gymnasiast Martin Heidegger, der spätere Gesprächspartner und Bezugspunkt Delps, bekam in diesem Jahr von einem befreundeten Priester, dem späteren Freiburger Erzbischof Conrad Gröber, Franz Brentanos Dissertation Von der mannigfachen Bedeutung des Seienden nach Aristoteles, deren Frage nach dem Sein zum Anlass für das zwei Jahrzehnte später verfasste Werk Sein und Zeit wurde.5 Die Wege dieser Menschen haben sich später verflochten. Sie alle haben somit irgendeinen Anteil an der Entstehung der Delp’schen Freiheitsreflexion.
Die Mutter von Alfred Delp, Maria Bernauer, Köchin von Beruf, war katholisch; sein Vater, Johann Adam Friedrich Delp, von Beruf Kaufmann, war dagegen protestantisch. Diese konfessionelle Familiensituation spiegelt sich in Alfred Delps Leben wider, insofern er zwar katholisch getauft wurde, ab 1915 aber eine evangelische Volksschule in Lampertheim besuchte – dahin war seine Familie ein Jahr vorher umgezogen. Zur Kommunion und zur Firmung ging er 1921 wiederum in der Katholischen Kirche. In der Zeit seiner Gymnasialausbildung in Dieburg engagierte er sich innerhalb der christlichen Jugendbewegung „Neudeutschland“.
Einen entscheidenden Schritt seines Lebens bildete im April 1926 der Eintritt in das Noviziat der Gesellschaft Jesu im österreichischen Tisis bei Feldkirch/Vorarlberg. Nach den ersten Gelübden im Jahre 1928 begann er in Pullach bei München sein Philosophiestudium, das er 1931 mit dem Examen „de universa philosophia“ beendete. Aufgrund jenes Examens wurde ihm 1939 der kirchliche Titel eines Doktors der Philosophie verliehen. In jene Periode fällt nun auch seine Auseinandersetzung mit Martin Heideggers Sein und Zeit, die letztendlich 1935 in die Schrift Tragische Existenz einging. 1934-1936 studierte er Theologie zunächst im holländischen Valkenburg, dann in Frankfurt/Sankt Georgen. Am 24. Juni 1937 empfing er durch den Münchner Kardinal Michael von Faulhaber die Priesterweihe. Seine lange Ausbildung endete mit den Examina „de universa philosophia et theologia“ (Theologisches Lizenziat), die er am 8. Juli 1938 ablegte. Eine weitere Ausbildung, die Delp 1939 an der Universität München beginnen wollte, verweigerten ihm die Nationalsozialisten.
2. Philosophische Prägungen
Der Name Alfred Delps wird meist zunächst einmal nicht mit einem bestimmten philosophischen Denken assoziiert.6 Dieses Bild wird es zu korrigieren gelten. Aufgrund seines Engagements für den Kreisauer Kreis, das letztendlich zu seiner Hinrichtung führte, gilt er im Allgemeinen vor allem als eine Widerstandsgestalt innerhalb des Nationalsozialismus. Zu diesem Bild trugen auch seine kurz nach dem Krieg unter dem Titel Im Angesicht des Todes veröffentlichten Gefängnisaufzeichnungen wesentlich bei. Delp ist darüber hinaus als Soziologe bekannt, was gleichermaßen in Relation zu seinem Engagement für den Kreisauer Kreis steht. Die soziale Frage muss wohl als eines der wichtigsten Anliegen Delps gelten. Erkennbar ist dies schon in seinem Theaterstück Der ewige Advent aus dem Jahr 1933 sowie in seinen zahlreichen Rezensionen zu sich mit sozialen Fragen beschäftigenden Büchern. 1939 übernahm Delp die Verantwortung für die Abteilung für soziale Fragen in der Redaktion der Stimmen der Zeit, der Monatsschrift der deutschen Jesuiten. Als Helmuth James von Moltke, Gründer und Leiter des Kreisauer Kreises, nach einem im Bereich der Arbeitsfrage kompetenten, christlich denkenden Gesprächspartner suchte, wurde Delp in den Kreis gerufen.7 Wir könnten noch wesentlich mehr über jene Seite von Delps Denken sagen, wenn nicht sein soziologisches Hauptwerk Die dritte Idee in der Kriegszeit verloren gegangen wäre.8
Die Interessen Delps gehen aber über die Soziologie weit hinaus. Er selbst sieht seine Aufgabe in der Verteidigung des Menschen als Menschen und erklärt:
[D]as war der Sinn, den ich meinem Leben setzte, besser, der ihm gesetzt wurde: … helfen, dass die Menschen nach Gottes Ordnung und in Gottes Freiheit leben und Mensch sein können9.
Der uns heute zugängliche Befund spricht dafür, dass Delp nichtsdestotrotz mehr ein Philosoph und Theologe als ein Soziologe war.10
a) Neuscholastik
Das Denken Delps erwächst aus einem bestimmten Kontext „zwischen Neuscholastik und Moderne“11. Seine Ausbildungszeit sowie seine wissenschaftliche Tätigkeit fallen in die Zeit der neuscholastischen Strömung in der katholischen Theologie und diese Art des Philosophierens gestaltete Delps Denken am stärksten. Er war ihr gerade auch durch seine Ausbildung intellektuell verbunden.12 Ein Beispiel für dieses neuscholastische Philosophieideal Delps ist in seiner höchst positiven Äußerung zur von J. B. Lotz und J. de Vries verfassten Einführung in die Philosophie mit dem Titel Die Welt des Menschen. Eine Vorschule des Glaubens zu finden. Aufgrund der im Buch dargestellten philosophischen Prinzipien – die natürliche Erkenntnis, der menschliche Drang nach Sinn, „Gesamtschau des Wirklichen“ – sah Delp in jenem Buch eines der gelungensten zu diesem Thema überhaupt.13
b) Moderne
Bereits mit den Werken von Joseph Maréchal (1878-1944) und Erich Przywara (1889-1972) wurde Immanuel Kant für die Jesuiten in Deutschland und in Österreich zum wichtigsten Gesprächspartner.14 Delp, bei dem anfangs der neuscholastische „Schulkontext“ die entscheidende Rolle spielte, setzte sich dennoch gern mit der gegenwärtigen Philosophie auseinander. Ein Beispiel hierfür ist vor allem sein Werk Tragische Existenz. Zur Philosophie Martin Heideggers, welches 1935 in Freiburg erschien. In der christlich geprägten Philosophie der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts schreibt sich Delp damit in die Reihe derjenigen scholastischen Denker ein, die sich mit der Existenzphilosophie systematisch beschäftigen.15
Im Laufe der Zeit wurde sein Denken immer unabhängiger von dem anderer Denker und seine letzten, der Geschichte und dem Menschen gewidmeten philosophischen Schriften können wohl Originalität beanspruchen.16 Dabei fällt die Sicherheit und Schärfe auf, mit der der junge Jesuit – zuerst in der Zeit der zerbrochenen Sicherheit und des Nihilismus, danach in der Epoche der blinden Ideologie – seine Gedanken mitteilt und sich mit den Großen der intellektuellen Welt auseinandersetzt.17
3. Auseinandersetzungen
Im Zentrum seines Lebens steht die Auseinandersetzung mit den Herausforderungen des Zeitgeistes, wobei die Freiheitsfrage immer mehr in den Mittelpunkt des Interesses rückt. Zuerst bot Delp dem Denken Heideggers und der pseudoreligiösen Ideologie der Deutschen Glaubensbewegung die Stirn.18 Dann suchte er nach einer Begegnung mit der sich noch nicht in seiner ganzen Bosheit enthüllenden Ideologie des Nationalsozialismus, zu deren Kritiker er später wurde, als er immer entschiedener sich dem die Freiheit unterdrückenden Kollektivismus entgegenstellte. Letztendlich musste er sich mit der Erfahrung eigener Unfreiheit auseinandersetzen.
a) ... mit der Gottesfrage (1931-1936)
Im Jahr 1935 machte Delp in der Schrift Tragische Existenz seine Auseinandersetzung mit Heidegger der Öffentlichkeit zugänglich. Im gleichen Jahr nahm er den Kampf gegen die Ideologie der Deutschen Glaubensbewegung auf. Beide Auseinandersetzungen spielen sich in seiner Studienzeit ab und gehören zeitlich einer einzigen Epoche an. Ihre Gemeinsamkeiten gründen aber nicht nur in der Entstehungszeit, sondern auch in der Perspektive, aus welcher Delp sie bedenkt. Er tut es nämlich vor dem Horizont der Gottesfrage. Diese Auseinandersetzungen gehören insgesamt zu den Dingen, die Delps Denken zutiefst bestimmen, biografisch sind sie jedoch kaum bemerkbar. In den folgenden biografischen Skizzen machen wir sie eher als den Rahmen für Delps Denken kenntlich, dessen Inhalt im weiteren Teil der Arbeit rekonstruiert werden soll.
Delps Tragische Existenz, eine der ersten Stellungnahmen von katholischer Seite zur Philosophie Heideggers, reifte ein paar Jahre, bevor sie 1935 in Druck ging. Delp setzte sich mit Sein und Zeit schon 1931 während seiner philosophischen Ausbildung, die unter dem Einfluss seines von Maréchal bestimmten Lehrers Alois Maier verlief, auseinander.19 Delp erarbeitete damals ein Referat mit dem Titel Darlegung und Würdigung der Philosophie Heideggers, dessen Kern in der „Ablehnung der als strikt immanent und innerweltlich aufgefassten Existenzialphilosophie Heideggers“20 besteht. In den intellektuellen Treffen mit Bernhard Jansen ergänzte er seine Auseinandersetzung mit dem Freiburger Philosophen durch ein Panorama der Entwicklung philosophischer Ideen von Luther über Kant zu Nietzsche.21 Als Ergebnis der Zusammenarbeit mit Jansen erschien schon 1933 die zweite Version der Auseinandersetzung mit Sein und Zeit, nämlich das Heideggerkapitel Sein als Existenz? Die Metaphysik von heute in dem von Jansen herausgegebenen Buch Aufstiege zur Metaphysik heute und ehedem.22
Tragische Existenz war also die dritte, zwar neu bearbeitete, aber dennoch in der Linie der zwei früheren Stellungnahmen stehende Konfrontation mit dem philosophischen Werk Heideggers. Der neue Titel signalisierte das klare Urteil über die nichtige Existenz.23 Der Inhalt bezog sich jedoch nicht nur auf Sein und Zeit, sondern auch auf die Erläuterungen Heideggers zu seinem eigenen Werk, nämlich die in Marburg im Wintersemester 1927/1928 gehaltene Vorlesung, die 1929 unter dem Titel Kant und das Problem der Metaphysik erschien sowie die Freiburger Antrittsvorlesung Was ist Metaphysik? aus dem Jahr 1929 und die im gleichen Jahr entstandene Abhandlung Vom Wesen des Grundes.