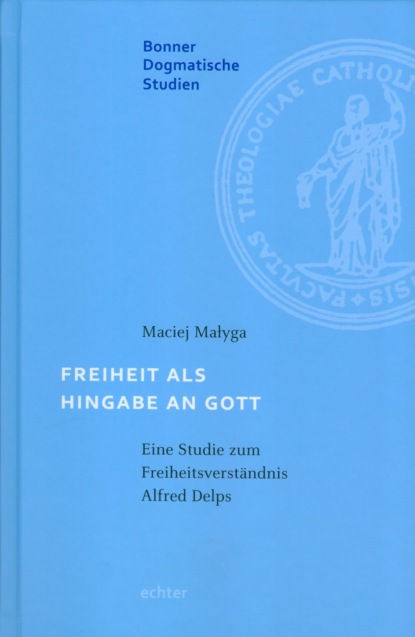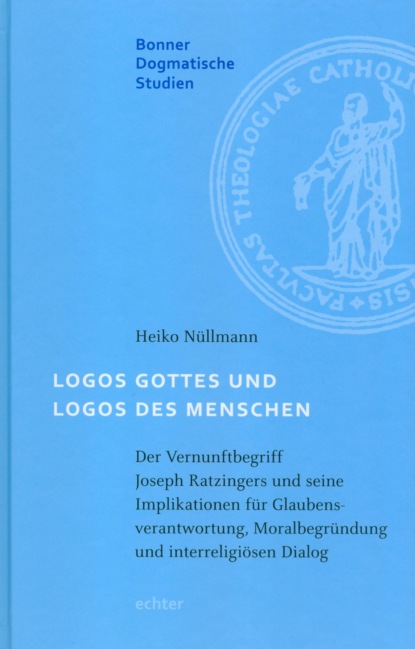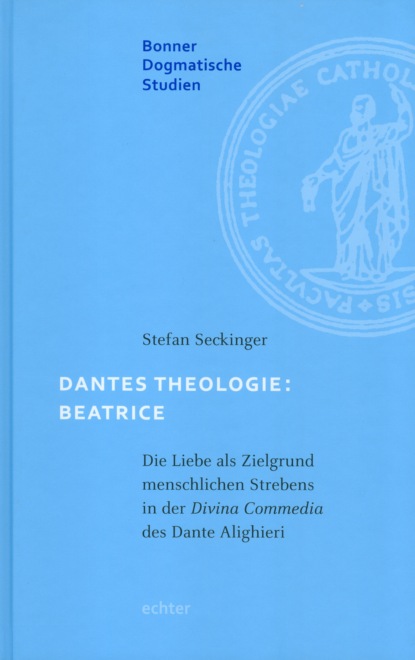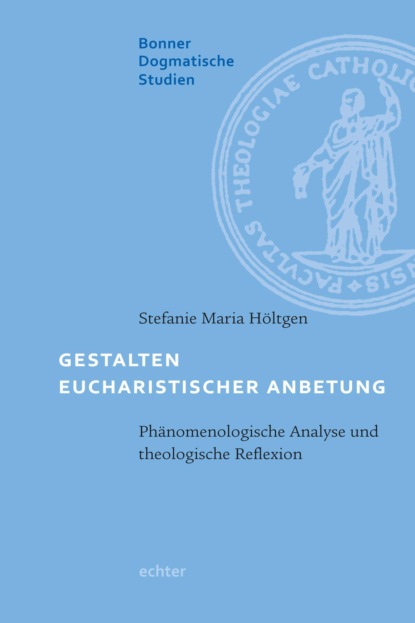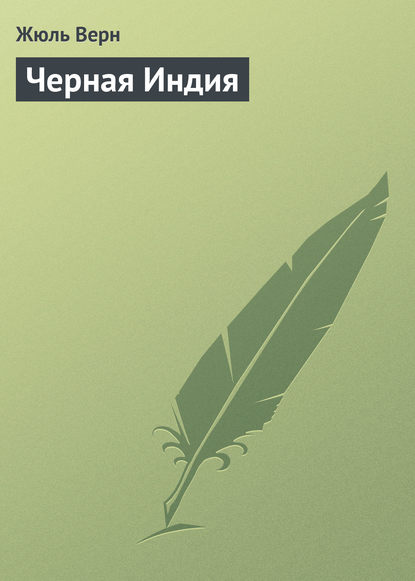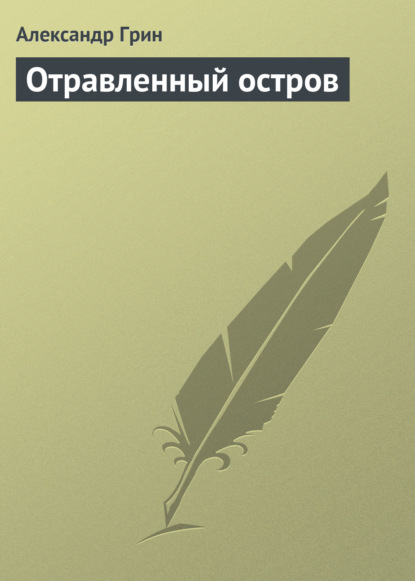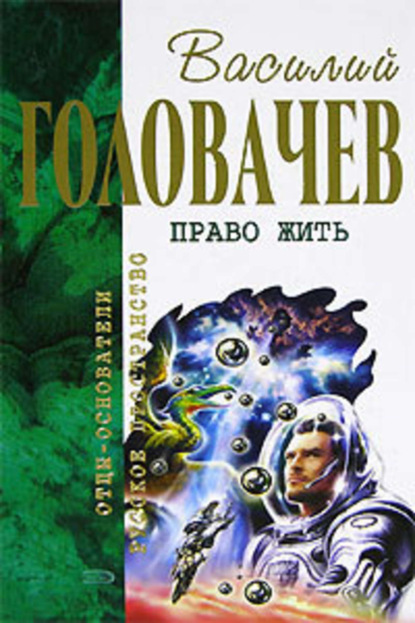- -
- 100%
- +
Im Jahr 1935/1936 schrieb Delp als Redakteur der kirchlichen Zeitschrift Chrysologus einige Predigten in der Reihe der Auseinandersetzung mit der Deutschen Glaubensbewegung. Die Texte bildete eine theologische Antwort auf die antichristlich und rassistisch geprägte religiöse Vision der Bewegung, gemäß der Gott mit dem Willen des deutschen Volks zu identifizieren sei. Mit ihrer Ambition, als die einzige Religionsgemeinschaft des Dritten Reiches zu fungieren, fand die Bewegung anfänglich Unterstützung bei der NSDAP.24 Indem Delp sie entschieden ablehnte, erwies er sich implizit schon als ein Gegner des Nationalsozialismus. Doch um zu einem ähnlichen Urteil auch hinsichtlich der politischen Dimension der nationalsozialistischen Ideologie zu gelangen, brauchte er noch viel Zeit. In politischer Hinsicht entzog er dem Deutschland Hitlers recht lange sein Vertrauen nicht.25
b) …mit der Ideologie des Kollektivismus (1935-1945)
Die meiste Zeit seines Lebens, seine Kindheit ausgenommen, verbrachte Delp unter dem Nationalsozialismus. Seine Stellung zu diesem war nicht immer die einer Gegnerschaft, vielmehr ging er anfangs einen von Sympathie zur Politik Adolf Hitlers getragenen Weg. Er hoffte zuerst auf eine Umgestaltung durch den Nationalsozialismus, entwickelte dann jedoch ein „teilweise abweichendes Verhalten“26 und realisierte zuletzt den gescheiterten Versuch, das Elementare seiner eigenen Position unter den Bedingungen der totalitären Ideologie zu bewahren. Delps entschiedene Gegnerschaft entwickelte sich also erst nach einem verhaltenen Mitläufertum, obwohl das ergreifende Finale seiner Biographie dazu zu ermuntern scheint, Grundzüge eines Widerstands schon möglichst früh zu sehen; dies auch aufgrund der Tatsache, dass man jede frei erhobene Stimme dieser Zeit des kollektiven Schweigens unterstreichen will.27 Delps erst allmählich wachsender Widerstand muss jeglichen Versuch einer vorschnellen Glorifizierung relativieren. Er war eben nicht einfach ein unerschütterlicher Held, sondern brauchte lange bis er zu einem angemessenen Urteil über die damalige Wirklichkeit fand. Auch seine letztendlich gewonnene Einsicht musste er immer wieder von Neuem erkämpfen – dies bezeugen seine Gefängnisschriften eindrucksvoll.
(1) Der Weg in den Widerstand gegen den Nationalsozialismus
Wie viele andere Menschen, vor allem die Jugend, verband Delp mit den Ereignissen von 1933 eine große Hoffnung auf die Erneuerung des Landes in allen Bereichen, woran sich – gemäß seiner ursprünglichen Meinung – auch die Christenheit hätte beteiligen sollen.28 Er gehörte nicht zu denen, die schon am Beginn der Machtergreifung Hitlers, dessen Ansichten seit Jahren bekannt waren, Gründe zur Beunruhigung sahen.29 Was Delp hingegen auffiel, war die Verbesserung der wirtschaftlichen Situation, wie er im Brief an seine Mutter vom 16. November 1933 schreibt.30
Die anfängliche Aufbruchsstimmung sollte Delp zum Mitmachen verleiten. Als Erzieher im Jesuitenkolleg in St. Blasien begrüßte er 1934 die Einführung der Hitlerjugend im Gymnasium, welche für ihn mit der Hoffnung verbunden war, die dem Führer anvertraute Jugend christlich prägen zu können.31 Gern widmete er sich paramilitärischen Übungen – ebenso wie sein philosophischer Opponent, der vom Soldatenethos begeisterte Rektor Heidegger, der im Oktober desselben Jahres ein „Wissenschaftslager“ in Todtnauberg für die Universitätsdozenten organisierte.32 Wären die Wissenschaftler, die das Lager von Freiburg aus mittels eines Fußmarsches erreichten, noch einen Tag in Süd-Richtung weitermarschiert, hätten sie sich mit den Hitlerjugendeinheiten von St. Blasien in gemeinsamen Manövern verbinden können.
Im Jahr 1935 plante Delp, ein Buch mit dem Titel Der Aufbau herauszugeben, das noch einige positive Entwicklungen des Aufbruchs von 1933 unterstreichen wollte.33 Totalitäre Akzente der neuen Macht sollte Der Aufbau zwar durchaus verurteilen, wertvolle Elementen des Nationalsozialismus aber aufnehmen und ausbauen; das Projekt wurde jedoch schnell aufgegeben.34 Aus heutiger Perspektive heraus ist die Beurteilung dieser Unternehmung eindeutig, und Karl Rahner, ein Vertreter derselben Generation, schrieb mit Recht, Delp möge 1935 die „Bedeutsamkeit und Kraft des ‚Neuaufbruchs‘, den die damalige Zeit proklamiert hat“, überschätzt haben, aber endlich sei seine Positionierung gegenüber dem System unbeirrter und deutlicher als bei manchen katholischen Theologen ausgefallen, „die in der Anfangszeit des Nazismus in seiner Ideologie noch möglichst viel Annehmbares zu entdecken versuchten“35.
Es gab in Delps Einstellung dem Nationalsozialismus gegenüber eine Übergangsphase zwischen Mitläufertum und Gegnerschaft, die sich aber mit einer einfachen Distanzierung nicht angemessen beschreiben lässt. Delp konstatierte zwar die Möglichkeit einer Gefahr, als er 1936 schrieb:
Einmal werden wir darauf achten müssen, daß diese neu entdeckte Kraftquelle nicht auch wieder übersteigert und absolut gesetzt wird36,
er war aber nicht imstande, diese näher zu bestimmen. Angesichts der Verhaftungen mancher Jesuiten durch die Nationalsozialisten wurde ihm aber klar, wie gefährlich auch seine eigene Situation war.37 Im Juni 1939 unternahm er einen Versuch, ein weiteres Studium an der Universität München zu beginnen. Im Brief an den Universitätsdekan, in dem er um die Immatrikulations- und Promotionserlaubnis bat, bediente er sich der obligatorischen Ausdrucksweise mit Redewendungen wie „ich bin arischer Abstammung“ und dem Gruß „Heil Hitler“, unterstrich aber zugleich sein Distanz zur Politik.38
Ein paar Monate später, im September 1939, wurde ihm die Einsetzung an der Front als Wehrmachtsseelsorger verweigert.39 Die Teilnahme am Krieg, der mit dem Angriff auf Polen am 1. September 1939 begann, verstand Delp als seine Bürgerpflicht: „[D]ie Anliegen und Sorgen meines Volkes [sind mir] immer eine ernste Pflicht.“40 Letztendlich sind sie ihm gar mehr als eine Pflicht, sind vielmehr eine Leidenschaft: Delp träumte von einem Einsatz im Krieg. Angesicht des in Polen begonnenen totalen Kriegs Hitlers klingen seine pathetischen Worte abstoßend, wenn er zu einem Freund an der Front schreibt:
Eigentlich beneide ich Dich; denn bei Euch an der Front wächst doch die kommende Generation, die das Schicksal meistern und wenden wird. Die den Krieg, auch diesen Krieg in seiner eigenartigen Gestalt, meistern und physisch und psychisch überdauern, vor denen wollen wir uns neigen und ihr Wort erst nehmen, weil es aus einem bewährten Leben gesprochen wird41.
Delp, der übrigens in diesem Jahr über „die Friedenskomödie von Versailles“42 schreibt, scheint den Krieg dadurch zu legitimieren und versteht sich zunächst als Deutschen und erst dann als Christ. Sein Kampfeswille gegen das ja überwiegend katholische Polen zeigt eine Übernahme der herrschenden Überzeugung; die allgemeine Meinung der deutschen Bischöfe lautete, dass „in dieser entscheidungsvollen Stunde“ die katholischen Soldaten „in Gehorsam gegen den Führer, opferwillig, unter Hingabe ihrer ganzen Persönlichkeit ihre Pflicht“ tun sollten.43 Sie interpretierten den Krieg durchaus nicht unähnlich der Erklärung Hitlers, und zwar durch die Kategorie religiöser Hingabe. Eine Teilnahme am Krieg wurde fast in den Rang des christlichen Martyriums erhoben.44
Der äußerst fragwürdige, 1940 in den Stimmen der Zeit geschriebene Artikel Der Krieg als geistige Leistung45, weist darauf hin, dass Delp – das zukünftige Opfer der Nationalsozialisten – die Situation noch mit den verkehrten „theologischen“ Kategorien dachte. Der Krieg als geistige Leistung war ein unkritischer Versuch der Versöhnung von Tatsachen, die nicht versöhnt werden konnten. Mit zwar guten Absichten manövrierte Delp zwischen den Problemen – der Pflicht zu Gott, zum Vaterland und zum Menschen selbst – und versuchte noch den alten Bund der Kirche mit dem Staat zu retten. Aus der Lektüre des Artikels konnte der Leser nur den praktischen Schluss ziehen, er müsse der Macht des kriegführenden Staates gegenüber gehorsam bleiben.46 Im Vergleich mit der wahnsinnigen, ja tierischen Ekstase, mit welcher Ernst Jünger in seinem erfolgreichen Buch Der Kampf als inneres Erlebnis den Krieg beschrieb,47 war Delp zwar weitaus zurückhaltender und vorsichtiger; er missbilligt den „sinnlosen Waffenlärm und [die] brutalen Toten“48; Distanz zeigt er aber auch dem Evangelium gegenüber, das die von ihm vorgeschlagene Idee eines geistigen Meisterns des Krieges nirgendwo erwähnt.49 Um auch dem Krieg „keinen falschen Glanz und keine falsche Würde“50 zu geben, musste Delp ihn erst in seiner Realität erfahren, musste Todesanzeigen lesen, Wunden sehen51 und durch Trümmer gehen52.
Neben „Krieg“ wollte Delp auch andere Begriffe, die schon fest zum Vokabular der Nationalsozialisten gehörten, wie etwa „Volk“ oder „Heimat“, mit christlichem Inhalt prägen. Mit dieser Absicht verfasste er zwei andere Texte: Heimat und Das Volk als Ordnungswirklichkeit. In diesen wird seine Distanzierung von der nationalsozialistischen Ideologie schon etwas deutlicher.53 Den Begriff der Heimat bezieht er letztendlich auf Gott54 und er betont eindeutig die Freiheit jedes Volkes, die von keiner staatlichen Ordnung und von keinem anderen Volk verletzt werden darf.55
Dass sich der Jesuit nun zwischen Mitläufertum und Gegnerschaft befand, konstatierte auch der Chef der Gestapo in München:
Eine offene gegnerische Haltung dem Nationalsozialismus gegenüber konnte bisher nicht festgestellt werden … Ein positiver Einsatz Delps für den Nationalsozialismus kann nie erwartet werden.56
Eine wichtige Rolle spielte dabei Delps Überzeugung,
die gleichzeitige Bindung in die Ordnung von Staat und Kirche [sei] für den Christen eine naturhafte Notwendigkeit.57
Es musste einige Zeit vergehen, damit Delp darüber Klarheit erlangen konnte, dass die Stellung gegenüber dem Nationalsozialismus eine Entweder-oder-Wahl war. Im April 1941 beschlagnahmte die Gestapo das Redaktionsgebäude von Stimmen der Zeit,58 zwei Monate später wurde Delps Antrag auf Aufnahme in die Reichschrifttumskammer abgelehnt. Das bedeutete das Aus für seine Tätigkeit als Schriftsteller im Dritten Reich. Der Jesuit war aber noch in der Lage, seinen Text Der Mensch und die Geschichte, in dem es keinen Raum mehr für irgendein „Meistern“ der nationalsozialistischen Wirklichkeit gibt, 1943 in Colmar zu veröffentlichen.59 Andere Texte, etwa Das Rätsel der Geschichte, Die Welt als Lebensraum des Menschen und Der Mensch vor sich selbst, wurden erst nach dem Krieg aus seinem Nachlass veröffentlicht.60
Nach dem Verlust der legalen Publikationsmöglichkeiten lenkte Delp seine ganze Energie auf das gesprochene Wort, das für den totalitären Staat nicht so angreifbar war wie das geschriebene. Im Predigen und Vortragen fand er einen Tätigkeitsraum, in dem er sich relativ frei aussprechen konnte.61 Auffällig ist die philosophische Intensität seiner Reden, die einen parallelen Inhalt zu Büchern aufweisen, die er damals las, schrieb und noch schreiben wollte.62 Als Prediger hatte Delp schon einige Erfahrungen gesammelt. Während des Theologiestudiums hatte er 1935 in der Zeitschrift Chrysologus eine Reihe von Predigten für die „Katholische Aktion des Mannes“ publiziert, in welchen er sich mit dem modernen Weltverständnis auseinandersetzte.63 Ein Jahr später veröffentlichte er die schon erwähnte Auseinandersetzung mit der Ideologie der Deutschen Glaubensbewegung.
Im Frühjahr 1941 begann Delp eine Tätigkeit in der überdiözesanen Hauptarbeitsstelle für „Männerarbeit und Männerseelsorge“ in Fulda, die ihm Gelegenheit zu zahlreichen Vorträgen gab.64 Seit Juni 1941 übte er die Funktion des Kirchenrektors in St. Georgen in München-Bogenhausen aus. Seine Beurteilung der gesellschaftlich-politischen Wirklichkeit wurde immer eindeutiger – er sprach über die Zerstörung des abendländischen Menschen,65 über die Nacht, in die das ganze Volk und mit ihm der ganze Kontinent ging66 sowie über eine allgemeine Grausamkeit des Lebens67. Die Verantwortung für jene Heimsuchung lastete Delp nicht Gott an; vielmehr wurde ihm immer klarer, dass
die Grausamkeit, die heute die Erde schlägt, zunächst in [den menschlichen] Herzen zu Hause war und von da her den ganzen Kosmos ergriff68.
Seine philosophischen Überzeugungen ließen ihn nicht in der reinen Immanenz der Welt untergehen: Er fragte über den Mensch und das Materielle hinaus und suchte nach dem Transzendenten. Aus seiner theologischen Perspektive heraus gab es keinen Platz für einen anderen Herrn als den Gott der Offenbarung. Als das schlechthinnige Symbol des nationalsozialistischen Deutschlands konnten für Delp die marschierenden Kolonnen der Menschen gelten, die auf ihre Freiheit zugunsten des Kollektivs verzichteten. Dem Befehl „Im Gleichschritt, marsch!“ wird sich Delp aber nie unterordnen.
(2) Mitgliedschaft im Kreisauer Kreis (1942-1944)
Ein herausragendes Kapitel in Delps Leben stellt die 1942 begonnene Beteiligung im Kreisauer Kreis dar.69 Diese Widerstandsgruppe wurde von Helmuth James von Moltke (1907-1945) und Peter Graf Yorck von Wartenburg (1904-1944) gegründet. Die auf Moltkes niederschlesischem Gut Kreisau stattfindenden Tagungen bearbeiteten ein Programm zur „Neuordnung Deutschlands“, das nach dem Fall Hitlers verwirklicht werden sollte. Als Wertbasis für die Erneuerung der Gesellschaft war das Christentum bestimmt worden. In der Mitte des Kreisauer Kreises entstand das Bedürfnis nach Freiheit, nach der „Brechung des totalitären Zugriffs auf die freie Gewissensentscheidung“.70
Obwohl die eigentliche Wirkung der Gruppe im Widerstand gegen Hitler ganz gering war, wie Moltke selbst zugab,71 erwies sich der Geist, dem das Denken der Mitglieder des Kreisauer Kreises entspringt, als für das Dritte Reich durchaus gefährlich. Darüber schrieb Moltke während des Prozesses vor dem Volksgericht, was zugleich auf die Person Delps und seine Rolle im Kreisauer Kreis ein Licht wirft:
Durch diese Personalzusammenstellung ist dokumentiert, daß nicht Pläne, nicht Vorbereitungen, sondern der Geist als solcher verfolgt werden soll.72
Die Ebene des Geistes war denn auch das Schlachtfeld, auf das Delp sich bewusst begab – die Erziehung des freien Geistes, so Moltke, als Antwort auf
den Geist der Enge und Gewalt gegen den Geist der Überheblichkeit, der Intoleranz und des Absoluten, erbarmungslos Konsequenten … der in den Deutschen steckt, und der seinen Ausdruck in dem nationalsozialistischen Staat gefunden hat73.
In der Widerstandsbewegung war Delp für die soziale Frage mit zuständig. Von drei Gesprächen in Kreisau nahm er an dem zweiten (im Oktober 1942) und dritten (im Juni 1943) teil. Seine Bedeutung für die Gruppe bezeugte Moltke selbst im schon zitierten, letzten Brief an seine Frau Freya: „Wir haben nur gedacht, und zwar eigentlich nur Delp, Gerstenmaier & ich, die anderen galten als Mitläufer.“74 Delps Grundhaltung im Kreisauer Kreis bestand in einem entschiedenen „Nein“ zum Nationalsozialismus, das er nach einem langen Weg der Absetzung nun endlich aussprach. Es war sein „Ja“ für die Option der Freiheit in all ihren Dimensionen, nicht nur in einer spirituellen, sondern auch in politischer Hinsicht. Doch war es umso schwerer auszusprechen, da es ein Widerstand ohne – wenn nicht sogar gegen – das Volk war.75 Damals stand Delp aber noch nicht am Ende seines Wegs zur Freiheit; paradoxerweise wird dieses Ende erst in der persönlichen Erfahrung der Gefangenschaft von ihm erreicht.
c) … mit dem Schicksal der Gefangenschaft und des bevorstehenden Todes (1944-1945)
Nach dem erfolglosen Attentat Stauffenbergs auf Hitler am 20. Juli 1944 wurde auch Delp am 28. Juli durch die Gestapo verhaftet, da sein Name in den Notizen des durch den Staatsstreich kompromittierten Grafen Yorck entdeckt wurde.76 Im August 1944 wurde Delp nach Berlin gebracht, dort zuerst im Gestapo-Gefängnis Berlin-Moabit inhaftiert und anschließend im September in die Haftanstalt Berlin-Tegel eingesperrt. Dem Angebot, aus dem Jesuitenorden auszutreten und dadurch freizukommen, erteilte Delp eine Absage; am 8. Dezember legte er in der Zelle das Ordensgelübde ab.77 Nach einem zweitägigen „Prozess“ vor dem Volksgerichtshof wurde er am 11. Januar 1945 wegen „Hoch- und Landesverrates“ zum Tod verurteilt. Am 2. Februar 1945 wurde er im Gefängnis Berlin-Plötzensee hingerichtet.78
Hinter diesen wenigen Daten stehen intensive Erfahrungen eines sich des eigenen nahenden Endes immer bewusster werdenden Menschen. Die Phasen der Ruhe und der Angst, der Sicherheit und des Zweifels, durch die Delp ging, fanden ein Echo in seinen Gefängnisschriften. Die Texte enthalten zwar keine radikalen Neuheiten – Delp selbst betonte, er bleibe bei den alten Thesen79 –, sie stellen aber das ganze bisherige Denkwerk Delps in den Horizont eines Freiheitsdenkens. Die Grundbegriffe seines Denkens, wie etwa Gottesunfähigkeit, Blick auf das Ganze, Rückkehr zur Mitte, Bewegung „über sich selbst hinaus“ und Hingabe, wurden von dem gefangenen Jesuiten auf das Freiheitsereignis hin bezogen. Der existenzielle Kontext jener Reflexion ist evident, Delp schrieb über sich selbst, zu sich selbst und nicht nur für Andere.80 Sichtbar ist eine Verschiebung des Schwerpunktes seines Freiheitsverständnisses: weg von einem akademisch verfassten und eng an die philosophische Reflexion geknüpften Begriff von Freiheit, hin zu einem beinahe mystischen Freiheitsdenken. Sein an außergewöhnliche Bedingungen geknüpftes Freiheitsverständnis hält Delp zugleich für unbedingt realistisch und für die Alltäglichkeit geeignet. Die ganze den Menschen ergreifende, oft als Fessel erlebte Wirklichkeit könne zu einem Raum der Freiheit werden – in diesem Sinn versteht Delp die Wirklichkeit als ein „Sakrament der Freiheit“.81
(1) Inneres Reifen
Die Gefangenschaft erlebte Delp als eine Zeit des inneren Wachsens, was vor allem in einer Verbindung mit der Ablegung der Profess zu sehen ist.82 Auf die Tatsache eigenen Reifens macht er in Briefen aufmerksam, indem er etwa erklärt: „Ich habe in diesen Wochen für Jahre gelernt und nachgelernt.“83 Die Welt erschien ihm nunmehr ohne Vortäuschungen: „Die Kulissen sind weg, und der Mensch steht heute unmittelbar vor den letzten Wirklichkeiten“84. Die Gefängnisschriften zeugen nicht so sehr von einer Weiterentwicklung der inzwischen ausgearbeiteten Theorien, sondern vielmehr von dem Weg, der einmal von Theorien ausgegangen war und nunmehr in die Praxis mündete – dies gerade auch in Hinsicht auf die Freiheit:
Vieles, was früher Fläche war, erhebt sich in die dritte Dimension. Die Dinge zeigen sich einfacher und doch figürlicher, kantiger. Vor allem aber ist der Herrgott so viel wirklicher geworden. Vieles, was ich früher gemeint habe zu wissen und zu glauben, das glaube und lebe ich jetzt.85
Delp schärfte seinen Blick auf die Wirklichkeit einerseits durch den Bezug auf den Glauben,86 andererseits durch die Auseinandersetzung mit dem System des Nationalsozialismus. Nach der Prozessfarce stellte er fest, dass der Nationalsozialismus sich als von sich selbst berauschte Macht und Herrlichkeit nun voll offenbare.87 Eine Beschreibung der nationalsozialistischen Epoche nahm er jetzt ganz ungeschminkt vor:
Die Zeit ohne Erbarmen. Die Zeit der unerbittlichen Schicksale. Die Zeit der Grausamkeit und Willkür. Die Zeit der sinnlosen Tode und der wertlosen Leben … Nie wieder sollen die Menschen sich so über ihre Möglichkeiten täuschen und sich solches tun.88
Der am 9. und 10. Januar 1945 vor dem Volksgerichtshof stattfindende „Prozess“ war für Delp der letzte und zugleich größte Zusammenstoß jener zwei so verschiedenen Kräfte, die jedoch eine gemeinsame Eigenschaft haben, wie Moltke in Abwandlung eines Wortes des Präsidenten des Volksgerichtshofs Freisler sagt: sowohl das Christentum als auch der Nationalsozialismus, „fordern den ganzen Menschen“89. Der sorgfältig auf seine Verteidigung vorbereitete Jesuit musste konstatieren, dass jede objektive Diskussion ausgeschlossen war:
Der Prozeß war eine große Farce. Sachlich wurden die Hauptanklagen: Beziehung zum 20. 7. und Stauffenberg gar nicht erhoben … Es war eine große Beschimpfung der Kirche und des Ordens. Ein Jesuit ist und bleibt eben ein Schuft. Das alles war Rache für den abwesenden Rösch und den Nicht-Austritt.90
Diese Tage erlebte Delp in der inneren Ruhe, obwohl er keinen Ausweg aus seiner Situation sah. Er notierte: Gott will „den absoluten Sprung von mir weg in ihn hinein“91. Er akzeptierte und verstand es als eine neue Etappe seines Wachsens:
Denn jetzt bin ich ja erst Mensch geworden, innerlich frei und viel echter und wahrhafter, wirklicher als früher. Jetzt erst hat das Auge den plastischen Blick für alle Dimensionen und die Gesundheit für alle Perspektiven.92
Vielmals wiederholte er, das Leben habe ein gutes Thema bekommen.93 Er fühlte sich zur inneren Freiheit erzogen, deshalb antwortete er dem nach seiner Tätigkeit fragenden Freisler: „Ich kann predigen, so viel ich will, und Menschen geschickt oder ungeschickt behandeln und wiederaufrichten, solange ich will.“94
(2) Zweifel
Die Texte der Verteidigung Delps vor dem Tribunal und ein Entwurf seines Gnadengesuchs liegen vor. Der Jesuit wollte sich dabei keinesfalls als ein entschiedener Widerstandskämpfer darstellen. Nach der Lektüre seiner Verteidigungsschriften drängt sich die Meinung auf, dass er – entgegen dem eigenen Willen – in die große Geschichte verwickelt wurde.95 Ein noch trüberes Bild findet sich im Gnadengesuchsentwurf, bei welchem aber ungewiss ist, ob es überhaupt abgeschickt wurde.96 Dass Delp jene Worte mit einer großen inneren Distanz schrieb, bezeugen sein Briefe: Diese Texte waren eine strategische Positionierung eines 37-jährigen Mannes, der in „die äußerste Situation gekommen [ist], in die Menschen kommen können“97, und der nicht sterben wollte: „Ich würde gern noch weiterleben.“98 Nicht die Verteidigung und das Gnadengesuch, sondern eine kurze, wenige Tage vor dem „Prozess“ verfasste Notiz drückt die tatsächliche Meinung Delps aus: „Die Gestalt des Leonardo da Vinci hat mich gestern mehr interessiert als meine Anklage.“99 Den bestimmenden Horizont für die Lektüre aller seiner Worte liefert letztendlich seine Entscheidung, dass er bewusst auf die Zugehörigkeit zu dem Orden nicht verzichtet, sondern vielmehr um den Preis des Lebens für sie einsteht.100
Delp wollte unbedingt den gesunden, freien Blick auf die Wirklichkeit behalten und Realist bleiben.101 Extrem niedergedrückt durch das Bewusstsein des kommenden Todes kämpfte er um eine realistische Perspektive auf das Leben. Er erklärt:
Ich habe in diesen letzten Tagen gezweifelt und überlegt, ob ich Selbsttäuschungen zum Opfer gefallen bin, ob sich mein Lebenswille in religiöse Einbildungen sublimiert hat oder was das war. Aber diese vielen spürbaren Erhebungen in mitten im Unglück; diese Sicherheit und Unberührtheit in allen Schlägen; dieser gewisse „Trotz“, der mich immer wissen ließ, es wird ihnen die Vernichtung nicht gelingen; diese Tröstungen beim Gebet und beim Opfer; diese Gnadenstunden vor dem Tabernakel; diese erbetenen und immer wieder gegebenen und gewährten Zeichen: ich weiß es nicht, ob ich das alles jetzt wegtun darf. Soll ich weiter hoffen? Will der Herrgott das Opfer, das ich ihm nicht versagen will oder will er die Bewährung des Glaubens und Vertrauens bis zum äußersten Punkt der Möglichkeit? … Was will der Herrgott mit alledem? Ist es Erziehung zur ganzen Freiheit und vollen Hingabe? … Was soll ich jetzt tun, ohne untreu zu werden? … Soll ich einfach in der Freiheit zur Verfügung bleiben und in der Bereitschaft? … Es ist Zeit der Aussaat, nicht der Ernte.102
Doch die Erfahrung der Unfreiheit erwies sich als besonders mächtig – so schrieb Delp von seinen „gefesselten Händen des Körpers und des Geistes“103.
(3) Sicherheit
Das letzte Wort gehörte der Freiheit. Nach den Tagen der Fragen kam die Überzeugung bezüglich der erziehenden Rolle der Geschichte zurück104 und damit die Gewissheit eines Wertes des eigenen Lebens und Sterbens.105 Delp verstand seine Existenz in Bezug auf die Freiheit Gottes106 und deshalb als eine freie Existenz: