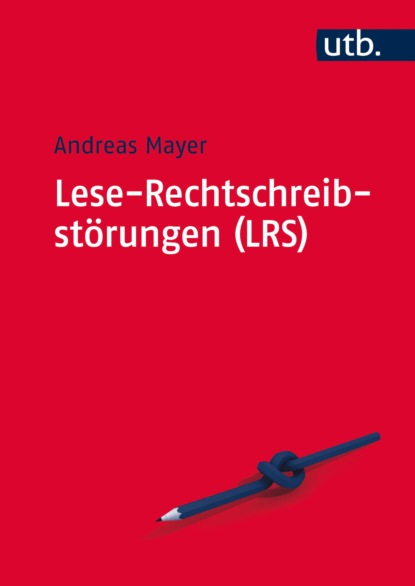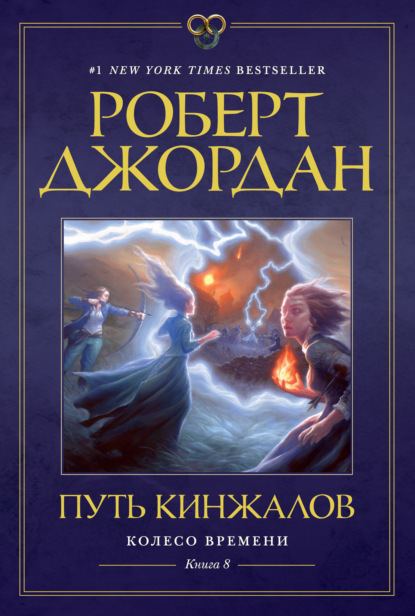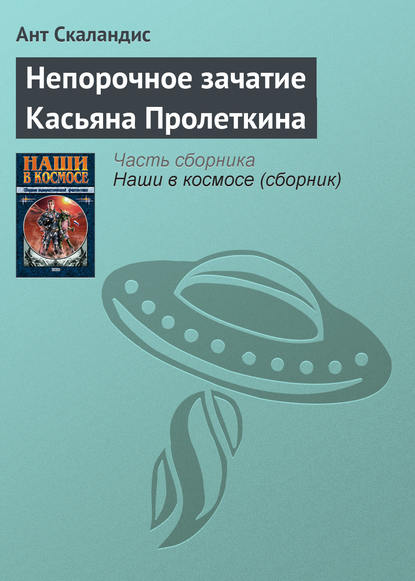- -
- 100%
- +
Der Wechsel zur orthographischen Phase findet deshalb zunächst auf der Seite der Rezeption statt, wenn das mühevolle, langsame phonologische Rekodieren zugunsten der direkten Worterkennung abgebaut wird.
2.4.4 Orthographische Phase
ganzheitliche Verarbeitung größerer schriftsprachlicher Einheiten
Der Kern dieser Strategie besteht darin, dass es Kindern durch zunehmende Leseerfahrung und / oder systematische Instruktion im Rahmen des schriftsprachlichen Anfangsunterrichts gelingt, sukzessive größere schriftsprachliche Einheiten (Silben, Morpheme) ganzheitlich simultan zu verarbeiten und mit der entsprechenden Phonologie zu verknüpfen, sodass es nicht mehr auf die Analyse und Synthese einzelner Buchstaben bzw. Laute angewiesen ist.
Wenn die orthographische Strategie auch zunächst auf der Seite der Rezeption zu beobachten ist und keinesfalls ausschließlich mit dem Erwerb der korrekten Orthographie gleichgesetzt werden kann, ist die Anwendung dieser Strategie beim Aufbau wortspezifischen orthographischen Wissens natürlich unverzichtbar (Günther 1986).
Aufgrund der Tatsache, dass die Graphem-Phonem-Korrespondenzen beim Lesen eindeutiger sind als die Phonem-Graphem-Korrespondenzen beim Schreiben (Kap. 1.2.1), stellt das Erlernen der korrekten Orthographie meist einen wesentlich längeren Entwicklungsprozess dar als die Automatisierung des Leseprozesses.
Erwerb der orthographischen Strategie als entscheidende Hürde
Der Erwerb der orthographischen Strategie und damit die Automatisierung des Lese- und Schreibprozesses stellen den entscheidenden Schritt auf dem Weg zum kompetenten Leser und Schreiber dar. Während das Erlernen der indirekten Lese- und Schreibstrategie aufgrund des einzellautorientierten schriftsprachlichen Anfangsunterrichts verbunden mit der relativ hohen Transparenz der Orthographie auch leseschwachen Schülern im deutschsprachigen Raum vergleichsweise geringe Schwierigkeiten bereitet, sind Probleme beim Erwerb der orthographischen Strategie das zentrale Charakteristikum lese-rechtschreibschwacher Kinder.
2.4.5 Integrativ-automatisierte Phase
Die von Günther (1986) als integrativ-automatisierte bezeichnete Phase stellt keine neue Strategie im Rahmen des Schriftspracherwerbs dar, sondern soll ausdrücken, dass die Automatisierung schriftsprachlicher Fähigkeiten einen längeren Zeitraum in Anspruch nimmt, bis das Niveau eines kompetenten Lesers und Schreibers und damit die „automatisierte und konsolidierte Integration aller beteiligten Verarbeitungsprozesse“ (Klicpera et al. 2013, 34) tatsächlich erreicht ist.

Literaturempfehlung zur Entwicklung schriftsprachlicher Fähigkeit
Mayer (2013a): Gezielte Förderung bei Lese-Rechtschreibschwierigkeiten. Ernst Reinhardt Verlag, München, Kapitel 2
Zusammenfassung
Das Erlernen der indirekten Lesestrategie des phonologischen Rekodierens auf der Grundlage der GPK-R stellt einen ersten Schritt auf dem Weg zum kompetenten Leser dar. Dennoch darf sich der schriftsprachliche Anfangsunterricht nicht auf die Vermittlung dieser Fähigkeit reduzieren. Um die Lesefähigkeit sukzessive zu automatisieren, benötigen insbesondere leseschwache Kinder eine systematische Förderung im Bereich der direkten Worterkennung, also Unterstützungsangebote, die ihnen den Übergang von der alphabetischen Phase zur orthographischen Phase ermöglichen.
Dem konnektionistischen Modell der Worterkennung folgend sind dafür Assoziationen zwischen orthographischen und phonologischen Einheiten von zentraler Bedeutung. Nachdem die Kinder die wesentlichen GPK-R erlernt haben, verfolgt ein effektiver Erstleseunterricht deshalb das Ziel, die Kinder dabei zu unterstützen, Verknüpfungen zwischen kontinuierlich größer werdenden schriftsprachlichen Einheiten und deren Phonologie auszubilden. Das Angebot entsprechender Unterstützungsmaßnahmen hat primär dann seine Berechtigung, wenn es Kindern gelungen ist, die alphabetische Strategie anzuwenden.
Auch wenn Beeinträchtigungen im Bereich der Worterkennung das zentrale Symptom der Lese-Rechtschreibstörung darstellen (Lyon et al. 2003; Kap. 4), macht das Modell des Simple View of Reading deutlich, dass neben spezifisch schriftsprachlichen Kompetenzen im Bereich der Worterkennung semantische, grammatische und pragmatische Fähigkeiten einen wesentlichen Beitrag zur sinnentnehmenden Verarbeitung von Texten leisten. Aus diesem Grund muss eine einzelfallorientierte Diagnostik ergeben, ob eine Förderung / Therapie des Sprachverständnisses notwendig ist, um das Leseverständnis positiv zu beeinflussen.
3 Definition der Lese-Rechtschreibstörung
Lernziele



Auf der Grundlage der internationalen Klassifikationssysteme der ICD 10 (Dilling et al. 2011) der Weltgesundheitsorganisation (WHO), den Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie (2007; Warnke 1993) sowie den Publikationen von Lyon et al. (2003) und Tunmer / Greaney (2010) wird diesem Buch folgende Definition der Lese-Rechtschreibstörung zugrunde gelegt.

Unter der Lese-Rechtschreibstörung wird eine Lernstörung verstanden, die sich durch Probleme beim Erwerb und der Anwendung der indirekten Lesestrate- gie (= phonologisches Rekodieren) und / oder der automatisierten Worterkennung sowie beeinträchtigter Rechtschreibung charakterisieren lässt. Sie kann aus Defiziten in der phonologischen Informationsverarbeitung infolge neurobio- logischer Fehlentwicklungen resultieren und geht oft mit Spracherwerbsstörungen einher. Die Lernstörung tritt unabhängig von kognitiven Fähigkeiten auf und ist nicht die Folge unangemessenen Unterrichts. Sie kann sich negativ auf das Lese- verständnis, die kognitive, die sprachliche sowie die sozio-emotionale Entwicklung auswirken.
Die Begriffe Lese-Rechtschreibstörung, Legasthenie, besondere Schwierigkeiten im Erlernen des Lesens und Rechtschreibens (Beschluss der KMK-Konferenz 2007), Lese-Rechtschreibschwierigkeiten, (Entwicklungs-)Dyslexie und Schriftspracherwerbsstörungen werden in diesem Lehrbuch synonym verwendet.
Schriftspracherwerbsstörungen
Insbesondere der zuletzt genannte Begriff soll deutlich machen, dass es sich beim Lesen- und Schreibenlernen um eine Entwicklungsaufgabe handelt, die in die gesamte sprachlich-kognitive Entwicklung des Kindes eingebettet ist und insbesondere in engem Zusammenhang mit (meta-)sprachlichen Kompetenzen steht. Die Verwendung dieser Terminologie impliziert zudem, dass Schrift ein System darstellt, mit dem Sprache visuell abgebildet wird, weshalb Kinder mit sprachlichen Beeinträchtigungen eine besondere Risikogruppe darstellen, im Laufe der Grundschulzeit Schriftspracherwerbsprobleme zu entwickeln.
Lese-Rechtschreibstörung – eine Lernstörung

„Unter der Lese-Rechtschreibstörung wird eine Lernstörung verstanden …“
spezifische vs. allgemeine Lernstörung
Für das Störungsbild wurde in der Definition bewusst die Formulierung „Lernstörung“, nicht aber „spezifische Lernstörung“ gewählt. Mit dem vorangestellten Adjektiv, das üblicherweise auch in der englischsprachigen Literatur Verwendung findet (Specific Reading Disability), um die Störung von einer allgemeinen Lese-Rechtschreibschwäche (Garden Variety Poor Reader) abzugrenzen, soll betont werden, dass es sich bei den Betroffenen um Kinder mit mindestens durchschnittlichen kognitiven Fähigkeiten handelt, die sich außer beim Lesen und Schreiben unauffällig entwickeln und nicht durch weitere schulische Lernschwierigkeiten auffallen. Dass diese Aussage zu pauschal ist, konnte bereits die Legasthenieforschung in den 1970er Jahren deutlich machen. So machten Untersuchungen mit Kindern mit Lese-Rechtschreibstörungen deutlich, dass diese durchaus nicht in allen Teilbereichen der Intelligenz unauffällige Leistungen erbringen, sondern insbesondere in Subtests mit hohen sprachlichen Anforderungen oftmals im unterdurchschnittlichen Bereich abschneiden (Valtin 1973; Angermaier 1974). Da schriftsprachliche Fähigkeiten spätestens ab der dritten Klasse in allen Unterrichtsfächern eine zentrale Rolle spielen, ist zudem zu erwarten, dass sich eine Lese-Rechtschreibproblematik negativ auf die Leistungen in anderen Unterrichtsfächern auswirkt.
geringe praktische Relevanz des Diskrepanzkriteriums
Das zentrale Argument gegen die Trennung einer spezifischen Störung von einer allgemeinen Lese-Rechtschreibschwäche auf der Grundlage der Diskrepanz zwischen der Intelligenz und schriftsprachlichen Kompetenzen ist die implizite Annahme, dass es sich dabei um zwei Beeinträchtigungen mit unterschiedlichen Ätiologien handelt, die unterschiedlicher Förderung oder Therapie bedürfen. Dagegen betonen Hurford et al. (1994), dass Defizite im Bereich der phonologischen Informationsverarbeitung bei beiden Gruppen gleichermaßen zu identifizieren und kausal mit deren Schriftspracherwerbsproblematik assoziiert sind. Zum anderen seien phonologisch orientierte Fördermaßnahmen für beide postulierte Subgruppen gleichermaßen effektiv.
Auch Tunmer / Greaney (2010, 231) berichten von zahlreichen vergleichbaren Forschungsergebnissen und kommen zusammenfassend zu der Schlussfolgerung,
„[that there] is a considerable amount of research indicating that groups of poor readers formed on the basis of the presence or absence of IQ-achievement discre- pancies do not reliably differ in long-term prognosis, response to intervention, or the cognitive skills (e. g., phonemic awareness, phonological recoding) that underlie the development of word recognition.”
Forschungsergebnisse
Fletcher et al. (1994) verglichen 200 spezifisch und allgemein leseschwache Kinder hinsichtlich der Funktionen der phonologischen Informationsverarbeitung, der sprachlichen und der visuell-motorischen Leistungen. Die Ergebnisse zeigten, dass sich die beiden Gruppen hinsichtlich dieser Variablen nicht differenzieren ließen. Vergleichbar konnten Brandenburg et al. (2013) bei Kindern mit Lese- und / oder Rechtschreibstörungen spezifische Defizite im Bereich des Arbeitsgedächtnisses nachweisen, die bei Kindern mit durchschnittlichen und unterdurchschnittlichen kognitiven Fähigkeiten gleichermaßen ausgeprägt waren. Für den deutschsprachigen Raum stellen Klicpera / Gasteiger-Klicpera (1993, 165) fest, dass sich zwischen „diskrepanten und nicht-diskrepanten Lese-Rechtschreibschwierigkeiten“ kaum Unterschiede nachweisen lassen. Sie sind der Überzeugung, dass eine Differenzierung in zwei Subgruppen auf der Grundlage des Diskrepanzkriteriums zwar möglich, aber von keiner praktischen Relevanz ist (vgl. auch von Suchodoletz 2005).
Verzicht auf das IQ-Diskrepanzkriterium in der DSM-5
Folgerichtig verzichtet die DSM-5 bei der Diagnose der Dyslexie vollständig auf das IQ-Diskrepanzkriterium und konzentriert sich bei der Feststellung der Lernstörung auf die Symptomatik (u. a. Lesegenauigkeit, Lesegeschwindigkeit, Leseverständnis, Rechtschreibfehler), den zeitlichen Faktor (mindestens sechs Monate), die negativen Auswirkungen auf die schulische Leistungsfähigkeit und die Diskrepanz zwischen der tatsächlichen und der aufgrund des Alters bzw. der Klassenstufe erwarteten Leistung von mindestens einer Standardabweichung (Schulte-Körne 2014).
Auch die Deutsche Gesellschaft für Kinder und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie e. V. (2015) kommt in ihren Leitlinien zusammenfassend zu dem Ergebnis, dass sich zwischen Kindern und Jugendlichen, bei denen die Diagnose einer Lese-Rechtschreibstörung aufgrund einer Alters- oder Klassennormdiskrepanz gestellt wurde und Kindern und Jugendlichen, bei denen die Diagnose auf dem IQ-Diskrepanzkriterium basierte, keine eindeutigen Unterschiede feststellen lassen.
Die der Arbeit zugrunde gelegte Definition bezieht sich sowohl auf Kinder mit diskrepanten als auch mit nicht-diskrepanten Lese-Rechtschreibschwierigkeiten.
Dass die intellektuellen Fähigkeiten nicht hauptverantwortlich für die Ausbildung der Lernstörung sind, wird in der Definition auch durch die Formulierung „tritt unabhängig von den kognitiven Fähigkeiten auf“ deutlich gemacht.
Neurobiologische Ursachen

„… kann aus Defiziten in der phonologischen Informationsverarbeitung infolge neurobiologischer Fehlentwicklungen resultieren und geht oft mit Spracherwerbsstörungen einher.“
Was die Ursachen der Lese-Rechtschreibstörung angeht, herrscht dahingehend Einigkeit, dass diese im neurobiologischen Bereich anzusiedeln sind (Kap. 5). Sie führen auf sprachlich-kognitiver Ebene zu Schwierigkeiten im Bereich der phonologischen Informationsverarbeitung und über dieses Bindeglied zu den Symptomen einer Lese-Rechtschreibstörung.
ICD-10
Auch die ICD-10, die u. a. Lese-Rechtschreibstörungen im Bereich der umschriebenen Entwicklungsstörungen schulischer Fertigkeiten (F81) klassifiziert, geht davon aus, dass, „diese Störungen von Beeinträchtigungen der kognitiven Informationsverarbeitung herrühren, die großenteils auf einer biologischen Fehlfunktion beruhen“ (Dilling et al. 2011, 270).
Teilleistungsstörung
Vergleichbar definiert die Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie das Störungsbild als „eine an die Entwicklung der Hirnfunktion gebundene zentralnervös begründete Teilleistungsstörung“ (Warnke 1993, 1). Im Zusammenhang mit dem ersten Bestimmungsmerkmal sei darauf hingewiesen, dass die angenommenen neurobiologischen Abnormitäten nicht mit einer Intelligenzminderung gleichzusetzen sind. Warnke et al. (2002) veranschaulichen diese Aussage durch einen Vergleich mit der „Unmusikalität“ eines Menschen. Auch bei diesem Phänomen handele es sich um eine Besonderheit der zentralnervösen Informationsverarbeitung, ohne dass hier eine Intelligenzminderung angenommen wird. Bei den für die Lese-Rechtschreibstörung angenommenen neurobiologischen Veränderungen handelt es sich Tunmer / Greany (2010) zufolge um Fehlentwicklungen, die keinen allzu großen Einfluss auf andere kognitive Funktionen ausüben.
Symptomatik der Lese-Rechtschreibstörung

„… die sich durch Probleme beim Erwerb und der Anwendung der indirekten Lesestrategie (= phonologisches Rekodieren) und / oder der automatisierten Worterkennung sowie beeinträchtigter Rechtschreibung charakterisieren lässt.“
Symptomatik-Lesen
Vergleichbar den in der Definition genannten Symptomen charakterisieren Lyon et al. (2003, 2) die Dyslexie als „difficulties with accurate and / or fluent word recognition and by poor spelling and decoding abilities.” (vgl. auch Tunmer / Greany 2010).
In der ICD-10 wird die Symptomatik der Lese-Rechtschreibstörung folgendermaßen operationalisiert (Dilling et al. 2011, 275; vgl. auch Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie 2007):
„In den frühen Stadien des Erlernens einer alphabetischen Schrift kann es Schwierigkeiten geben, […], die Buchstaben korrekt zu benennen, einfache Wortreime zu bilden und bei der Analyse oder der Kategorisierung von Lauten […]. Später können dann Fehler beim Vorlesen auftreten, die sich zeigen als




Ebenso zeigen sich Defizite im Leseverständnis z. B.



Symptomatik Schreiben
Im Bereich der Rechtschreibung fallen betroffene Kinder im Anfangsunterricht v. a. durch Schwierigkeiten mit dem Erwerb des phonologischen Prinzips als Grundstrategie des Schreibens auf, während im Laufe der Grundschulzeit lautgetreue Schreibweisen, die aber von der korrekten Orthographie abweichen, zu den zentralen Charakteristika gehören. Von der ICD-10 wird hervorgehoben, dass die Schwierigkeiten mit der Rechtschreibung in der späteren Kindheit üblicherweise größer sind als die beim Lesen: „Mit Lesestörungen gehen häufig Rechtschreibstörungen einher. Diese persistieren oft bis in die Adoleszenz, auch wenn im Lesen einige Fortschritte gemacht werden“ (Dilling et al. 2011, 274).
Zwischen der ICD-10 und der dieser Arbeit zugrunde gelegten Definition fallen zwei wesentliche Unterschiede auf. Die ICD-10 zählt Schwierigkeiten mit dem Leseverständnis zu den Symptomen der Lese-Rechtschreibstörung, während diese im vorliegenden Buch als Konsequenz der Lese-Rechtschreibstörung interpretiert werden. Diese Annahme resultiert aus den empirisch belegten Hypothesen des Simple View of Reading (Kap. 2.3), welcher das Leseverständnis als Produkt aus Worterkennung und Hörverständnis betrachtet. Demnach sind Schwierigkeiten im Leseverständnis entweder das Resultat spezifisch schriftsprachlicher Defizite im Bereich der Worterkennung und / oder der Beeinträchtigungen in der semantischen bzw. grammatischen Verarbeitung von Sprache; es handelt sich aber nicht um ein originäres Symptom der Dyslexie.
Kernproblematik: automatisierte Worterkennung
Ferner wird in der vorliegenden Definition explizit auf Schwierigkeiten mit der automatisierten Worterkennung Bezug genommen, ein Aspekt der in den Aussagen der ICD-10 so nicht zu finden ist, auch wenn die Formulierung „niedrige Lesegeschwindigkeit“ als Hinweis auf diese Problematik zu interpretieren ist. Die explizite Betonung von Problemen mit der Automatisierung schriftsprachlicher Kompetenzen resultiert aus Forschungsergebnissen der 1990er und 2000er Jahre, die deutlich machen konnten, dass sich lese-rechtschreibschwache Kinder, die eine relativ transparente Schriftsprache erlernen, zwar zu Beginn ihrer Schullaufbahn durch Schwierigkeiten beim Erlernen der indirekten Lesestrategie charakterisieren lassen, diese Unsicherheiten aber relativ schnell überwinden können, sodass sie spätestens ab der dritten Klasse eine ähnlich hohe Lesegenauigkeit aufweisen wie durchschnittlich lesende Kinder. Das zentrale, häufig bis ins Jugendalter persistierende Problem sind Defizite im Bereich der Automatisierung des Leseprozesses, die neben einer verringerten Lesegeschwindigkeit auch durch eine mangelnde Prosodie beim lauten Lesen offensichtlich wird (Wimmer 1993a; Holopainen et al. 2001; Serrano / Defior 2008). Da in diesem Fall ein Großteil der Aufmerksamkeit auf die Lesetechnik gelenkt werden muss, führt dies zu den eben beschriebenen negativen Konsequenzen im Bereich des Leseverständnisses. Hinzu kommt, dass bei einer beeinträchtigten Lesegeschwindigkeit auch schnell die Gedächtniskapazitäten überlastet werden.
Die Frage, ab wann man von „Problemen“, „Defiziten“ oder einer „therapiebedürftigen Lernstörung“ sprechen kann, beantwortet die ICD-10 (Dilling et al. 2011) damit, dass die Lese-Rechtschreibleistung in einem normierten Test mindestens zwei Standardabweichungen unter dem Niveau liegen müsse, das aufgrund des chronologischen Alters und der allgemeinen Intelligenz zu erwarten wäre. Im Gegensatz dazu wird an dieser Stelle davon ausgegangen, dass eine Leistung von mehr als einer Standardabweichung unter dem Mittelwert in einem normierten, validen Test ein ausreichendes Kriterium für das Vorliegen einer Lese-Rechtschreibstörung ist.
Spezifische Spracherwerbsstörungen

„... geht oft mit Spracherwerbsstörungen einher.“
Komorbidität mit Spracherwerbsstörungen
Sowohl in der vorliegenden Definition als auch bei Lyon et al. (2003), der ICD-10 und der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie (2007) wird die häufig anzutreffende Komorbidität mit lautsprachlichen Defiziten betont.

Von Komorbidität spricht man, wenn zusätzlich zu einem Krankheits- oder Störungsbild weitere Krankheiten oder Störungen auftreten, die als Folge einer Grunderkrankung oder als diagnostisch abgrenzbares Symptom der Grunderkrankung interpretiert werden können. In Verbindung mit Lese-Rechtschreibstörungen bezieht sich die Aussage auf das gehäufte gemeinsame Auftreten lautsprachlicher und schriftsprachlicher Beeinträchtigungen.
Die im Zusammenhang mit Schriftspracherwerbsstörungen am intensivsten erforschte sprachliche Beeinträchtigung ist die Spezifische Spracherwerbsstörung (SSES).

Bei der spezifischen Spracherwerbsstörung (SSES) handelt es sich um eine komplexe Beeinträchtigung der Sprachverarbeitung und des Spracherwerbs, für die keine offensichtlichen Primärbeeinträchtigungen verantwortlich gemacht werden können (Kannengieser 2014).
Kinder mit SSES als Risikogruppe
Aufgrund der Schwierigkeiten betroffener Kinder mit der phonologischen Informationsverarbeitung (Kap. 5), daraus resultierenden phonologischen Repräsentationen geringer Qualität und häufig anzutreffenden Defiziten in der phonologischen Bewusstheit, entwickeln viele spracherwerbsgestörte Kinder Probleme beim Erlernen einer angemessenen Lesefertigkeit. Da ihre Schwierigkeiten in der Verarbeitung semantischer und grammatischer Strukturen fast zwangsläufig zu einem herabgesetzten Leseverständnis führen müssen (vgl. Simple View of Reading, Kap. 2.3), sind spracherwerbsgestörte Kinder beim Lesen- und Schreibenlernen doppelt benachteiligt, sodass anzunehmen ist, dass ein Großteil dieser Kinder im Laufe der Grundschulzeit massive Lese-Rechtschreibschwierigkeiten entwickelt.
Dies bestätigen Forschungsarbeiten aus dem angloamerikanischen Raum. So konnten Catts et al. (1999) zeigen, dass bei 70 % leseschwacher Kinder der zweiten Klasse bereits im Vorschulalter sprachliche Defizite offensichtlich waren. In der Untersuchung von Catts et al. (2002a) schnitten 53 % bzw. 48 % der im Vorschulalter als spracherwerbsgestört diagnostizierten Kinder bei Lese-Rechtschreibüberprüfungen in der zweiten bzw. vierten Klasse im unterdurchschnittlichen Bereich ab. Verglichen mit den Werten für sprachnormale Kinder liegt das Risiko spracherwerbsgestörter Kinder, Lese-Rechtschreibschwierigkeiten zu entwickeln etwa sechsmal so hoch wie bei sprachlich unauffälligen Kindern.