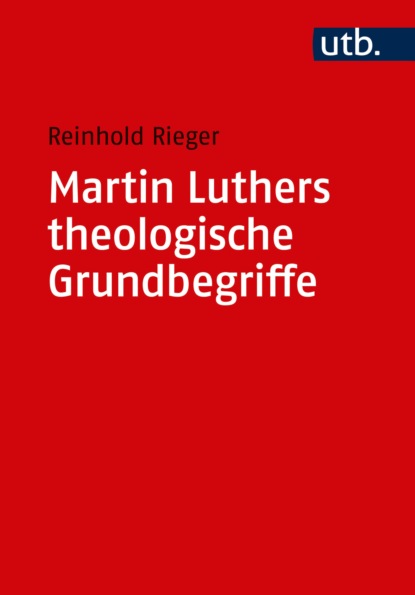- -
- 100%
- +
1. Wesen: Die Predigt von der Vergebung der Sünde durch den Namen Christi, das ist das Evangelium (2, 466, 12f.). Evangelium ist nämlich die gute Rede, die Botschaft des Friedens vom menschgewordenen Sohn Gottes, der gelitten hat und durch den heiligen Geist auferweckt wurde zu unserem Heil. Wo immer die Gnade Gottes und die Vergebung der Sünden, die durch Jesus Christus geschehen ist, gepredigt wird, dort wird wahrhaft das Evangelium gepredigt (2, 467, 12–23). Das Evangelium ist das Wort der Gnade, des Lebens und des Heils, das Wort der Gerechtigkeit und des Friedens, dem Gesetz gänzlich entgegengesetzt und dennoch zugleich mit ihm übereinstimmend. Denn im Evangelium wird das Gegenteil der Begierde offenbart, also die Liebe und Gnade des heiligen Geistes, durch die die Verdorbenheit der Natur geheilt wird und der Mensch lernt, Gutes zu tun. Das Evangelium ist das Wort der Gnade, in dem die Vergebung der Sünden gepredigt wird und wie wir das Gesetz erfüllen können, also dass der, der sich das Gesetz hassen sieht und das Bewusstsein von der Sünde hat, Jesus Christus als Erlöser hört und glaubt und anruft, durch welchen Glauben er es verdient, den heiligen Geist zu empfangen, durch den er das Gesetz liebt und die Sünde hasst und so vor Gott gerechtfertigt wird (7, 504, 6–11). Das Evangelium ist seiner eigentlichen Definition nach die Verheißung von Christus, die von den Schrecken des Gesetzes befreit, von Sünde und Tod, und die Gnade, Vergebung der Sünden, Gerechtigkeit und ewiges Leben herbeibringt (39I, 387, 2–4). Evangelium ist eigentlich nicht ein Buch der Gesetze und Gebote, das von uns fordert unser Tun, sondern ein Buch der göttlichen Verheißungen, darin er uns verheißt, anbietet und gibt alle seine Güter und Wohltaten in Christus. Dass aber Christus und die Apostel viele gute Lehre geben und das Gesetz auslegen, ist zu rechnen unter die Wohltaten wie ein anderes Werk Christi (10I.1, 13, 3–8). Nachdem das Wort des Gesetzes Jammer und Armut im Herzen zugerichtet hat, kommt das Wort des Evangeliums und verspricht, Gnade und Hilfe zu geben, damit wir aus solchem Jammer herauskommen sollen und alle Sünden nicht allein vergeben, sondern auch vertilgt und dazu Liebe und Lust zur Erfüllung des Gesetzes gegeben sein sollen (10I.2, 158, 6–13). Es gibt kein Buch in der Bibel, worin nicht Gesetz und Zusagung sind. Weil aber im Neuen Testament die Zusagungen gehäuft stehen, und im Alten die Gesetze gehäuft, nennt man das eine Evangelium, das andere Gesetzbuch (10I.2, 159, 5–19). Also sind die Bücher Mose und die Propheten auch Evangelium, zumal sie eben das zuvor verkündigt und beschrieben haben von Christus, was die Apostel hernach gepredigt oder geschrieben haben. Doch ist ein Unterschied zwischen beiden. Denn obwohl beides dem Buchstaben nach auf Papier geschrieben ist, so soll doch das Evangelium oder das neue Testament eigentlich |68|nicht geschrieben, sondern in die lebendige Stimme gefasst werden, die erschalle und überall gehört werde in der Welt. Denn das Evangelium ist eine lebendige Predigt von Christus, der gekommen ist (12, 275, 5–15; vgl. 259, 8–19). Das Evangelium soll nur im Gewissen regieren, das Gesetz aber die Hände. Nicht durch Gesetze sollen die Gewissen regiert werden, nicht die Hand durch das Evangelium. Das Evangelium gehört ins Herz und Gewissen, das Gesetz zu den Händen (24, 481, 7–15). Die Papisten halten Christus für einen neuen Gesetzgeber, und die Fanatiker nehmen nichts aus dem Evangelium an, wenn sie es nicht als ein Buch verstehen, das neue Gesetze von den Werken enthält. Das Evangelium ist aber die Predigt von Christus, der Sünde vergibt, Gnade gibt, rechtfertigt und die Sünder rettet. Wenn aber Gebote im Evangelium gefunden werden, sind sie nicht Evangelium, sondern Auslegungen des Gesetzes und Anhänge an das Evangelium (40I, 259, 30–260, 14; vgl. 14, 650, 22–25).
2. Inhalt: Das Evangelium ist nach Paulus Röm 1 die Predigt vom menschgewordenen Sohn Gottes, der für uns ohne unser Verdienst zum Heil und Frieden gegeben worden ist. Es ist das Wort des Heils, das Wort der Gnade, das Wort des Trostes, das Wort der Freude, die Stimme des Bräutigams und der Braut, das gute Wort, das Wort des Friedens. Das Gesetz aber ist das Wort der Verlorenheit, das Wort des Zorns, das Wort der Traurigkeit, das Wort des Schmerzes, die Stimme des Richters und des Klägers, das Wort der Unruhe, das Wort des Fluches (1, 616, 20–26). Das ganze Evangelium lehrt nicht mehr als Glauben an Gott und den Nächsten zu lieben (8, 15, 6f.). Das Hauptstück und der Grund des Evangeliums ist, dass man Christus, bevor man ihn als Vorbild erfasst, aufnimmt und erkennt als eine Gabe und Geschenk, das von Gott zueigen gegeben sei (10I.1, 11, 12–12, 2). Das Evangelium soll nichts anderes predigen noch verkündigen als allein die einzige Person Christus, auch Maria nicht, geschweige denn den Papst oder irgendein Werk, es sei so köstlich, wie es immer wolle (10I.2, 434, 1–11). Das Evangelium ist der Schlüssel, der das Alte Testament öffnet (20, 336, 26f.). Das Alte Testament wird durch das Evangelium ausgelegt (10I.1, 17, 7–11; vgl. 12, 556, 9–17). Wovon anderes handelt das ganze Evangelium, als dass es uns den Willen des Vaters erklärt und uns seiner Barmherzigkeit um Christi willen gewiss macht? (39I, 330, 7–9). Das ist die Summe des Evangeliums: Tut Buße, das Reich Gottes ist nahe (Mt 4, 17) (38, 456, 38f.).
3. Einheit: Es gibt nur ein Evangelium, das aber durch viele Apostel beschrieben wurde (10I.1, 9, 6–20; vgl. 12, 259). Wie nun nicht mehr als ein Christus ist, so ist und kann nicht mehr als ein Evangelium sein (10I.1, 10, 8f.). In den Briefen des Paulus ist das Evangelium klarer und lichter als bei den vier Evangelisten. Paulus schreibt nichts von dem Leben Christi, drückt aber klar aus, warum er gekommen sei und wie man ihn gebrauchen solle (10I.1, 47, 2–7).
4. Die Sache des Evangeliums besteht nicht im Wissen, sondern im Affekt (31II, 21, 22f.). Derjenige, der dem Evangelium glaubt, muss schwach und töricht werden vor den Menschen, damit er mächtig und weise sei in der Kraft und Weisheit Gottes (56, 171, 8–10). Obwohl das Evangelium in aller Welt aufgegangen ist, haben es allein die aufgenommen, die es durchs Licht des Glaubens verstehen (10I.2, 11, 8–10). Das Evangelium wird nicht durch Vernunft oder Empfindung, sondern allein durch den Glauben verstanden (10I.1, 217, 20–23).
5. Wirkung: Das Evangelium hat eine doppelte Aufgabe: die erste ist, das alte Gesetz zu deuten. Die zweite, eigentliche und wahre Aufgabe des Evangeliums ist, dem |69|verzweifelten Gewissen Hilfe und Heilung zu verkünden. Je mehr das Evangelium durch Interpretation des Gesetzes betrübt, desto mehr erfreut es durch die Verkündigung der Gnade. So erniedrigt es durch Deutung, damit es durch die Verkündigung der Gnade erhöhe, es schlägt, um zu heilen, tötet, um lebendig zu machen, führt in die Hölle, um herauszuführen (1, 105, 6–30; vgl. 113, 5–18; 11, 191, 33–192, 30). Das Evangelium demütigt und vernichtet sowohl vor Gott als auch vor den Menschen. Das ist die Kraft des Evangeliums, dass es vor Gott rechtfertigt und vor der Welt kreuzigt. Deshalb ist es das Wort des Heils und das Wort des Kreuzes, das Wort der Weisheit und das Wort der Torheit (5, 661, 10–22). Wir haben zwei Güter des Evangeliums gegen die beiden Übel des Gesetzes: die Gabe gegen die Sünde, die Gnade gegen den Zorn Gottes (8, 106, 35f.). Das Evangelium tut zwei Werke in uns: es erniedrigt die natürliche Vernunft und allen Ruhm der Werke, Güter und freien Willens (10I.1, 527, 11–23). Wie durch das Gesetz die Sünden überhand nehmen, so nimmt durch das Evangelium die Gerechtigkeit überhand. Das Evangelium gibt, was das Gesetz fordert (7, 504, 27f.). Es ist die Aufgabe des Gesetzes, Sünder, Verdammte, Angeklagte, Elende, Traurige, Verwirrte zu schaffen und das Gewissen mit den Sünden ganz zu belasten, dagegen ist es Aufgabe des Evangeliums, Gerechte, Gerettete, Selige, Freudige, Stille zu schaffen und das Gewissen ganz zu befrieden und zu erheben (7, 504, 40–505, 3). Das Evangelium lehrt, wie das Gesetz Gottes geistlich und unmöglich sei der Natur zu erfüllen, sondern der Geist Gottes müsse es durch den Glauben erfüllen in uns (10I.1, 670, 4–6). Also löst das Evangelium das Herz von allem Übel, von Sünden, von Tod, von Höllen und bösen Gewissen, durch den Glauben an Christus (10I.2, 53, 16–18). Das heilige Evangelium ist ein kräftiges Wort, darum kann es nicht zu seinem Werk kommen ohne Anfechtung, und niemand wird es gewahr, dass es eine solche Kraft hat, als wer es schmeckt. Wo Leiden und Kreuz ist, da kann es seine Kraft beweisen und üben (12, 381, 21–25). Das Evangelium erschuf die Kirche, nicht umgekehrt. Die Kirche macht nicht das Evangelium, sondern umgekehrt, und die Kirche nahm es an und glaubte es (29, 17, 1).
6. Gesetz und Evangelium: Evangelium und Gesetz unterscheiden sich eigentlich so, dass das Gesetz das predigt, was zu tun und zu unterlassen ist, ja sogar dass das Geschuldete und das zu Unterlassende oder Unmögliche geschehen und unterlassen werden soll (also dient es allein der Erkenntnis der Sünde), das Evangelium aber predigt die Vergebung der Sünden und die Erfüllung aller Gebote. Das Gesetz sagt: Tu, was von dir gefordert wird, das Evangelium aber: Deine Sünden sind dir vergeben (2, 466, 3–7). Das Evangelium ist real und formal Gericht und Gerechtigkeit, wenn es so durch die Tat gelebt wird, wie es uns lehrt. Es ist aber lehrhaft Gericht und Gerechtigkeit, wenn es so zu leben lehrt. Die aber das Evangelium erfüllen, sind nicht unter dem Gesetz. Denn nichts ist über ihnen, da sie es erfüllt haben und ihm schon entsprechen. Das Gesetz herrscht nicht mehr und ist nicht über ihnen, die es erfüllen (3, 463, 21–36). Das Gesetz wurde auf Tafeln geschrieben und war tote Schrift, eingeschlossen in die Grenzen der Tafel, also wenig wirksam. Aber das Evangelium wird der lebendigen und freien Stimme, die die Ohren erreicht, anvertraut, also hat es mehr Kraft zur Bekehrung. Daher hat Christus nichts geschrieben, sondern alles mündlich ausgesprochen (7, 526, 13–16). Es ist nicht möglich, dass der das Evangelium höre und sich lasse durch die Gnaden des Geistes lebendig machen, wer nicht will zuvor das Gesetz hören und sich durch den Buchstaben töten lassen, denn die Gnade wird |70|nicht gegeben als allein denen, welche nach ihr dürsten: das Leben hilft nur den Toten, die Gnade nur den Sünden, der Geist nur dem Buchstaben, und eines ohne das andere mag niemand haben (7, 656, 27–31). Wer richtig das Evangelium vom Gesetz zu unterscheiden weiß, der möge Gott danken und sich als Theologen wissen. Sie sind so zu unterscheiden, dass du das Evangelium in den Himmel setzt, das Gesetz auf die Erde, dass du die Gerechtigkeit des Evangeliums himmlisch und göttlich nennst, die des Gesetzes irdisch und menschlich, wie du umso sorgfältiger die Gerechtigkeit des Evangeliums von der Gerechtigkeit des Gesetzes unterscheidest, je sorgfältiger Gott den Himmel von der Erde unterscheidet (40I, 207, 17–23). Deshalb muss man wohl zu unterscheiden wissen, damit man nicht im Evangelium das Gesetz suchte, sondern dieses von jenem so sehr unterscheide, wie der Himmel von der Erde entfernt ist. Leicht könnte man sagen, dass das Evangelium nichts anderes sei als die Offenbarung des Sohnes Gottes, als die Erkenntnis Jesu Christi, dass es nicht die Offenbarung und Erkenntnis des Gesetzes sei, aber im Kampf des Gewissens und in der Praxis dies gewiss festzuhalten, ist auch für die Erfahrensten schwierig (40I, 141, 12–18).
7. Verderbnis/Missbrauch: Wenn man jetzt unseren Geistlichen das Evangelium vorhält, so leugnen sie nicht, dass es das Evangelium sei. Aber sie sagen, sie müssten es auslegen. Damit leugnen sie nicht das Evangelium, sondern nehmen ihm nur alle seine Kraft, und unter des Evangeliums Namen und Schein geben sie ihre eigenen Träume vor (10I.1, 668, 6–12). Es sind zweierlei Ärgernisse, die des Evangeliums Lehre zuschanden machen. Eine, die die Heiden ärgert damit, dass dadurch etliche wollen frei sein und sich wider weltliche Obrigkeit setzen, machen aus geistlicher Freiheit eine weltliche, darüber muss das Evangelium die Schmach leiden, als lehre es solches. Das andere Ärgernis ärgert die Christen unter sich selbst, da durch unzeitigen Gebrauch christlicher Freiheit die Schwachen im Glauben geärgert werden (17II, 181, 24–33).
📖 Albrecht Beutel, Hg., Luther Handbuch, 3. Aufl. 2017, passim. Bernhard Lohse, Evanglium in der Geschichte, 1988. Ders., Martin Luther, 3. Aufl. 1997, 164f.
[Zum Inhalt]
Ewigkeit
1. Ist das Wort vor allen Kreaturen gewesen und alle Kreatur durch dasselbe geworden und geschaffen (Joh 1,3), so muss es ein anderes Wesen sein als Kreatur, und ist es nicht geworden oder geschaffen wie die Kreatur, so muss es ewig sein und keinen Anfang haben; denn als alle Dinge anfingen, da war es schon zuvor da und lässt sich nicht in der Zeit begreifen, sondern schwebt über Zeit und Kreatur, ja Zeit und Kreatur werden und fangen dadurch an. Was nicht zeitlich ist, das muss ewig sein, und was keinen Anfang hat, kann nicht zeitlich sein, und was nicht Kreatur ist, muss Gott sein; denn außer Kreatur und Gott ist nichts (10I.1, 183, 1–12). Gott hat nicht angefangen zu sein, sondern er ist ewig. So folgt, dass das Wort auch ewig ist, weil es nicht angefangen hat am Anfang, sondern es war schon am Anfang (10I.1, 189, 4–7).
2. Der Glaube hängt außerhalb dieser Welt an Gott, Gottes Wort und seiner Barmherzigkeit und rechtfertigt den Menschen weder durch Werke noch irgendein weltliches Ding, sondern durch die ewige, unsichtbare Gnade Gottes. Darum ist er nicht Element dieser Welt, sondern die Fülle der ewigen Güter. Obwohl er auch zeitlich, |71|äußerlich wirkt, so weiß er doch von keinem weltlichen Ding. Denn er wirkt frei darin (10I.1, 350, 2–11).
3. Sollte nun Christus ein Herr sein, sollte seine Herrschaft nicht zeitlich noch leiblich sein, sondern er musste über das ganze Volk regieren, das vergangen, gegenwärtig und zukünftig war; darum musste er ein ewiger Herr sein, das kann gewiss nur geistlich zugehen (10I.1, 600, 3–6). Christus musste durch den Tod dieses sterbliche Leben lassen und durch Auferstehen ein unsterbliches annehmen und er ist ein wahrhaftiger lebendiger Mensch und doch unsterblich, ewig unsichtbar und regiert also geistlich im Glauben (11, 328, 15–19).
4. Nach der Auferstehung wird ein ewiges Leben der Heiligen und ewiges Sterben der Sünder sein (7, 220, 1f.). Auf dem V. Laterankonzil wurde zurecht beschlossen, dass die Seele des Menschen unsterblich sei, womit erinnert wird an das Bekenntnis: ‚ich glaube ein ewiges Leben‘ (7, 425, 22–25), ja auch der Leib muss wiederkommen, wie wir im Glauben bekennen: ‚Ich glaube eine Auferstehung des Fleisches und ein ewiges Leben‘ (10I.1, 56, 19–23).
5. Christus will im Abendmahl nicht zeitlich, sondern geistlich und ewiglich geholfen haben durch seine Worte und Werke (7, 695, 24f.). Das Abendmahlsbrot speist zu einem unsterblichem ewigen Wesen, wie Christus sagt: Wer dies Brot isst, wird ewig leben (2, 109, 20–24).
📖 Heinrich Heimler, Aspekte der Zeit und Ewigkeit bei Luther, in: LuJ 40 (1973) 9–45.
[Zum Inhalt]
Exempel
→ Geschichte
1. Exempel und Historien geben und lehren allzeit mehr, als die Gesetze und das Recht: dort lehrt die gewisse Erfahrung, hier lehren unerfahrene, ungewisse Worte (6, 261, 20–22; vgl. 50, 383, 2–13). Äußere Beispiele bewegen nicht genug, da sie nicht empfunden werden und nicht lebendig sind; das innere Beispiel aber wird innerlich empfunden, lebt und lehrt in wirksamster Weise, nicht durch Buchstaben, Worte, Gedanken, sondern durch den Sinn der Erfahrung (2, 577, 30–33). An Exempel ist die Bibel voll, die nichts anderes als Gottes Werke und Wort lehrt, Menschenwerk und -wort verwirft (7, 594, 27–29). Dass niemand mit Werken zu Gott kommen und selig werden möge, als durch den Glauben, das treibt die Schrift in allen Exempeln und Lehren durch und durch (12, 403, 4–6). Die Schrift gewährt nicht nur Tröstungen der Verheißungen, sondern auch vielerlei Beispiele und Geschichten, durch die der Glaube an Gott genährt und befestigt wird (31II, 643, 28f.).
2. Christus als Exempel: Sein Wort und Werk soll in allem Leben ein kräftiges Exempel und Spiegel aller Tugenden sein (6, 15, 32–34; vgl. 275, 31–34). Aber man soll nicht aus Christus einen Mose machen, so dass er nicht mehr als lehre und Exempel gebe, wie es die anderen Heiligen tun, als sei das Evangelium eine Lehre oder Gesetzbuch. Darum sollst du Christus, sein Wort, Werk und Leiden in zweierlei Weise erfassen. Einmal als ein dir vorgetragenes Exempel, dem du folgen sollst. Das Hauptstück und der Grund des Evangeliums aber ist, dass du Christus zuvor, ehe du ihn zum |72|Exempel fassest, aufnimmst und erkennst als eine Gabe und Geschenk, das dir von Gott gegeben und dein eigen sei (10I.1, 10, 20–11, 15). Wenn du nun Christus so hast zum Grund und Hauptgut deiner Seligkeit, dann folgt das andere Stück, dass du ihn auch zum Exempel fasst, ergibst dich auch also deinem Nächsten zu dienen, wie du siehst, dass er sich dir ergeben hat. Christus als eine Gabe nährt deinen Glauben und macht dich zum Christen. Aber Christus als ein Exempel übt deine Werke, die machen dich nicht zum Christen, sondern sie gehen von dir aus als Christ, der schon zuvor zu einem solchen gemacht wurde (10I.1, 12, 12–20; vgl. 475, 3–16; 10I.2, 15; 22; 37f.; 247f.; 12, 372). Das andere, das dies Vorbild so hoch und unvergleichlich macht, ist, dass er nicht für sich selbst, auch nicht allein zum Exempel, sondern für uns gelitten hat. Das ist nun am allerwenigsten zu erlangen, mit diesem Stück hat Christus kein Exempel hinterlassen und es kann ihm niemand hierin nachfolgen, sondern er ist es allein, der für alle gelitten hat (21, 301, 28–36). Wir leugnen nicht, dass die Frommen Christi Beispiel nachahmen und gut handeln sollten, aber dadurch werden sie nicht gerecht vor Gott (40I, 389, 16f.).
3. Deutung: Darum lassen wir kein Exempel zu, auch von Christus selbst nicht, geschweige von andern Heiligen, es sei denn Gottes Wort dabei, das uns deute, welchen wir folgen oder nicht folgen sollen. Wir wollen am Werk und Exempel nicht genug haben, ja wir wollen keinem Exempel folgen, das Wort wollen wir haben, um welches willen alle Werke, Exempel und Wunder geschehen (18, 114, 25–30).
4. Die Exempel der Apostel sind die höchsten und nächsten vor allen Heiligen, die uns am besten unterweisen und Christus aufs klarste lehren (10I.2, 57, 11–26). Sie haben uns lauter gepredigt den Glauben, ihr Exempel allein dazu geordnet und dienen lassen, dass Christus in uns regiert und der Glaube lauter bliebe, dass wir nicht ihr Wort und Werk aufnehmen, als wäre es ihr Ding, sondern dass wir Christus in beidem, ihren Worten und Werken, lernten (10I.2, 58, 5–9).
5. Es ist gesagt, wie die Heiligen vielmals irren in menschlichen Lehren und Werken. Darum will Gott nicht, dass wir auf ihr Exempel, sondern auf seine Schrift sehen sollen (10I.1, 605, 12–14).
6. Der Beweis des Glaubens geschieht nur durch das Beispiel der ganzen Kirche in der Welt (2, 431, 30f.; vgl. 5, 532, 30–33).
7. Es ist falsch, dass man die Evangelien und Epistel achtet gleich wie Gesetzbücher, darin man lernen soll, was wir tun sollen, und die Werke Christi nicht anders denn als Exempel uns vorgebildet werden (10I.1, 9, 1–3).
📖 Dietrich Rössler, Beispiel und Erfahrung. Zu Luthers Homiletik, in: ders., / Hans Martin Müller, Hg., Reformation und Praktische Theologie, 1983, 202–215.
[Zum Inhalt]
Figur
→ Allegorie, Bild, Metapher, Zeichen
1. Die heilige Schrift verwendet sehr häufig grammatische Figuren, Synekdoche, Metalepse, Metapher, Hyperbole, ja in keiner anderen Schrift gibt es mehr Figuren. Auch wenn ‚Himmel‘ in der ganzen Schrift ein einfaches und eindeutiges Wort ist, das jenes hohe Firmament bezeichnet, wird er doch im Ps 19 als Metapher für die Apostel |73|verwendet. Was die Erde als einfaches Wort bedeutet, weiß jeder, metaphorisch bedeutet es die durch Laster und Böses niedergetretenen Gottlosen (8, 83, 32–37). Wo eine Figur, Symbol oder Gleichnis sein soll, da eines das andere bedeuten soll, da muss ja etwas gleiches in beiden angezeigt werden, darauf das Gleichnis stehe (26, 391, 29–31).
2. Das Alte Testament ist eine Figur des Neuen Testaments gewesen (6, 302, 21). Die Figuren des Alten Testaments gaben keine Gnade, aber sie heißen nicht Sakramente, denn in den Figuren war kein Wort oder Zusagung Gottes, was sein muss, wo ein Sakrament sein soll, sondern sie waren bloße Figuren oder Zeichen (7, 327, 22–29).
3. Figur und Erfüllung der Figuren verhalten sich gegeneinander wie ein leibliches und geistliches oder äußerliches und innerliches Ding, da man die Erfüllung von allem, was man in der Figur mit leiblichen Augen gesehen hat, allein mit dem Glauben sehen kann (6, 302, 31–34; 303, 12–15). Das alte Gesetz und seine Figuren müssen im neuen erfüllt werden (6, 304, 29f.). Wer die Erfüllung nicht zuvor in der Schrift beweisen kann, der nimmt seinen eigenen Traum für die Figur, denn aller Figuren Erfüllung steht im Neuen Testament (8, 347, 24–29; 386, 17–21). Das alte Testament hat gedeutet auf Christus, das neue aber gibt uns nun das, was vorher im alten verheißen und durch die Figuren bedeutet gewesen ist. Darum sind die Figuren aufgehoben, denn dazu haben sie gedient, dass jetzt vollendet ist und ausgerichtet und erfüllt, was darin verheißen ist (12, 275, 26–30).
4. Deutung: Wenn auch die Figuren fleischlich klingen, werden sie doch jetzt geistlich verstanden (4, 173, 40). Die Figur gehört in die leibliche, die Deutung in die geistliche Welt (8, 388, 19f.). Niemand anderes darf die Figur auslegen als der heilige Geist selbst, der die Figur gesetzt und Erfüllung gebracht hat, auf dass Wort und Werk, Figur und Erfüllung und beider Erklärung Gottes selbst, nicht der Menschen sind, auf dass unser Glaube auf göttliche, nicht menschliche Werke und Worte gegründet sei (6, 304, 11–14). In keiner Schrift, am wenigsten in der göttlichen, darf man mit reiner Willkür Figuren annehmen, sondern muss sie vermeiden und sich auf die einfache, reine und nächstliegende Bedeutung der Wörter stützen, es sei denn, der Zusammenhang selbst oder eine offenbare Absurdität zwingen dazu, eine Figur zu erkennen (8, 63, 27–30). Die Deutung der Figur kann dreierlei Weise geschehen. Zum ersten, wenn die Schrift selbst deutet. Solche Deutungen zwingen und sind Artikel des Glaubens. Die andere ist, wo die Schrift nicht selbst deutet, sondern da jeder gläubiger Verstand die Figur einführt und gründet um ihres Gleichnisses willen auf etliche klare Sprüche. Die dritte Weise ist eine bloße Deutung aus eigenem Gutdünken, wo die Figur allein ist und sonst nichts davon in der Schrift steht. Diese Deutung ist Irrtum (8, 386, 31–387, 15). Das, was dunkel mit Figuren gesprochen ist, sollen wir deuten mit dem, was ohne Figuren und einfach gesprochen ist (13, 638, 17–29).
5. Gebrauch: Augustin sagte: eine Figur beweist nichts (9, 456, 12; vgl. 7, 649, 28; 8, 63, 26; 154, 1f.; 345, 18; 346, 33f.). Aus bloßer Figur etwas zu begründen oder beweisen, ist falsch, da die Figur erst nach der erfolgten Erfüllung als Hinweis auf sie verstanden werden kann (8, 346, 13–22). Deshalb nützt sie nichts in theologischen Auseinandersetzungen oder zur Erbauung des Glaubens. Denn Figuren und Deutungen sind nicht genug, den Glauben zu begründen, er muss zuvor gegründet sein mit klarer Schrift, einfältig verstanden nach Laut und Meinung der Worte. Nach solchen Worten und Grund des Glaubens sind solche Deutungen der Geschichten auf den Glauben zu bauen (10I.1, 417, 12–16).
|74|📖 Anna Vind, Über die theologische Verwendung rhetorischer Figuren bei Luther, in: Oswald Bayer, Hg., Creator est Creatura, 2007, 95–124.
[Zum Inhalt]
Fleisch/Geist
→ alt/neu, Leib/Seele, Mensch, Sünde
1. Fleisch wird nicht nur als Sinnlichkeit oder Begierde des Fleisches verstanden, sondern als alles das, was ohne die Gnade und den Geist Christi ist (2, 509, 21f.). Die Scholastiker unterscheiden Fleisch und Geist metaphysisch als zwei Substanzen, wo doch der ganze Mensch Geist und Fleisch ist, Geist, insofern er das Gesetz Gottes liebt, Fleisch, insofern er das Gesetz Gottes hasst (2, 415, 7–10). Mit Fleisch wird der ganze Mensch bezeichnet, mit Geist ebenso der ganze, und man muss unterscheiden den inneren und den äußeren Menschen oder den neuen und den alten nicht gemäß der Unterscheidung von Seele und Leib, sondern gemäß dem Affekt. Denn die Frucht und die Werke des Geistes sind Friede, Glaube, Beständigkeit usw. und dies geschieht im Leib (2, 588, 30–33). Mit dem Wort Fleisch wird der alte Mensch bezeichnet, nicht nur, weil er durch sinnliches Begehren getrieben ist, sondern auch, wenn er fromm, weise, gerecht ist, weil er nicht aus Gott durch den Geist wiedergeboren ist (1, 146, 14–16). Unser Fleisch wird in der ersten Sünde durch zwei Wunden schwer geschlagen. Die erste ist die Reizbarkeit zum Bösen, die zweite die Begierde. Diese beiden Wunden werden uns durch die Gebote erkennbar, aber durch die Gnade geheilt (1, 484, 32–34). Die Weisheit des Fleisches, die Sinnlichkeit genannt wird, ist Selbstsucht, d.h. wenn die Vernunft anstrebt, was ihr recht und gut erscheint, obwohl sie das nicht vermag und von Gott erbitten muss, damit sie von seinem Geist belehrt werde, was nicht bloß recht und gut zu sein scheint, sondern ist (1, 34, 1–4). Fleisch heißt die Schrift den ganzen Menschen, wie er von Vater und Mutter geboren ist, leben, wirken, denken, reden und tun kann. Das alles ist nichts anderes als Fleisch, das ist, ohne Geist. Ohne Geist sein heißt nichts anderes als in Gottes Reich nicht kommen können, das ist, in Sünden unter Gottes Zorn, zum ewigen Tod verdammt sein (21, 532, 29–38; vgl. 22, 133, 29–39). Man muss verstehen, dass der Mensch mit Vernunft und Willen, inwendig und auswendig, mit Leib und Seele Fleisch heißt, darum, dass er mit allen Kräften auswendig und inwendig nur sieht, was fleischlich ist und was dem Fleisch wohl tut (12, 373, 18–34). Das Wörtlein Fleisch muss man so verstehen, dass der ganze Mensch Fleisch heiße, wie er lebt, wie er auch ganz Geist heißt, wenn er nach dem trachtet, was geistlich ist (12, 376, 4–6). In der heiligen Schrift wird Geist genannt, was vom heiligen Geist ist, und Fleisch heißt, was vom Fleisch geboren ist. Was nun aus der Vernunft ist, heißt alles Fleisch. Derhalben sind Fleisch die Allerklügsten und Gewaltigsten auf Erden (33, 257, 1–39). Fleisch bedeutet also die ganze Natur des Menschen mit seinem Verstand und allen seinen Kräften. Deshalb bedeutet für Paulus Fleisch die höchste Gerechtigkeit, Weisheit, Kult, Religion, Verstand, Wille, die in der Welt sein können (40I, 244, 14–23).