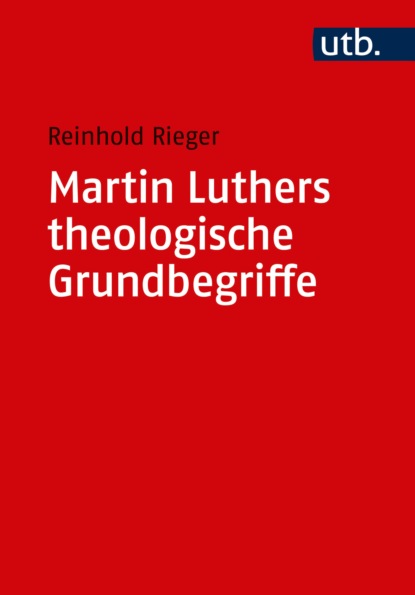- -
- 100%
- +
2. Einheit des Menschen aus Fleisch und Geist: Luther sagt: Ich trenne Fleisch, Seele und Geist überhaupt nicht. Denn das Fleisch begehrt nicht außer durch Seele und Geist, wodurch es lebt, aber unter Geist und Fleisch verstehe ich den ganzen Menschen, besonders die Seele selbst. Derselbe Mensch, dieselbe Seele, derselbe Geist |75|des Menschen, ist, insofern er das, was Gottes ist, versteht, Geist, insofern er von den Verführungen des Fleisches bewegt wird, Fleisch, so dass er, wenn er dem zustimmt, ganz Fleisch ist. Man darf sich also nicht zwei verschiedene Menschen vorstellen. Es ist der ganze Mensch, der die Keuschheit liebt, derselbe ganze Mensch wird durch die Verführungen der Begierde gereizt. Es sind zwei ganze Menschen und ein ganzer Mensch. Daher kommt es, dass der Mensch gegen sich selbst kämpft und sich widerstreitet, will und nicht will. Aber das ist der Ruhm der Gnade Gottes, dass sie uns selbst zu unseren Gegnern macht (2, 585, 31–586, 18). Ein einziger Mensch findet in sich selbst zwei Stücke: durch den Geist will er das Gute und dient dem Gesetz Gottes und ist fromm, hat auch Lust und Liebe darin, aber durch das widerspenstige Fleisch will er das Böse und hat Liebe und Lust darin, demselben zu dienen. Weil Fleisch und Geist ein Mensch sind, so wird ihm zugerechnet beides, obwohl sie widereinander sind. Des Geistes halben ist er fromm, des Fleisches halben hat er Sünde. Denn weil das edelste, beste, höchste Stück des Menschen, der Geist, durch den Glauben fromm und gerecht bleibt, rechnet ihm Gott die übrige Sünde des geringsten Stücks, des Fleisches, nicht zur Verdammnis (7, 331, 32–333, 7). Das Fleisch neigt sich nach unten, der Geist strebt zum Himmel, und ist dennoch ein Mensch, nicht eine doppelte Person, die verschiedene Affekte hätte im Fleisch und im Geist, also der Sünde und des guten Lebens (34II, 198, 28–31).
3. Gegensatz: Den Streit unseres Fleisches und Geistes mit widerspenstigen Begierden legt Gott auf allen, die er getauft sein und berufen lässt. Daher streiten Geist und Fleisch widereinander, aber der Geist soll mit Mühe und Arbeit obsiegen und das ungehorsame Fleisch unterdrücken. Es ist offenbar, dass noch Sünde in den Getauften und Heiligen bleibt, so lange sie Fleisch und Blut haben und auf Erden leben (7, 331, 3–15; vgl. 6, 244, 14–21). Woher kommt aber solcher Streit des Bösen wider das Gute in uns selbst als von der leiblichen Geburt Adams, welche nach dem angefangenen guten Geist in der Taufe und Buße übrigbleibt, bis dass es durch Widerstreit und Gottes Gnaden und des Geistes Zunehmen überwunden und zuletzt durch den Tod erwürgt und ausgetrieben werde (7, 331, 25–29). Weil wir alle mit Christus der Welt und dem Fleisch abgestorben sind, so sollen wir hinfort nicht mehr nach dem Fleisch oder fleischlich leben noch denken (26, 310, 30–311, 24).
4. Ist nun Christi Fleisch aus allem Fleisch ausgesondert und allein ein geistliches Fleisch vor allen, nicht aus Fleisch, sondern aus Geist geboren, so ist es auch eine geistliche Speise. Ist es eine geistliche Speise, so ist es eine ewige Speise, die nicht vergehen kann. Sein Fleisch ist nicht aus Fleisch noch fleischlich, sondern geistlich, darum kann es nicht verzehrt, verdaut, verwandelt werden, denn es ist unvergänglich wie alles, was aus dem Geist ist. Vergängliche Speise verwandelt sich in den Leib, der sie isst. Diese Speise wiederum verwandelt den, der sie isst, in sich und macht ihn ihr selbst gleich, geistlich, lebendig, ewig (23, 203, 14–29; vgl. 205, 20–23). Luther lehrt, dass Christi Fleisch nicht allein keinen Nutzen, sondern auch Gift und Tod sei, wenn es ohne Glaube und Wort gegessen wird (26, 353, 27–31). Der Evangelist Johannes hätte wohl sagen können: Das Wort ward Mensch, er sagt aber nach der Schrift Brauch: es ward Fleisch, um anzuzeigen die Schwachheit und Sterblichkeit, denn Christus hat menschliche Natur angenommen, die sterblich und dem schrecklichen Zorn und Gericht Gottes wegen der Sünde des menschlichen Geschlechts unterworfen ist, welchen Zorn dieses schwache und sterbliche Fleisch in Christus gefühlt und gelitten hat (46, 632, 21–26).
|76|5. Christus und die Kirche sind ein Fleisch und ein Geist und haben alles gemeinsam. Christus hat die Menschheit angenommen und ist mit der Kirche in einem Fleisch verbunden, was ein großes und freudiges Geheimnis ist, in dem in eins zusammenkommen der Reiche und der Arme, der Gerechte und der Sünder, der Selige und der Verdammte, der Sohn der Gnade und der Sohn des Elends (5, 549, 10–13).
6. Die unvergleichliche Gnade des Glaubens ist es, dass er die Seele verbindet mit Christus wie die Braut mit dem Bräutigam. Durch dieses Geheimnis werden Christus und die Seele ein Fleisch. Wenn sie ein Fleisch sind und zwischen ihnen eine wahrhafte Ehe geschlossen wird, so folgt, dass alles, was ihnen gehört, sowohl das Gute wie auch das Böse, beiden gemeinsam wird, damit, was auch immer Christus besitzt, die gläubige Seele als das Ihre genießen und sich dessen rühmen kann, und was immer die Seele besitzt, sich Christus als das Seine aneignet (7, 54, 31–38).
📖 Oswald Bayer, Das Wort ward Fleisch, in: ders., Hg., Creator est Creatura, 2007, 5–34. Erdmann Schott, Fleisch und Geist nach Luthers Lehre, 2. Aufl. 1969.
[Zum Inhalt]
Form
→ Reformation
Sobald dieses und andere Wörter in der Theologie oder in theologischen Zusammenhängen gelesen werden, denkt der menschliche Geist sofort an die, die in der Naturwissenschaft gebraucht werden, und wird abgelenkt und weggeführt in verwirrende und gefährliche Streitigkeiten. Denn die Naturwissenschaft schmeichelt natürlich der Vernunft, aber die Theologie ist hoch über das menschliche Verstehen gesetzt (39I, 228, 14–229, 5). Beim Wort ‚formal‘ und anderen naturwissenschaftlichen Begriffen bringt die Philosophie immer etwas Schädliches mit sich, wenn sie in die Theologie übertragen werden, deshalb muss sorgfältig beachtet werden, dass die Wörter rein und sicher verstanden werden, nämlich dass sie, wenn sie daher übertragen werden, gleich neu werden (39I, 229, 35–230, 26).
1. Christus ist den Menschen ähnlich, d.h. den Sündern und Schwachen, und er hat keine andere Gestalt noch Form als die des Menschen und Knechts, dass er uns nicht in der Form Gottes verachtete, sondern unsere Form annahm und unsere Sünden in seinem Leib trug (2, 603, 17–20). Obwohl er voll göttlicher Form war und für sich selbst genug hatte, hat er sich dennoch dessen alles entäußert (7, 35, 14–16). Christus verwirft alle hohe Form und trägt des Kreuzes Form (10I.1, 390, 17f.).
2. Paulus sagt, Adam sei die Form Christi, da jener Urheber der Sünde, dieser der Gerechtigkeit sei, aber die Form ist dem Ursprung ähnlich, nicht den ähnlichen Dingen (5, 314, 20–22).
3. Der Papst ist nicht ein Statthalter Christi im Himmel, sondern allein Christi auf Erden wandelnd, denn Christus im Himmel, in der regierenden Form, bedarf keines Statthalters. Aber er darf es sein in der dienenden Form, als Christus auf Erden ging, mit arbeiten, predigen, leiden und sterben. So kehren sie es um, nehmen Christus die himmlische regierende Form und geben sie dem Papst, lassen die dienende Form ganz untergehen (6, 434, 9–15).
|77|4. So muss der Christ, wie sein Haupt Christus durch seinen Glauben erfüllt und gesättigt, zufrieden sein mit dieser durch den Glauben erhaltenen Form Gottes (7, 65, 26f.).
📖 Joachim Mehlhausen, Forma Christianismi, in: ZThK 87 (1990) 447–455.
[Zum Inhalt]
Freiheit
→ Wille
1. Wesen: Freiheit hat theologisch gesehen wie die Knechtschaft entsprechend den zwei Aspekten des Menschen zwei Seiten: Die Freiheit des Geistes oder des neuen Menschen ist die Befreiung vom alten Menschen und von der Knechtschaft der Sünde. Die Freiheit des Fleisches oder des alten Menschen ist im Gegenteil die Loslösung vom neuen Menschen und von der Knechtschaft der Gerechtigkeit. Die Knechtschaft des Geistes ist selbst die Freiheit des Geistes, und die Knechtschaft des Fleisches ist selbst die Freiheit des Fleisches (57II, 99, 14–18). Die Freiheit, zu der uns Christus befreite, befreit nicht aus irgendeiner menschlichen Knechtschaft oder der Gewalt von Tyrannen, sondern vom ewigen Zorn Gottes, nämlich im Gewissen. Denn Christus machte uns nicht politisch, nicht fleischlich frei, sondern theologisch oder geistlich, d.h. damit unser Gewissen frei und freudig sei, nicht den kommenden Zorn fürchte (40II, 3, 20–24). Aus dieser folgt eine andere Freiheit, durch die wir durch Christus sicher und frei gemacht werden vom Gesetz, Sünde, Tod, Macht des Teufels, Hölle usw. (40II, 4, 13f.). Die evangelische Freiheit herrscht nur in dem, was zwischen Gott und dir stattfindet, nicht zwischen dir und deinem Nächsten. Aber diese Freiheit hindert nicht, dass du dich mit deinem Nächsten verbinden kannst, denn dein Nächster befiehlt dir nicht, losgelöst und frei zu sein wie Gott. Sonst erlaubte er auch alle Verträge, Bündnisse und Abmachungen zu halten oder zu brechen nach Belieben (8, 615, 28–616, 1). Ein Christenmensch, der also in der Freiheit steht, darf nichts mehr sorgen, dass er fromm und gerechtfertigt werde, er weiß wohl, dass ihn die Werke weder fromm noch unfromm machen können. So bleibt er immerzu frei, tut, was man von ihm haben will (9, 569, 24–28). Ein christliches Wesen besteht nicht in äußerlichem Wandel, es wandelt auch den Menschen nicht nach dem äußerlichen Stand, sondern nach dem innerlichen, das ist, es gibt ein anderes Herz, einen anderen Mut, Willen und Sinn, welcher eben die Werke tut, die ein anderer ohne solchen Mut und Willen tut (10I.1, 137, 14–22). Unsere christliche Herrschaft, Freiheit und Macht muss man allein geistlich verstehen, denn Christus hat nichts wollen zu schaffen haben mit weltlicher Herrschaft. Das heißt aber geistliche Freiheit, wenn die Gewissen frei bleiben (10II, 15, 24–27). Der Satz von der christlichen Freiheit sagt, dass alle äußerlichen Dinge frei sind vor Gott und ein Christ sie mag gebrauchen, wie er will, er mag sie nehmen oder fahren lassen. Du bist Gott nichts schuldig zu tun, als glauben und bekennen, in allen anderen Sachen gibt er dich los und frei, dass du es machst, wie du willst, ohne alle Gefahr des Gewissens. Bei dem Menschen oder bei deinem Nächsten mache ich dich nicht frei, denn ich will ihm das Seine nicht nehmen, bis er selbst dich auch frei gibt. Bei mir aber bist du frei. Darum so merke und unterscheide diese Freiheit recht, dass |78|es zwischen Gott und dir nicht also steht wie zwischen dir und deinem Nächsten. Dort ist diese Freiheit, hier ist sie nicht. Denn Gott gibt dir diese Freiheit nur in dem, was dein ist, nicht in dem, was deines Nächsten ist (12, 131, 23–132, 10). So bist du aller Dinge frei bei Gott durch den Glauben, aber bei den Menschen bist du jedermanns Diener durch die Liebe (12, 133, 2f.).
2. Herkunft: Wenn die Gnade erlangt ist, dann hast du einen freien Willen, dann tue, was in dir ist (2, 248, 7f.). Der freie gute Wille bedarf allein Gottes und der Gnade, ohne die er nur sündigen kann (2, 702, 32f.). Christus hat uns frei gemacht von allen Menschengesetzen, besonders wenn sie gegen Gott und der Seelen Seligkeit sind (6, 443, 22–24). Also sehen wir, dass an dem Glauben ein Christenmensch genug hat, er bedarf keines Werkes, dass er fromm sei: bedarf er keines Werkes mehr, so ist er gewiss entbunden von allen Geboten und Gesetzen, ist er entbunden, so ist er gewiss frei. Das ist die christliche Freiheit, der einzige Glaube, der macht, nicht dass wir müßig gehen oder Übel tun mögen, sondern dass wir keines Werks bedürfen, um Frömmigkeit und Seligkeit zu erlangen (7, 24, 35–25, 4). Daraus man klar sieht, wie ein Christenmensch frei ist von allen Dingen und über alle Dinge, so dass er keiner guter Werke dazu bedarf, dass er fromm und selig sei, sondern der Glaube bringt ihm alles überflüssig. Wo er so töricht wäre und meinte, durch ein gutes Werk fromm, frei, selig oder Christ zu werden, so verlöre er den Glauben mit allen Dingen (7, 28, 19–23). Dass die Lehre des Evangeliums frei sei und macht freie Herzen, die an kein Werk noch Weise äußerlich gebunden, allein im freien Glauben leben, das ist die christliche Freiheit. Das Evangelium macht fröhliche, willige, freie Gewissen, denn da ist alles frei (8, 11, 9–15).
3. Man soll merken, dass die christliche Freiheit nicht darin besteht, wie viele Leute denken, dass man tut, was man will, sondern wer die Freiheit verstehen will, muss annehmen, dass die Kirche geteilt sei in zwei Stücke: eines vor Gottes Angesicht, das andere vor den Leuten. Das ist eine andere Weise, wenn man in Gottes Augen fromm ist, als wenn man vor den Leuten fromm genannt wird. Also sind wir vor Gottes Angesicht frei, in der Seele durch den Glauben, in welchem allein die Freiheit besteht. Darum ist sie nichts anderes, als dass ein Mensch ein gutes, fröhliches und unerschrockenes Gewissen habe. Dann ist er Gott nichts mehr schuldig. Das Gewissen macht ein rechter, starker Glaube. Diesen Glauben kann niemand sehen, als der ihn hat, denn er ist inwendig im Herzen. Zu dieser Freiheit wirst du nicht kommen, wenn du außen tust, was du willst, denn damit wird das Herz nicht rein, fromm, frei, bekommst auch damit kein fröhliches und ungefangenes Gewissen, du musst an einem Höheren anfangen. Die Freiheit kommt von innen her, dass wir mit Gott eins sind und wissen, wie wir mit ihm stehen (9, 566, 32–567, 24). Wenn wir nun also mit Gott eins sind und glauben, dass er uns fromm gemacht habe, so dass wir zur Frömmigkeit nichts mehr bedürfen, müssen wir kommen zu dem anderen Aspekt und sehen, was man in der Menschen Angesicht tun soll. Wenn die Seele also frei ist vor Gottes Augen, ist dennoch der äußerliche Mensch da vor den Leuten, da hört die Freiheit auf. Wenn ich aus dem Herzen und aus der Seele komme vor die Leute, bin ich in einem anderen Land. Unser Fürstentum, darin wir ganz frei sind, ist in der Seele inwendig und im Himmel, wie Paulus sagt, vor Gottes Angesicht. Aber der Leib ist in einem fremden Fürstentum, da muss ich mich lenken, handeln und tun, nach dem es die Leute leiden mögen. Das ist ein freies Gefängnis: Das Herz bleibt ungefangen, obwohl wir tun |79|müssen, was andere Leute wollen, tun wir es doch aus einem freien Gemüt. So geht die rechte Freiheit immer heraus, bleibt inwendig ungefangen (9, 567, 25–568, 3).
4. Der Irrtum vom freien Willen ist ein eigener Artikel des Antichrist. Darum ist es nicht wunder, dass er so weit in alle Welt ist getrieben, denn der Antichrist soll die ganze Welt verführen (7, 451, 4–6). Der Wille des Menschen ohne die Gnade ist nicht frei, sondern knechtisch, obwohl nicht unwillentlich (1, 147, 38f.). Jeder, der sündigt, ist ein Knecht der Sünde. Der Wille ohne die Gnade sündigt, also ist er nicht frei (1, 148, 1f.). Der freie Wille nach der Sünde ist ein leeres Wort, und wenn er tut, was in ihm ist, sündigt er tödlich (1, 354, 5f.). Der Wille des Menschen ist ohne die Gnade nicht frei zu handeln, sei es bei Gegensätzlichem, sei es bei Widersprechendem, sondern er ist notwendig gebunden und gefangen, wenn er auch frei von jedem Zwang ist. Wir sprechen nur von der Willensfreiheit in bezug auf Verdienst und Schuld. Denn in bezug auf andere Dinge, die ihm unterliegen, verneine ich nicht, dass er besteht, da er ja frei zu sein scheint in bezug auf Gegensätzliches wie Widersprechendes (1, 365, 25–34). Daraus folgt, dass der freie Wille des Menschen gar nichts vermag aus ihm selbst und es nicht in seiner Willkür frei steht, Gutes zu erkennen oder zu tun, sondern allein in der Gnade Gottes, die ihn frei macht, ohne welche er in Sünden und Irrtum gefangen liegt und nicht heraus von ihm selbst kommen mag, damit bewiesen wird, dass wir Gottes Willen nicht tun mögen aus unserem freien Willen (2, 247, 3–21). Luther wollte, das Wörtlein ‚freier Wille‘ wäre nie erfunden worden, es stehe auch nicht in der Schrift und hieße billiger ‚eigener Wille‘, der keinen Nutzen hat, oder so man es ja behalten wolle, solle man es deuten auf den neu geschaffenen Menschen, dass dadurch werde verstanden der Mensch, der ohne Sünde ist, der ist gewiss frei, wie Adam im Paradies war, von welchem auch die Schrift redet, wo sie an unsere Freiheit rührt. Die aber in den Sünden liegen, sind unfrei und des Teufels gefangen. Doch weil sie können noch frei werden durch die Gnade, magst du sie nennen freiwillige (7, 449, 24–31). Der freie Wille ist ohne die Gnade Gottes nicht frei, sondern unwandelbar gefangen und Knecht des Bösen, da er sich nicht von sich aus dem Guten zuwenden könnte (18, 636, 5f.). Daraus folgt, dass der freie Wille nur ein Name Gottes ist und dass er niemand anderem zukommt als allein der göttlichen Majestät. Wenn er Menschen zugeschrieben würde, würde er ihnen um nichts richtiger zugeschrieben, als wenn ihnen die Gottheit zugeschrieben würde, was das größte Sakrileg wäre. Es ist Aufgabe der Theologen, auf diesen Begriff zu verzichten, wenn sie von den menschlichen Fähigkeiten reden wollen, und ihn nur Gott zu lassen, ihn aus dem Mund der Rede von Menschen wegzunehmen und als ein heiliger und verehrungswürdiger Name Gott zuzubilligen (18, 636, 27–637, 3). Das Gewissen wollen und sollen wir frei haben in allen Werken, die nicht zum Glauben oder der Liebe des Nächsten dienen (12, 157, 23–29).
5. Freiheit zum Handeln: Die geistliche Freiheit ist die, durch die wir ungezwungen und freudig tun, ungeachtet von Strafen oder Verdiensten, was im Gesetz gefordert wird, die Knechtschaft aber, durch die wir in knechtischer Furcht oder kindlicher Liebe handeln. Die Freiheit ist geistlich, im Geist zu bewahren, sie ist nicht jene heidnische Freiheit vom Gesetz, sondern der bei den Menschen entgegengesetzt. Die menschliche Freiheit besteht, wenn die Gesetze verändert werden, während die Menschen gleich bleiben. Aber die christliche Freiheit besteht darin, dass ohne Veränderung der Gesetze die Menschen verändert werden, so dass dasselbe Gesetz, das zuvor dem freien Willen verachtenswert war, durch die vom heiligen Geist in unsere Herzen |80|gelegte Liebe freudig geschieht (2, 560, 12–25). Die Gerechtigkeit des Glaubens wird vor allen Werken gegeben und ist das Prinzip der Werke selbst, also ist sie die Freiheit zum Handeln (2, 575, 17f.). Die Freiheit des Glaubens gibt nicht Erlaubnis zu Sünden, wird sie auch nicht decken, sondern gibt Erlaubnis, allerlei Werke zu tun und alles zu leiden, wie sie vor die Hand kommen, dass nicht an eines oder etliche Werke allein jemand gebunden sei (6, 213, 29–32).
6. Lehre von der Freiheit: Es ist nicht erlaubt etwas zu lehren, was gegen die evangelische Freiheit ist. Denn diese Freiheit ist göttlichen Rechts, die Gott bestimmt hat. Diese Freiheit ist nicht nur die, die im Geist und Gewissen regiert, durch die wir von keinen Werken angeklagt oder verteidigt werden, sondern auch die, der alle menschlichen Gebote unterworfen sind und was in äußeren Riten befolgt werden kann, damit es erlaubt ist, sie zu befolgen oder nicht zu befolgen (8, 613, 8–16). Armut, Gehorsam, Keuschheit können beständig eingehalten werden, gelobt, gelehrt, gefordert aber nicht. Denn wenn sie eingehalten werden, bleibt die evangelische Freiheit gewahrt, beim Lehren, Geloben, Fordern jedoch nicht, weshalb die Heiligen, die sie befolgt haben, sie frei befolgten. Es ist etwas völlig anderes, wenn etwas, das weder gelehrt noch gefordert wird, geschieht, als wenn dasselbe gelehrt und gefordert wird zu tun. Dies ist aus dem Geschehenen ein Gesetz zu machen, aus dem Werk ein Gebot, aus dem Beispiel eine Regel, aus dem Zufälligen ein Notwendiges. Das erste ist aus Gott, das andere aus den Menschen (8, 616, 26–35).
7. Grenzen: Wir müssen uns mit unserer Freiheit so halten, dass wir niemandem Ursache geben, sich an uns und unserer Freiheit zu ärgern, wir sollen auch nicht vergessen, wie uns Gott getragen und geduldet hat in unserer Schwachheit, unserem Unglauben lange Zeit, und also auch Geduld tragen mit unserem Nächsten (10III, 6, 21–24). Zwischen Gott und dir allein ist die Freiheit ganz rund und vollkommen, dass du vor ihm keines dieser Stücke musst halten, die er nicht geboten hat, hier ist Himmel und Erde voll deiner Freiheit, ja Himmel und Erde können sie nicht begreifen. Zwischen dir aber und deinem Nächsten oder deiner Obrigkeit ist sie nicht weiter, als so fern sie deinem Nächsten unschädlich ist, ja wo sie nützlich und förderlich sein kann, soll sie nicht frei sein wollen, sondern weichen und dienen (26, 582, 21–27).
8. Missbrauch: Wenn der Zwang der Menschenlehre aufgehoben und die christliche Freiheit gepredigt wird, so fallen aber herein die ruchlosen Herzen, die ohne Glauben sind, und wollen damit gute Christen sein, dass sie des Papstes Gesetze nicht halten, wenden diese Freiheit vor, dass sie solches nicht schuldig sind, und tun doch jenes auch nicht, das die rechtschaffene christliche Freiheit fordert, nämlich dem Nächsten dienen von fröhlichem Gemüt und unangesehen, dass es geboten ist, wie die wahrhaftigen Christen tun. Also machen sie die christliche Freiheit nur zu einem Deckel, unter welchem sie bloß Schande anrichten, und verunreinigen den edlen Namen und Titel der Freiheit, den die Christen haben (12, 332, 11–20). Wie die christliche Freiheit durch zweierlei gebrochen wird, wenn man gebietet, zwingt und dringt zu tun, was doch nicht geboten noch erzwungen ist von Gott, oder wenn man verbietet, wehrt und hindert zu lassen, was doch nicht verboten noch gewehrt ist von Gott. Denn mein Gewissen ist eben so wohl gefangen und verführt, wenn es etwas lassen muss, das nicht Not ist zu lassen, als wenn es etwas tun muss, das nicht Not zu tun ist, und christliche Freiheit sowohl untergeht, wenn sie lassen soll, was sie nicht lassen muss, als wenn sie tun soll, was sie nicht tun muss (18, 111, 14–24).
|81|📖 LuJb 62, 1995: Befreiung und Freiheit. Hans-Martin Barth, Luthers Verständnis von Freiheit und Gebundenheit, in: Una Sancta 62 (2007) 103–115. Oswald Bayer, Umstrittene Freiheit, Tübingen 1981. Reinhard Brandt, Die ermöglichte Freiheit, Hannover 1992. Berndt Hamm, Martin Luthers Entdeckung der evangelischen Freiheit, in: ders., Der frühe Luther, 2010, 164–182. Thorsten Jacobi, Christen heißen Freie. Luthers Freiheitsaussagen in den Jahren 1515–1519, Tübingen 1997. Eberhard Jüngel, Zur Freiheit eines Christenmenschen, München 1978. Dietrich Korsch, Freiheit als Summe, in: NZSTh 40, 1998, 139–156. Reinhold Rieger, Von der Freiheit eines Christenmenschen. De libertate christiana (KSLuth 1), Tübingen 2007. Ders., Frei im Glauben, gehorsam der Obrigkeit? In: Luther und die Fürsten, 2015, 35–43. Joachim Ringleben, Freiheit im Widerspruch, in: NZSTh 40 (1998) 157–170. Reinhard Schwarz, Luthers Freiheitsbewußtsein und die Freiheit eines Christenmenschen, in: Dietrich Korsch / Volker Leppin, Hg., Martin Luther – Biographie und Theologie, 2010, 31–68. John Witte, The Freedom of a Christian, in: EvTh 74 (2014) 127–135. Ernst Wolf, Libertas christiana und libertas ecclesiae, in: EvTh 9 (1949 / 50) 127–142. Werner Zager, Hg., Martin Luther und die Freiheit, 2010.
[Zum Inhalt]
Freude
1. Freude besteht in Gott und im Nächsten. In Gott, wenn wir uns der göttlichen Barmherzigkeit erfreuen, auch mitten in den Stürmen der Welt Gott loben und preisen. Im Nächsten, wenn wir ihm nicht seine Güter neiden, sondern ihm dazu Glück wünschen wie zu unseren eigenen und die Gaben Gottes loben in ihm (2, 593, 24–28). Der Glaube an Gott und das Licht des Angesichts Gottes erfreuen das Herz und erfüllen das Innere des Menschen mit beständiger und wahrer Freude, da sie durch die Vergebung der Sünden Frieden und gewisses Vertrauen auf Gott bringen, auch mitten im Leiden. Es gibt nämlich keine Freude, kein Friede, außer durch ein reines Gewissen (5, 119, 26–30; vgl. 119, 39–120, 3). Was mag ein Herz größere Freude hören, als dass Christus ihm zu eigen gegeben wird? (10I.1, 79, 3–10). Glaubst du, so ist es nicht möglich, dass davon dein Herz nicht sollte vor Freuden in Gott lachen, frei, sicher und mutig werden. Denn wie mag ein Herz traurig oder unlustig bleiben, das nicht zweifelt, Gott sei ihm freundlich und halte sich gegen ihn als ein guter Freund, mit dem er alles Dinges wohl vermöge? Es muss solche Freude und Lust folgen; folgt es aber nicht, so ist gewiss der Glaube noch nicht recht da (10I.1, 101, 13–19). Je mehr Glauben da ist, je mehr solche Freude und Freiheit; je weniger Glaube, je weniger Freude (10I.1, 368, 1f.). Freude ist eine Frucht des Geistes nach Gal 5, 22 (10I.1, 447, 7). Das ist im Evangelium beschlossen, dass außerhalb Christus keine Freude ist, und wiederum wo Christus ist, da ist keine Traurigkeit (10I.2, 250, 29f.).