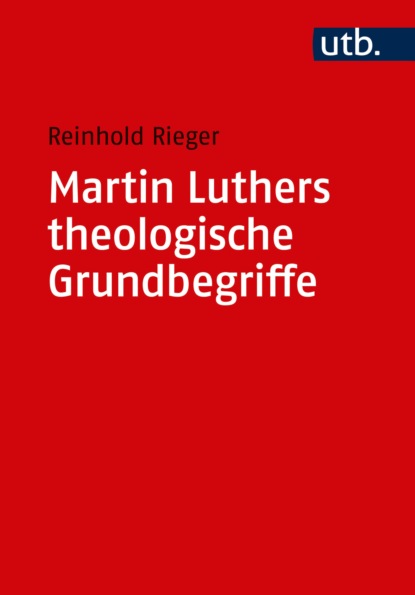- -
- 100%
- +
2. Alle unsere Freude besteht in der Hoffnung auf Zukünftiges, nicht in gegenwärtigen Dingen. Also freuen wir uns, weil wir die göttlichen Verheißungen glauben, und was er verheißt, das hoffen und lieben wir (4, 380, 35–37). Innere Freude über das Wort, äußere Freude über die Dinge, und äußere Traurigkeit über den Mangel der Dinge, innere Traurigkeit über den Mangel des Worts. Glücklich ist also die Traurigkeit der Glaubenden, die eine solche Freude mit sich bringt. Unglücklich ist die Freude der Ungläubigen, die eine solche Traurigkeit mit sich bringt. Die Freude jener gründet auf das Wort des Herrn, das in Ewigkeit bleibt, dieser aber auf das Fleisch, das wie Heu ist und verbrannt wird (4, 382, 20–25). Man soll nicht warten einer leiblichen, sondern einer geistlichen Freude, die man nur durch Sagen und Hören mit dem Glauben des Herzens schöpfe (10I.2, 34, 6–8). Die eine Freude ist fleischlich, die entsteht aus der Fülle und der Sicherheit materieller Dinge, wie Gesundheit, Glück, Reichtum, |82|Gunst, Macht, Freundschaft und ähnliches. Das nützt nichts, sondern vermehrt nur die Traurigkeit in der Zeit der Widrigkeiten, denn wie die Dinge, an denen man sich freut, nicht echt sind, sondern täuschend und vergänglich, so ist auch die Freude an ihnen täuschend und vergänglich. Also ist eine geistliche Freude vonnöten, die aus geistlichen Dingen entsteht. Geistliche Dinge sind die unsichtbaren Gaben Gottes (10III, 81, 36–82, 2).
3. Wo die innere Freude ist, da müssen alsbald die Werke folgen, welche diese Freude beweisen (10I.2, 439, 11f.). Wo diese Freude nicht aus dem Fleisch, sondern aus dem Geist kommt, da freut sich das Herz innerlich durch den Glauben an Christus, weil es gewiss wurde, dass er sein Retter und unser Mittler ist, und zeigt diese Freude nach außen durch Worte und Taten (40II, 117, 33–118, 14).
📖 Sybille Rolf, Freude, die zum Herzen geht, in: Christian Polke, Hg., Niemand ist eine Insel, 2011, 181–202. Andreas H. Wöhle, Luthers Freude an Gottes Gesetz, 1998.
[Zum Inhalt]
Friede
→ Versöhnung
1. Der Friede ist ein doppelter: In Bezug auf Gott ist er das gute Gewissen, das sich auf die Barmherzigkeit Christi verlässt, aber jeden Sinn übersteigt, wenn Gott sich verbirgt und verwirrt und sein Gesicht abwendet. In Bezug auf den Nächsten, wenn seinem Willen nachgegeben wird. Denn der Friede mit den Menschen kann niemals bestehen, wenn jeder das Seine rechtfertigt, verteidigt, sucht, fordert (2, 594, 7–11). Der Friede Gottes bewahrt die Herzen und den Verstand, die Sinnen und Geister, d.h. den Affekt und den Verstand, der in Christus ist oder die Erkenntnis Christi, damit sie aushalten bis zum Ende und gerettet werden (7, 520, 11–13). Das ist der höchste Friede, wenn das Herz zufrieden ist (45, 623, 26f.). Luther sagt paradox, dass Frieden heißt auf Deutsch Angst in der Welt, das ist sei Sprache Christi: Frieden heißt Unfriede, Glück heißt Unglück, Freude heißt Angst, Leben heißt Tod in der Welt, und wiederum, was in der Welt heißt Unfriede, Angst, Tod, das heiße Friede, Trost und Leben. Leben ist es, Freude und Trost ist es, aber nicht in der Welt, sondern in Christus werdet ihr solches finden (46, 108, 38–109, 4).
2. Es ist nicht möglich, dass ein Herz Frieden habe, es vertraue denn Gott und nicht seinen eigenen Werken, Fleiß und Gebeten (7, 387, 14–20). Der Friede kommt nur aus dem Glauben, das ist die gute Zuversicht auf die unsichtbare Gnade Gottes, der uns versprochen hat, uns fromm, gerecht und selig zu machen (7, 552, 21–26).
3. Wer den Frieden auf anderem Wege sucht, etwa durch innere Erfahrung, der scheint Gott zu versuchen und den Frieden in der Sache, nicht im Glauben haben zu wollen. Je mehr wirst du Frieden haben, je mehr du dem Wort der Verheißung glaubst. Unser Friede ist Christus, nämlich im Glauben (1, 541, 6–9). Jetzt ist Christus unsere Gerechtigkeit und unser Frieden, den Gott uns gegeben hat. Durch diesen hat er uns gerechtfertigt, und so haben wir Frieden. Vor ihm gab es keinen Frieden, weil es auch für uns keine Gerechtigkeit gab, sondern Gottlosigkeit und deshalb Verwirrung. Auch vor den Menschen gibt es Frieden nur für die, die gerecht leben. Denn das bürgerliche Gesetz straft die Ungerechten. Dennoch ist dies kaum eine Figur der Gerechtigkeit und |83|des Friedens, die im Reich Gottes sind, die wahre Gerechtigkeit und der wahre Friede, weil dieser kommt aus der Barmherzigkeit und Wahrheit, die vorangeht, d.h. aus der wahren Gnade und Barmherzigkeit vor Gott (4, 16, 20–28).
4. Wenn die Sünde weg und Gott durch Christus versöhnt ist, so wird dann einmal der rechte und ewige Friede kommen (23, 556, 35f.).
📖 Volker Stümke, Das Friedensverständnis Martin Luthers, 2007. Ders., Krieg und Frieden bei Martin Luther, in: Luther 86 (2015) 148–162.
[Zum Inhalt]
Frömmigkeit
→ Gebet, Gerechtigkeit
Wenn wir auf deutsch sagen: das ist ein frommer Mann, da sagt die Schrift: der ist gerechtfertigt oder gerecht (10I.2, 36, 4–8).
1. Die wahre Frömmigkeit bedarf nicht der Anstrengung, damit sie Frömmigkeit sei (5, 242, 25). Die Vernunft weiß wohl, dass man fromm sein soll und Gott dienen, aber wenn sie soll anzeigen, wie und warum man soll fromm werden oder Gott dienen, da kann sie gar nichts, da ist sie stockblind und spricht: man soll fasten, beten, singen und die Werke der Gesetze tun, und narrt also fortan mit den Werken, bis dass sie so tief kommt, dass sie meint, man diene Gott mit Kirchenbauen, Glockenläuten, Räuchern, Plärren, Singen.Wenn nun das Gnadenlicht kommt, Christus, der lehrt auch: man soll fromm sein und Gott dienen, löscht dasselbe natürliche Licht nicht aus, sondern ficht wider die Art und Weise, die die Vernunft gelehrt hat, fromm zu werden und Gott zu dienen, und spricht: fromm werden sei nicht, die Werke tun, sondern an Gott zuvor ohne alle Werke glauben und dann Werke tun, und ohne Glauben sei kein Werk gut (10I.1, 205, 4–21). Fromme Leute machen gehört dem Evangelium nicht zu, sondern es macht nur Christen. Es ist viel mehr ein Christ zu sein, als fromm zu sein, es kann einer wohl fromm sein, aber nicht ein Christ. Ein Christ weiß von seiner Frömmigkeit nichts zu sagen, er findet in sich nichts Gutes noch Frommes, soll er fromm sein, so muss er sich nach einer anderen und fremden Frömmigkeit umsehen (10I.2, 430, 30–35). Man muss unterscheiden die zwei Regimente oder zweierlei Frömmigkeit, eine hier auf Erden, welche Gott auch geordnet und unter die Zehn Gebote gestellt hat, und die heißt eine weltliche oder menschliche Gerechtigkeit und dient dazu, dass man hier auf Erden untereinander lebe und brauche der Güter, die uns Gott gegeben hat. Über diese äußerliche Frömmigkeit hinaus ist nun eine andere, die nicht auf Erden zu diesem zeitlichen Leben gehört, sondern allein vor Gott gilt und uns führt und erhält in jenes Leben nach diesem. Das ist die, die man heißt Gottes Gnade oder Vergebung der Sünde, welches ist nicht eine irdische, sondern himmlische Gerechtigkeit, nicht unseres Tuns und Vermögens, sondern Gottes Werk und Geschenk (29, 564, 23–569, 38). Unsere Frömmigkeit vor Gott heißt Vergebung der Sünde (29, 572, 20).
2. Ursprung: Das Frommwerden fängt nicht mit eigenem Tun an, sondern mit dem Evangelium, das muss gepredigt und gehört werden (10I.2, 29, 5–31). Christus kommt, dass er dich fromm mache durch sich selbst und seine Gnade, deine Frömmigkeit soll nicht dein Tun, sondern seine Gnade und Gabe sein (10I.2, 36, 10–21; vgl. 233, 20–25).
|84|3. Der Glaube des Herzens ist das Haupt und das ganze Wesen der Frömmigkeit (7, 26, 27f.), so dass allein der Glaube ohne alle Werke fromm, frei und selig macht (7, 23, 27f.; vgl. 35, 20–22; 321, 8). Also macht einen niemand fromm als der Glaube, und nichts macht einen böse als der Unglaube (10I.2, 340, 16f.). Darum will Gott haben, dass wir ganz an uns verzagen und uns allein der Güter vermessen, die er hat, und auf den Grund bauen lassen, welchen keine Kreatur kann umstoßen, dass sich keiner auf seine eigene Frömmigkeit, sondern auf Christi Gerechtigkeit verlasse und auf alles, was Christus hat (12, 312, 36–313, 3).
4. Kein äußerliches Ding kann frei noch fromm machen, denn Frömmigkeit und Freiheit sind nicht leiblich noch äußerlich (7, 21, 20–23). Der Mensch hat zwei Naturen, Leib und Seele, in welchen er muss fromm sein. Es ist doch eine andere Weise nach dem Leib allein fromm werden, wie die tun, die viel wirken, beten, fasten und das außerhalb des rechten Glaubens und Zuversicht zu Christus (7, 239, 17–21).
5. Falsche Frömmigkeit ist, dass man lehrt, wie man soll fromm werden mit Werken, und einen Gottesdienst aufrichtet nach unserer Vernunft. Darum ist die menschliche Frömmigkeit reine Gotteslästerung und die allergrößte Sünde, die ein Mensch tut. Also ist das, was die Welt für Gottesdienst und Frömmigkeit hält, vor Gott ärger als jede andere Sünde (12, 291, 33–292, 5). Was das beste in der Welt ist, das sie für Frömmigkeit und Heiligkeit hält, das nichts ist als bloß Sünde und verdammtes Wesen (12, 546, 26f.).
📖 Martin Nicol, Meditation bei Luther, 1984. Peter Zimmerling, Die Spiritualität Martin Luthers als Herausforderung, in: LuJ 73 (2006) 15–40.
[Zum Inhalt]
Fühlen
→ Affekt, Erfahrung
1. Wir fühlen unsere Sünde und den Zorn Gottes, der uns erschreckt (17I, 295, 13–36). In diesem Fühlen und der Erkenntnis der Sünde liegt das Reich Christi, so dass in den Sünden keine Sünde sei, das heißt, obwohl ich die Sünde fühle und erkenne, ist dennoch das Heil und das Reich so stark da im Gewissen (17I, 296, 26–29). Natur will fühlen und gewiss sein, ehe sie glaubt. Gnade will glauben, ehe sie fühlt (10I.1, 611, 19f.). Es kann die Natur nicht anders tun noch sich schicken, als wie sie fühlt. Nun sie aber Gottes Zorn und Strafe fühlt, hält sie nichts anderes von Gott denn als einem zornigen Tyrannen, kann sich nicht über solchen Zorn schwingen oder über solches Fühlen springen und gegen Gott zu Gott dringen und rufen. Aber das kann die Natur auch nicht lassen, sie will immer etwas mitbringen, was Gott versöhne und findet dann nichts. Denn sie glaubt und weiß nicht, dass allein das Rufen genug sei, Gottes Zorn zu stillen (19, 223, 12–28).
2. Der Art ist der Glaube, dass er gar nichts fühlt, sondern nur den Worten folgt, die er hört und daran hängt. Glaubt er es, so hat er es (12, 565, 25f.). Das Reich des Glaubens, welches man nicht greift noch fühlt, welches niemand dem anderen zeigen kann oder ansehen, sondern jeder Mensch bei sich selbst haben muss, auf dass, wenn er die Sünde fühlt und der Tod vor die Augen kommt, dass er dann das Reich im Glauben fühle und denke, du hast Vergebung der Sünde. Es ist ein kurzes Wort, wird |85|bald geredet, wird aber nicht gefühlt, ja man fühlt wohl allerwegen das Widerspiel (17I, 296, 13–24). Darum müssen wir lernen, dass die Güte und Gnade nicht sichtbar ist, sondern das Kreuz und Widerspiel ist sichtbar, das fühlen wir (31I, 248, 29f.). Das ist des Glaubens hohe Kunst und Kraft, dass er sieht, was nicht gesehen wird, und sieht nicht, was doch gefühlt wird, ja das da drückt und drängt, gleich wie der Unglaube nur sieht, was er fühlt, und gar nicht hangen mag an dem, was er nicht fühlt (17II, 105, 15–19). Menschenweisheit und Vernunft können nicht höher noch weiter kommen als richten und schließen, wie sie vor Augen sehen und fühlen oder mit Sinnen begreifen, aber der Glaube muss über und wider solches Fühlen und Verstehen schließen und haften an dem, was ihm vorgetragen wird durchs Wort. Das kann er aus Vernunft und menschlichem Vermögen nicht tun, sondern ist des heiligen Geistes Werk im Herzen (36, 493, 4–9; vgl. 494, 13–27). Wenn es nach dem Fühlen gelte, so wäre ich verloren, aber das Wort soll über mein und aller Welt Fühlen gelten und wahr bleiben, wie gering es auch scheint und dazu schwächlich von uns geglaubt wird (36, 497, 19–22). Der Glaube Christi ist eine sehr schwierige Sache, da er wegreißt und wegführt von allem, was man innerlich und äußerlich fühlt, in das, was man weder innen noch außen fühlt, d.h. in den unsichtbaren, höchsten, unerkennbaren Gott (57III, 144, 10–12).
📖 Birgit Stolt, Gefühlswelt und Gefühlsnavigierung in Luthers Reformationsarbeit, 2012.
[Zum Inhalt]
Furcht
→ Angst, Sorge
Furcht Gottes, Verehrung Gottes, Religion, Frömmigkeit sind dasselbe (31I, 51, 2). Gott fürchten heißt im Hebräischen eigentlich das, was wir im Deutschen heißen Gott dienen und Gottesfurcht, Gottesdienst. Nun kann man Gott nicht sichtbar und leiblich dienen auf Erden, denn man sieht ihn nicht, sondern geistlich, wenn man sein Wort ehrt, lehrt, bekennt und danach lebt und tut (31I, 89, 25–29).
1. Es ist zu unterscheiden der Schrecken vor Gott von der Furcht. Die Furcht ist die Frucht der Liebe, der Schrecken der Keim des Hasses. Also darf Gott gegenüber kein Schrecken empfunden werden, sondern Furcht, damit nicht, was geliebt werden soll, gehasst wird. Denn die Natur des Schreckens ist zu fliehen, zu hassen, zu verachten. Aber unter Furcht Gottes wird besser die Ehrerbietung verstanden (1, 39, 16–28). Es gibt drei Grade der Furcht: Der erste Grad fürchtet Gott wegen eines anderen, der zweite fürchtet Gott gemischt wegen Gott und wegen eines anderen, der dritte fürchtet Gott rein wegen Gott. Also teilt der erste die Liebe und die Furcht, d.h. indem er etwas liebt, was er nicht fürchtet, und Gott fürchtet, den er nicht liebt. Der dritte fasst im selben Gott beides zusammen, also Liebe und Furcht. Der zweite und mittlere mischt beides miteinander. So teilt die knechtische Furcht immer die Seele in zwei Teile, d.h. in das, was liebt, und das, was fürchtet, die sohnhafte aber hat nur eines, was liebt und fürchtet (1, 43, 26–33). Einer fürchtet Gott um Gottes willen und tut das Beste und vermeidet möglichst das Böse. Ein anderer fürchtet Gott um Gottes willen und zugleich um der Strafe willen und tut weniger Gutes und Vollkommenes. Ein weiterer fürchtet Gott nur um der Strafe willen und tut das Gute nur zum äußeren Schein. Der erste ist |86|Sohn, der zweite in der Mitte zwischen Sohn und Knecht, der dritte ist Knecht. Der erste ist vollkommen, der zweite fortschreitend, der dritte anfangend. Die erste Furcht heißt sohnhaft, heilig, ewig, die zweite anfänglich und gemischt, die dritte knechtisch und erzwungen. Die erste reinigt das Herz, die zweite teils das Herz, teils den Leib, die dritte den Leib. Wie die Furcht ist, so sind auch die Werke, die folgen. Jede Furcht aber stammt aus Liebe, aber die sohnhafte Furcht hat denselben, nämlich Gott, den sie fürchtet und liebt, die zweite teilt die Furcht und die Liebe auf, die dritte teilt schlecht auf, da sie etwas anderes liebt als Gott (1, 115, 12–29). Solange der alte Mensch lebt, soll die Furcht, das ist sein Kreuz und Tod, nicht aufhören und das Gericht Gottes nicht vergessen, und wer ohne das Kreuz und ohne Furcht und ohne Gottes Urteil lebt, der lebt nicht recht (1, 207, 33–36). Die Furcht ist selbst Frömmigkeit, das Haupt und Prinzip der Weisheit und Frömmigkeit (5, 44, 4f.). Unglaube ist ohne Furcht, der Glaube bringt die Furcht Gottes hervor (57III, 19, 22).
2. Je mehr die Trennung zwischen Furcht und Liebe überwunden wird zur Einheit von Furcht und Liebe, desto besser werden die Werke. Denn wenn Furcht und Liebe verbunden werden, machen sie einen neuen Menschen, getrennt aber den alten. Die anfangen, beides zu verbinden, sind ein Mittleres zwischen altem und neuem, also ein Mensch, der fortschreitet von der Knechtschaft zur Freiheit, vom Buchstaben zum Geist, vom Tod zum Leben, von Mose zu Christus (1, 116, 3–7). Gottesfurcht ist, dass der Mensch auf sich selbst und auf seinem Ding nicht steht, vermisst sich weder seiner Ehre, Gewalt, Reichtum, Stärke, Gunst, Kunst, ja auch nicht seiner guten Werke noch guten Lebens, sondern sorgt in allem, dass er nicht sündige (10I.1, 290, 21–291, 2). Wer Gott fürchtet, der wird Gutes tun, er tue, was er will und mag. Seine Werke sind gut, nicht um der Werke willen, sondern um der Furcht willen (10I.1, 294, 3–6).
3. Christus hat noch nie mit Furcht die Sünder gezwungen zur Buße (8, 277, 32f.). Die Furcht des Herrn ist notwendig, aber die sohnhafte, denn ohne Liebe ist es unmöglich, seine Bekehrung zu ertragen, in der der Sünder erschreckt, zugrunde gerichtet und erniedrigt wird (2, 363, 13–15). Wenn nicht die Furcht, die eine wahre Buße verhindert, durch die eintretende Liebe vertrieben würde, würde nicht wahrhaft gebüßt (2, 364, 1f.). Nicht in der Furcht der Strafe, sondern in der Furcht Gottes muss gebeichtet werden, weil jener ein Knecht, der nicht im Haus bleibt, wäre, dieser aber ein Sohn und Erbe (2, 364, 13–18). Es muss die Furcht aufhören und eine Lust anfangen zur Gerechtigkeit (10I.2, 110, 31–111, 8).
4. Christus befreite uns von der Knechtschaft der Sünde, indem er die Furcht des Todes aufhob, und dadurch vernichtete er den, dem wir nur durch die Furcht des Todes unterworfen waren. So werden wir vom Teufel befreit, nicht dass er nicht mehr wäre, sondern dass er nicht mehr gefürchtet wird, und so vom Tod, nicht dass er nicht mehr wäre, sondern dass er nicht mehr gefürchtet wird (57III, 135, 6–11). Von der Furcht des Todes kann weder die Natur noch das Gesetz uns erlösen, ja, sie mehren alle beide die Furcht; allein Christus hat uns davon erlöst, und wenn wir an ihn glauben, so gibt er den freien unerschrockenen Geist, der weder Tod noch Hölle fürchtet, weder Leben noch Himmel liebt, sondern frei und selig Gott dient (10I.1, 455, 17–23). Darum sollen wir uns nicht fürchten vor der Gewalt, sondern Glück und gute Tage sollen wir fürchten, die möchten uns mehr schaden als Angst und Verfolgung, sollen uns auch nicht fürchten vor der Weisheit und Klugheit der Welt, denn sie kann uns nicht schaden (10I.2, 422, 7–10).
|87|5. Dass sich Gott über alle erbarme und allein aus Gnade rechtfertige, das ist die rechte christliche Lehre, dadurch ein Mensch lernt Gott fürchten und trauen, daher er Gott lieben und loben kann, dass er an ihm selbst verzweifle und an Gottes Gnade alles Guten sich vermesse (7, 445, 23–26). Wir sollen Gott über alle Dinge fürchten, lieben und vertrauen (301I, 354, 2).
📖 Albrecht Beutel, ‚Gott fürchten und lieben‘. Luthers Katechismusformel, in: ThLZ 121 (1996) 511–524. Carl Stange, Luthers Gedanken über die Todesfurcht, 1932. Thorsten Dietz, Der Begriff der Furcht bei Luther, 2009.
[Zum Inhalt]
Gabe
→ Geist, Gnade
1. Christus: Wir sind gewiss, dass Christus uns als Gabe geschenkt ist uns zu helfen. Darin haben wir ein Beispiel, dem Nächsten zu helfen und ihm Gabe und Beispiel zu sein (10I.1, 14, 5–9). Christus wird in den Evangelien als eine Gabe und als ein Exempel vorgestellt. Als eine Gabe wird er empfangen durch den Glauben, als ein Exempel in dem, dass wir ihm nachfolgen sollen (21, 148, 21–24). Die Werke Christi sind uns zur Gabe und Gut geschenkt, daran soll der Glaube sich hängen und darin üben (10I.2, 22, 7f.).
2. Mensch: Solche Gaben, die Gaben des heiligen Geistes oder geistliche Gaben heißen, soll man in der Christenheit gebrauchen als gute Haushalter der mancherlei Gnaden Gottes, damit wir wissen, dass sie uns aus Gnaden gegeben sind, nicht dazu, dass wir uns derselben sollen erheben, sondern dass wir damit sollen Vorsteher sein des Hauses Gottes, das ist seiner Kirche, und dass darum die Gaben mancherlei und so ausgeteilt sind, dass nicht einer allerlei, sondern einer andere Gaben, Amt oder Beruf hat als der andere und so miteinander verknüpft und verbunden, dass wir einander dienen müssen (21, 419, 1. 9). Wer in höherem Stand Gaben besitzt und mit Werken nach Gottes Berufung dient, der soll in der Demut bleiben, nicht andere verachten, sondern wissen, dass er darum nicht vor Gott besser ist und mehr gilt, weil er größere Gaben hat, sondern desto mehr schuldig ist, anderen damit zu dienen, und dass Gott auch durch die, die geringere Gaben haben, mehr und größeres tun kann (22, 297, 32–37).
3. Der Glaube ist die Gabe und das innere Gut, das der Sünde entgegengesetzt ist, die sie austreibt. Aber die Gnade Gottes ist das äußere Gut, die Gunst Gottes, dem Zorn entgegengesetzt (8, 106, 20–22). Der Glaube bringt mit sich als ein Hauptgut die anderen Gaben, aber wir haben solche Gaben nicht verdient, sondern sie sind durch die Gnade Gottes nach dem Glauben gegeben (17II, 38, 12–20). Die Gaben sind ungleich, aber das Gut des Glaubens ist gleich (17II, 15, 9–13). Der Glaube an Christus ist nicht ein schläfriger müßiger Gedanke im Herzen, sondern eine Gabe und Werk des heiligen Geistes in uns, der uns wandelt und neue Menschen macht, eine unaussprechliche Gnade Gottes, durch Christus erworben und geschenkt (23, 719, 22–25).
4. Es ist nicht genug, viele besondere Gaben zu haben, sondern es gehört auch die Gnade dazu, dass es Gott wohlgefalle, Segen und Glück dazu gebe, dass der Mensch |88|mit solchen Gaben wohl und nützlich der Kirche diene und etwas Gutes stifte. Solche Gnade wird nicht gegeben denen, die nicht im Glauben und nach Gottes Wort und Befehl ihres Berufs warten (21, 419, 32–37).
5. Sakrament: Das Wort im Abendmahl ist das ganze Evangelium, so dass es nichts vom Opfer noch Werk lautet, sondern von einem Geschenk und einer Gabe, die Christus uns anbietet und gibt und wir sie nehmen und mit dem Glauben fassen und behalten sollen (11, 442, 13–16).
📖 Oswald Bayer, Gabe II. Systematisch-theologisch, in: RGG 4. Aufl., 2000, 445f. Ingolf Dalferth, Mere passive. Die Passivität der Gabe bei Luther, in: Bo Kristian Holm / Peter Widmann, Hg., Word – Gift – Being, 2009, 43–71. Bo Kristian Holm, Gabe und Geben bei Luther, 2006. Ragnar Skottene, Grace and Gift, 2008.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.