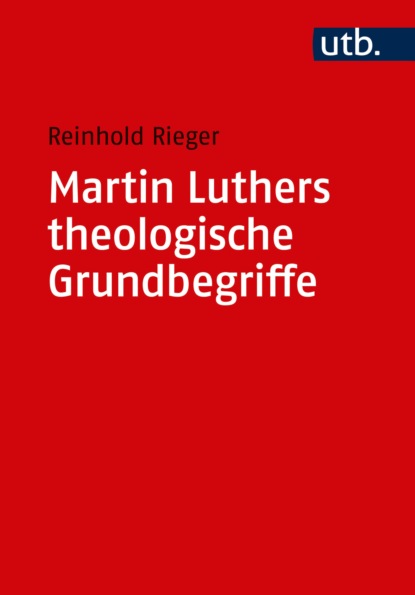- -
- 100%
- +
📖 Oswald Bayer, Luthers Theologie, 3. Aufl. 2010. Peter Schwanz, Der neue Mensch, 1992.
[Zum Inhalt]
Amt
→ Beruf, Dienst, Pfarrer, Priester
1. Wesen: Amt ist zuerst Dienst. Christus hat keine Macht mitgeteilt, sondern das brüderliche Amt der Liebe angewiesen (2, 632, 13f.). Alle Christen dienen Gott, aber sie sind nicht alle im Amt (10I.2, 122, 9–22). Wer das Amt zu lehren hat, kann sagen, dass dieses Amt, wenn es sich auf das Wort Gottes bezieht, heilig ist vor Gott (25, 242, 14–16). Christus muss so in uns wirken, dass er uns den heiligenden Geist mitteilt und den Glauben schenkt, durch den wir befähigt werden, dem Nächsten zu dienen und freudig unserem Amt zu obliegen, zu dem uns Gott berufen hat (27, 472, 18–21).
2. Die Unterscheidung zwischen Würde und Amt ist juristisch, nicht theologisch (2, 636, 34f.). So kann bei den Aposteln nicht zwischen ihrer Apostelwürde und ihrem Apostelamt unterschieden werden und sie sind in Amt und Würde gleich. Dennoch ist das kirchliche Amt keine Würde (12, 390, 3–12). Wie auch immer die Person der Apostel sein mag, ihr Amt ist bei allen gleich: sie lehren denselben Christus, haben dieselbe Macht, sind von demselben in gleicher Weise gesandt (2, 471, 35–37; vgl. 452, 16–19). Jeder kirchliche Vorsteher muss zuerst unterscheiden zwischen sich und seinem Amt, d.h. zwischen der Form Gottes und der Form des Knechts und sich selbst als den niedrigsten unter allen ansehen und das Amt zwischen Furcht und Liebe seiner selbst ausführen, damit er durch es nur das Wohl und den Nutzen der Untergebenen suche, so dass er, da er weiß, dass jedes Amt zum Nutzen und Heil der Untergebenen da ist, eher von seinem Amt abgehen müsste, wenn der Nutzen und das Wohl der Untergebenen nicht anders erreicht werden kann oder durch es behindert würde (56, 161, 10–18). Wer den Unterschied zwischen dem Amt und der Person hält, der kann auch recht falsche Prediger und rechtschaffene Prediger unterscheiden (28, 469, 38f.). Obwohl Amt und Person unterschieden werden müssen, sind sie doch voneinander abhängig. Denn es kann wohl ein Amt oder Werk gut und recht sein an ihm selber, das doch böse und unrecht ist, wenn die Person oder Täter nicht gut oder recht ist (19, 624, 18–21). Darum muss man hier Amt und Person unterscheiden, dass man nicht um der Person willen das Amt verwerfe (32, 530, 15f.). Dennoch muss eine Einheit von Person und Amt gegeben sein, wenn nicht das Amt unglaubwürdig werden soll (6, 312. 317. 319; vgl. 19, 630). Es ist deshalb falsch zu sagen, dass Person und Amt nicht ein Ding sind, und das Amt dennoch bleibt und gut ist, obschon die Person böse ist (6, 317, 5–7).
|17|3. Die weltlichen Ämter und Aufgaben dürfen nicht gegenüber den geistlichen und kirchlichen abgewertet werden (10I.1, 310, 9–13; 30III, 505). Denn jedes Amt kommt von Gott (33, 515, 37–41). Auch bei weltlichen Ämtern ist keines besser als das andere, da bei allen der Glaube und Geist gleich ist (17II, 55, 6–11). Ein Grund dafür ist, dass das Gebot der Nächstenliebe vor Gott alle gleich macht und alle Unterschiede der Stände, Person, Amt und Werke aufhebt (17II, 101, 18f.).
4. Die Ämter Christi: Das Amt Christ ist ein doppeltes: richten und rechtfertigen, töten und beleben, verdammen und retten. Durch das Gericht demütigt er die Hochmütigen, durch die Gerechtigkeit erhöht er die Demütigen (5, 299, 22–24). Luther unterscheidet die Person Christi von seinen Ämtern. So wird Christus nach Jes 9,6 Ewigvater genannt nicht seiner Person nach, sondern gemäß seinem Amt, seinem andauernden väterlichen Wirken für uns (19, 159, 21–31; vgl. 45, 294, 28; 295, 26; 52, 476, 22). Christi Amt ist, dass er gesandt ist vom Vater zu uns Menschen, das Werk unserer Erlösung auszurichten (46, 98, 22f.). Dies war ein knechtliches Amt, weil er gesandt war in Dienst und Demut, darin er sich aller seiner göttlichen Herrlichkeit entäußerte (45, 633, 19–21). In der Auferstehung erfährt Christus eine Verwandlung des Amts aus diesem Dienststand zu seiner Herrlichkeit und zu ewigen Regiment (21, 474, 37–39). Es genügt nicht, Christi Person als Gott und Mensch zu kennen, der Glaube richtet sich auch auf das Amt Christi (45, 295, 30–34). Dies tut er zuerst durch seine Predigt: Er ist um keines anderen Amts willen, als zu predigen das Wort Gottes, gekommen (7, 22, 19f.). Christus hat zwei Ämter: Jetzt auf Erden richtet er sein Predigtamt aus, wozu er vom Vater gesandt ist, und das geht seine Menschheit an. Danach geht er zum Vater, dann richtet er das andere Amt aus, dass er uns den heiligen Geist in unsere Herzen sende (10I.2, 283, 29–33). Luther nennt meist das Priestertum und das Königtum die beiden Ämter Christi: Durch sein Königreich und seine Herrschaft beschirmt er uns vor allem Übel in allen Dingen, aber durch seine Priesterschaft beschirmt er uns vor allen Sünden und Gottes Zorn, tritt vor uns und opfert sich selbst, um Gott zu versöhnen (10I.1, 717, 24–718, 2; vgl. 7, 27, 1–16; 10I.1, 720, 14–721, 2; 56, 15–34). Das Priesteramt kann auch als ein dreifaches Amt aufgefasst werden, das von Christus auf die Christen übergeht: Opfer, Gebet, Verkündigung (12, 308, 27–309, 7; vgl. 7, 28, 6–11). Obwohl Christus den Christen seine Ämter übergibt, sind nicht alle Ämter von ihm abgeleitet (11, 258, 14–18).
5. Luther warnt davor, dass wir nicht Gott in sein Amt greifen, der allein rächen und vergelten will (17II, 58, 32f.). Dadurch würde die christliche Freiheit zerstört (18, 112, 15–27; 122, 36f.).
6. Wem das Predigtamt aufgelegt wird, dem wird das höchste Amt aufgelegt in der Christenheit (11, 415, 30f.; 12, 319, 28–32). Es ist begründet in der heiligen Schrift, dass nicht mehr ist, als ein einziges Amt zu predigen Gottes Wort allen Christen allgemein, dass jeder reden, predigen und urteilen möge und die anderen alle verpflichtet sind, zuzuhören (8, 498, 15–21).
7. Berufung in das Amt: Ein Amt darf man sich nicht anmaßen, sondern nur nach der Berufung, in ein geistliches Amt durch die Gemeinde, ausüben (47, 193, 3–7).
8. Grenzen des Amts: Die Vergebung der Schuld steht weder in des Papsts, Bischofs, Priesters noch irgendeines Menschen Amt oder Gewalt, sondern allein auf dem Wort Christi und dem eigenen Glauben, denn Gott wollte nicht unseren Trost, unsere |18|Seligkeit, unsere Zuversicht auf Menschenwort oder -tat bauen, sondern allein auf sich selbst, auf seine Worte und Taten (2, 716, 13–18).
9. Strenge des Amts: Wo wir im Amt und Obrigkeit gehen, da soll und müssen wir scharf und streng sein, zürnen, strafen usw., denn hier müssen wir tun, was uns Gott in die Hand gibt und tun heißt. Bei dem, was außer dem Amt geht, da lerne jeder für sich selbst, dass er sanftmütig sei gegen jedermann (32, 316, 30–34; vgl. 401f.).
10. Auch das Christsein ist ein Amt (45, 540, 2; 609, 13).
📖 Jan Aarts, Die Lehre Martin Luthers über das Amt in der Kirche, 1972. Karin Bornkamm, Christus – König und Priester. Das Amt Christi bei Luther, 1998. Wilhelm Brunotte, Das geistliche Amt bei Luther, 1959. Holsten Fagerberg, Art. Amt VI.1, in: TRE 2, 1978, 553–562. Harald Goertz, Allgemeines Priestertum und ordiniertes Amt bei Luther, 1997. Martin Honecker, Luthers Verständnis des Amtes im ökumenischen Disput, in: Athina Lexutt, Hg., Relationen, 2000, 321–334. Hellmut Lieberg, Amt und Ordination bei Luther und Melanchthon, 1962. Gerhard Müller, Allgemeines Priestertum aller Getauften und kirchliches Amt in der Reformationszeit, in: KD 52 (2006) 98–104. Regin Prenter, Die göttliche Einsetzung des Predigtamtes und das allgemeine Priestertum bei Luther, in: ThLZ 86 (1961) 321–332. Reinhard Schwarz, Martin Luther – Lehrer der christlichen Religion, 2015, 263–287. 479–494. Wolfgang Stein, Das kirchliche Amt bei Luther, 1974.
[Zum Inhalt]
Analogie
Im Griechischen heißt Analogie nach Luther Verhältnis, Vergleich, Gleichnis, Ähnlichkeit (56, 119, 18; 453, 4f.).
1. Analogie ist nicht eine aktive Angleichung durch den Verstand, sondern eine passive in der Sache oder eher keines von beidem, sondern wodurch eine Sache mit der anderen zusammenspielt und ihr angeglichen wird (56, 453, 14–16).
2. Analogie des Glaubens: Nach Paulus muss alles auf dem Glauben aufbauen: Gemäß der Vorschrift Röm 12,7, dass die Prophetie nach der Analogie des Glaubens erfolgte, soll der in der Schrift gegebene Sinn nach dem buchstäblichen Verstand behandelt werden (14, 561, 21–23), damit nicht der Glaube und seine Regeln vernachlässigt werden (56, 119, 18f.). Auf diesen grundlegenden Glaubenssinn kann eine Allegorie aufbauen, die sich aus ihm ableiten muss (16, 68, 25–28). Wer nach Allegorien suchen will, der sehe sich vor, dass er sie auf die Analogie des Glaubens beziehe (16, 214, 3f.; 29, 376, 14f.). Der wahre Verstand und Gebrauch der heiligen Geschichten und ihr Beispiel sollen gemäß der Analogie des Glaubens behandelt werden (30III, 540, 7f.). Alles, was nicht ausdrücklich in der heiligen Schrift gesagt ist und als offenbart gelten soll, muss sich durch Analogie des Glaubens auf die heilige Schrift beziehen und ihren Sinn offenbaren (43, 226, 8f.; vgl. 42, 667, 18–22; 44, 97, 36f.). Die Analogie des Glaubens trägt zur Eindeutigkeit der Interpretation bei (44, 427, 28–31). Christus und die Apostel haben Allegorien nach der Analogie des Glaubens gebraucht und so die Kirche erbaut (42, 367, 33–36; 368, 35f.; 377, 20–22). Auch das Verständnis der Anwesenheit Christi im Abendmahl gründet auf der Analogie des Glaubens, da der Glaube sich auf Unsichtbares bezieht (30III, 132, 4. 26). Die Sprüche und Taten der Heiligen sind der Regel oder Analogie des Glaubens gemäß zu beurteilen (54, 114, 31f.). Wichtiger als das grammatische Verständnis der heiligen Schrift ist ihr Verstehen nach der Analogie des Glaubens (31II, 178, 23–25).
|19|3. Luther warnt auch vor der Analogie weltlicher Dinge für Geistliches: (39II, 94, 11f.). Schon in der Grammatik gebe es ungewöhnlichen Sprachgebrauch, der nicht durch Analogie erklärbar sei (39II, 94, 13f.). Der heilige Geist hat seine eigene Grammatik. Die Grammatik gilt allgemein, aber wenn die Sache größer ist, als sie durch grammatische und philosophische Regeln erfasst werden kann, muss sie beiseite gelassen werden. Nach der Grammatik gilt die Analogie: Christus ist geschaffen. Also ist Christus ein Geschöpf. Aber in der Theologie gilt nichts weniger, denn die Sache ist unaussprechlich und unfassbar (39II, 104, 24–105, 4).
[Zum Inhalt]
Anbetung
→ Bild, Gebet
In der heiligen Schrift heißt anbeten niederfallen, niederknien und Ehre erzeigen (17II, 366, 23–27; vgl. 11, 446, 4–7; 43, 529, 19f.).
Anbetung ist eine Verehrung, die allein Gott gebührt, denn man betet allein das an, das größer ist (10I.1, 173, 15f.). Das Anbeten ist die Ehre des ersten Gebots, die man Gott erweist (38, 35, 2). Allerdings wurden auch weltliche Herrscher angebetet: Dass die Magier Christus anbeten wollen, tun sie in der Meinung, wie die Schrift zeigt, dass in den Morgenländern die Könige angebetet wurden, nicht dass man sie für Götter hielte, sondern das Niederfallen vor ihnen und Ehren heißt die Schrift Anbeten und gibt es gleich Gott und den Menschen (10I.1, 574, 7–10; vgl. 614, 8–13). Man sieht, dass auch im Alten Testament die rechten Abgötter nicht schaden, wenn man gleich vor ihnen äußerlich anbetet, wenn nur der rechte Gott mit dem Herzen angebetet wird (18, 79, 20–22). Es gibt zweierlei Anbeten: Eines äußerlich und leiblich, das andere innerlich und geistlich. Wo äußerliches Anbeten allein ist, da ist Heuchelei und Gottes Spott. Das andere Anbeten ist rechtschaffen und geistlich, das ist in allen äußerlichen Dingen frei, also dass man nicht besondere Örter haben oder besondere Gebärden führen müsse (11, 444, 1–445, 35; vgl. 17II, 367f.). Solches Anbeten ist nichts anderes als der Glaube oder des Glaubens höchstes Werk gegenüber Gott. Wo nicht das herzliche Vertrauen und die Zuversicht des rechten lebendigen Glaubens sind, da kann solches Anbeten nicht geschehen, denn Gott wird dann nicht erkannt mit gläubiger Zuversicht (11, 446, 13–26). Nicht das Anbeten, sondern der Glaube bestimmt die Beziehung zu Gott: Denn das heißt nicht einen Gott haben, ihn äußerlich mit dem Mund Gott zu nennen oder mit den Knien und Gebärden anzubeten, sondern ihm herzlich zu trauen und sich alles Guten, Gnade und Wohlgefallen von ihm zu versehen (6, 209, 27–30). Wer Gott im Unglauben anbetet, der begeht einen Akt des Götzendienstes (7, 231, 19). Wir glauben, dass im Geist anbeten sei, dass wir geistlich oder geistlicher Weise anbeten sollen, Christus sei gleich im Himmel, auf Erden oder im Sakrament oder wo er wolle. Denn das geistliche Anbeten setzt Christus gegen das leibliche Anbeten, das die Heuchler an Stätte und Zeit binden, so dass es äußerlicher Weise, wie die Stätte und Zeit bestimmt, geschehen muss, als hätte das Gebet sein Wesen, Kraft, Leben und alle Tugend von der Stätte oder Zeit (26, 427, 31–37). Die Frömmigkeit auf äußerliche Dinge zu beziehen, das heißt an Gottes statt sitzen und sich anbeten lassen, wie der Papst tut (9, 619, 12f.). Auch die Ablehnung äußerlicher |20|Anbetung schließt die innere Anbetung nicht aus (16, 462, 31–33). Die Werkheiligen, die sich der Gaben, die sie von Gott empfangen haben, rühmen, machen einen Abgott daraus und beten sich selbst an (1, 358, 5–7; 22, 200, 1f.). Aber Christus als Retter zu erkennen und seine Hand zu küssen, das ist wahrhaft das wahre Anbeten (5, 73, 23f.). Gott verehren, fürchten, erkennen, ihm vertrauen, alle Hoffnung auf ihn setzen, ihm folgen, seinem Ruf gehorchen, das ist wahres Anbeten (40III, 299, 11–14).
📖 Friedrich Lezius, Die Anbetung Jesu neben dem Vater, 1892.
[Zum Inhalt]
Andacht
→ Anbetung, Betrachtung, Gebet
„Andacht“ heißt bei Luther noch oft Meinung, Bestreben, Überlegung, aber auch frommes Bemühen und gottesdienstliche Aktivität.
1. Die rechte Andacht ist der Glaube, der sich auf das Wort Gottes verlässt. Alle andere Andacht ist lauter Trügerei und Irrtum (2, 128, 1f.; 6, 235, 17–20). Zum Empfang des Sakraments ist nicht nur der gute Antrieb notwendig, der im erworbenen Glauben oder einer Andacht besteht, sondern der beständige, durch die Gnade Gottes eingegossene Glaube, der das Herz dazu bewegt, die Sache des Sakraments zu begehren und wirklich zu erhoffen (6, 91, 38–92, 1). Maria lehrt, dass, je größer die Andacht im Geist ist, je weniger Worte zu machen sind (7, 571, 22).
2. Luther warnt öfters vor selbstbezogener Andacht: Es soll sich niemand vornehmen, einen eigenen Weg zu Gott machen, durch seine eigene Andacht oder Werk (10I.1, 356, 1f.). Was einer selbstbezogenen Andacht entspringt, ist die reinste Lüge und Wahn und gilt nichts vor Gott (14, 394, 9; 16, 175, 18–22; 24, 389, 26–28; 33, 275, 15–29; 323, 12–15; 46, 589, 35–37; 768, 7f.; 780, 10–34). Der heilige Geist kommt nicht zu uns durch unsere Andacht (47, 642, 25). Die neuen Stücke, die in der neuen Kirche des Papsts aufgekommen sind, sind alle ohne Gottes Wort, das ist, ohne Wahrheit und Leben, allein aus menschlicher Andacht oder Gutdünken erdichtet worden (51, 515, 20–23). Niemand denke, dass Gottes Wort auf Erden komme aus eigener Andacht. Soll es Gottes Wort sein, so muss es gesandt sein. Es ist unmöglich, dass die heilige Schrift könne verstanden oder ausgelegt werden aus eigener Andacht und Willkür. Denn es ist ein großer Unterschied zwischen dem Wort, das vom Himmel gesandt ist, und dem, das ich aus eigener Wahl und Andacht erfinde. Darum müssen wir lernen, unsere Seligkeit zu setzen auf die Kraft des Gottes Wortes und nicht auf unsere Andacht (47, 193, 11–38).
3. Luther berichtet über das Paradox seiner eigenen Frömmigkeit: Er habe ein heiliger, frommer Mönch sein wollen und sich mit großer Andacht zur Messe und zum Gebet bereitet, aber wenn er am andächtigsten war, so ging er als ein Zweifler zum Altar, als ein Zweifler ging er wieder davon, hatte er seine Buße gesprochen, so zweifelte er doch, hatte er sie nicht gebetet, so verzweifelte er aber, denn die Mönche waren schlicht in dem Wahn, sie könnten nicht beten und würden nicht erhört, wenn sie nicht ganz rein und ohne Sünde wie die Heiligen im Himmel wären (22, 305, 35–306, 3; vgl. 51, 21, 1–8).
[Zum Inhalt]
|21|Anfechtung
→ Verzweiflung, Zweifel
1. Wesen: Anfechtungen werden in der heiligen Schrift eigentlich das Kreuz Christi genannt (56, 301, 20f.). Das ganze Leben ist nichts als Anfechtung von Fleisch, Welt, Teufel (30I, 107, 32f.; vgl. 106, 34; 6, 17, 29f. 225, 14f.; 16, 11; 208, 25–28). Die Anfechtung ist eine doppelte: erstens körperlich, worin die Fleischlichen versagen, die wegen fleischlicher Güter in den Dingen, dem Leib, dem Ruhm versagen und von Gott abfallen. Die andere ist die geistliche des Gewissens, wo durch die eigene Gerechtigkeit und Weisheit alles verschlungen und aufgesaugt wird, worauf sie vertrauen (56, 306, 9–16). Denn wen der Teufel mit Armut, Mangel und Elend nicht überwinden kann, den greift er an mit Reichtum, Gunst, Ehre, Lust, Gewalt und ficht auf beiden Seiten wider uns (17II, 195, 26–27). Nach dem Urteil aller Frommen und dem Zeugnis der Erfahrung ist es aber die größte Anfechtung, keine Anfechtung zu haben (3, 420, 16f.), denn dann bestehe die Gefahr, dass der Mensch Gott vergesse und missbrauche die glückselige Zeit (6, 223, 33–35; 236, 16–20). Nicht glauben zu wollen und alles in Zweifel zu ziehen und so eine neue Lehre zu erwarten, das ist die schwerste Anfechtung (3, 578, 38f.). Die schwerste und höchste Anfechtung, mit der Gott zuweilen seine Heiligen angreift und übt, ist das Gefühl, von Gott und seiner Gnade verlassen zu sein (17II, 20, 31–38). Die größte Anfechtung ist die durch den Teufel, der Glaube, Hoffnung und Liebe bekämpft, damit das Misstrauen, dass Gott nicht barmherzig sei, angreift, wenn der Mensch zu zweifeln beginnt, ob Gott sei usw. Daraus folgt die Verzweiflung. Diese Versuchung ist die schwerste, da sie den Menschen zum Gotteslästerer macht (30I, 16, 26–29; vgl. 17II, 193–195).
2. Der Grund für die Anfechtung ist, dass der Mensch sich und Gott erkennen lerne, sich erkennen, dass er nichts vermag, als sündigen und Übel tun, Gott erkennen, dass Gottes Gnade stärker sei als alle Kreaturen, und er so lerne sich verachten und Gottes Gnaden loben und preisen (2, 125, 18–22). Durch die Anfechtung wird der Mensch dazu gedrängt, zu Gott zu laufen und ihn anzurufen (6, 223, 16–19). Wir müssen die Anfechtung annehmen als eine Reizung und Vermahnung zu beten, fasten, wachen, arbeiten und anderen Übungen, das Fleisch zu dämpfen und den Glauben an Gott zu üben (6, 270, 10–12). Wenn ein Christ anfängt zu glauben, so folgt ihm auf dem Fuß nach die Anfechtung und Verfolgung, und wenn das nicht geschieht, so ist es ein Zeichen, dass der Glaube nicht rechtschaffen ist und er das Evangelium nicht recht ergriffen hat (17I, 446, 16–19; vgl. 21, 116, 4–12).
3. Der Sinn der Verwirrung ist unendlich und jede Anfechtung in unserem Affekt ist dauerhaft. Es gibt niemanden, der das Ende der Anfechtung sieht, wenn er im Paroxismus der Anfechtung ist (25, 151, 30–32; vgl. 31II, 110, 30f.; 445, 26–28). Da Gott ewig ist, so ist auch die Versuchung ewig (31II, 549,25). Wie es notwendig ist, dass es Häresien gibt, so muss es Anstachelungen des Fleisches geben, damit die offenbar würden, die bewährt sind, und damit sie immer zum Herrn rufen, wenn sie versucht werden (4, 395, 3–5; 9, 581, 16f.). Es wird kein Christ auf Erden ohne Anfechtung sein: Gott führt uns zur Anfechtung. Wer anfängt, fromm zu werden, wird lernen, dass wir ohne Anfechtung nicht in den Himmel kommen könnten, und so würden wir sie auch überwinden lernen (9, 588, 13–26). Die Anfechtung durch Gott kommt nicht aus unserem Willen, nicht aus Gottes Gebot, sondern aus lauter Gnade, nicht aus Hass, |22|sondern aus Liebe (9, 589, 12f.). Denn alle, die Gott liebt, züchtigt er. Deshalb ist jede Anfechtung ein Zeichen des liebenden Gottes (3, 340,13f.). Gott nimmt niemanden als gerecht an, den er nicht vorher geprüft hat, er prüft nicht anders als durch das Feuer der Anfechtung. Wenn Gott uns nicht durch Anfechtungen prüfte, wäre es unmöglich, dass irgendein Mensch gerettet würde (56, 304, 9–24).
4. Umgang mit Anfechtung: Im irdischen Leben soll man nicht begehren, aller Anfechtung ledig zu sein, sondern dass man nicht falle und wider seinen Nächsten sündige (2, 125, 32–35; 6, 22, 5–10). Man soll die Anfechtung nicht nur fühlen, sondern in sie einwilligen (30I, 209, 27–35).
5. Christus hat zu unserem Trost auch selbst die Anfechtung erlitten und überwunden. Er ist ebensowohl angefochten mit dem Tod, der Sünde, der Hölle wie wir (2, 691, 22–26). Die Gemeinschaft Christi mit uns hat einen Austausch zur Folge: Ihn fechten unsere Sünden an, uns beschirmt seine Gerechtigkeit. Denn die Vereinigung mit ihm macht alles gemeinsam (2, 749, 2f.).
6. Hilfe in Anfechtung: In der Zeit der Anfechtung muss Gott selbst uns zusprechen und mit seinem Wort uns trösten (2, 115, 35f.). Trost und Vertrauen der Gerechten in der Anfechtung ist dies: zuerst, dass Gott lebt und existiert. Zweitens, dass er gegenwärtig ist. Drittens, dass er über alles regiert (55I, 86, 22–24). Man muss den Glauben stärken wider alle Anfechtungen der Sünde, sie seien vergangen, gegenwärtig oder zukünftig (6, 231, 27f.). Wer an Christus glaubt, der soll keinen Mangel leiden und keine Anfechtung soll ihm schaden, sondern er soll genug haben mitten in dem Mangel und sicher sein mitten in der Anfechtung (17II, 189, 2–4).
7. Wirkung der Anfechtung: Nach der Prüfung der Anfechtung ist Gott gnädig (5, 165, 18–20). Am Ende der Anfechtung lehrt und bringt der versuchte Glaube, dass wir schmecken und empfinden, wie süß der Herr sei (8, 379, 14–35). Durch Versuchung und Anfechtung wird der Mensch gebessert, damit er mehr und mehr zunimmt in Glauben und Liebe (8, 385, 10–14; 10I.1, 612, 8–13). Darum müssen das Kreuz und die Anfechtung kommen, damit der Glaube wachse und stark werde (10III, 425, 27f.). Der Glaube übt sich in mancherlei Anfechtungen (10III, 427, 11–13). Der Glaube ohne Anfechtungen schläft und der Glaube ist nie stärker als in den stärksten Anfechtungen (16, 234, 7–11). Nach der Anfechtung, wenn der Mensch versucht und bewährt ist, wird er nicht allein mit Gaben der Weisheit und Verstands erfüllt, sondern auch mit dem Geber solcher Gaben, dem heiligen Geist selbst, und ganz vollkommen gemacht und lehrt andere mit Weisheit und Verstand und hilft ihnen geistlich (10I.1, 302, 11–303, 3).
8. Obwohl der Glaube durch Anfechtung geübt wird, wird er durch sie auch geschwächt: Der Glaube ist nicht allezeit gleich fest, sondern zuweilen angefochten und schwach (54, 33, 9f.). Denn der böse Geist ficht nichts so sehr an als den Glauben (10I.1, 95, 2f.). Deshalb gilt für den Ungläubigen die Umkehrung der paulinischen Aussage, dass Anfechtung Geduld wirke: Die Anfechtung bewirkt Ungeduld, die Ungeduld Schlechtigkeit, die Schlechtigkeit aber Verzweiflung, die Verzweiflung dann die ewige Verwirrung (56, 303, 2–5).
📖 Horst Beintker, Die Überwindung der Anfechtung bei Luther, 1954. Sven Grosse, Anfechtung und Verborgenheit Gottes bei Luther und Paul Gerhardt, in: Paul Gerhardt und der ‚andere‘ Luther, 2008, 13–32. Otto Hof, Luther über Trübsal und Anfechtung, 1951. Marcel Nieden, Anfechtung als |23|Thema lutherischer Anweisungsschriften zum Theologiestudium, in: ders., Hg., Praxis Pietatis, 1999, 83–102. Friedrich Karl Schumann, Gottesglaube und Anfechtung bei Luther, 1938. Reinhard Schwarz, Martin Luther – Lehrer der christlichen Religion, 2015, 361–380. Michael Weinrich, Die Anfechtung des Glaubens, in: Christof Landmesser, Hg., Jesus Christus als die Mitte der Schrift, 1997, 127–158.
[Zum Inhalt]
Angst
→ Furcht, Sorge
1. Wesen: Angst ist eine Enge und Beklemmung in der Anfechtung (56, 196, 26; vgl. 5, 101, 12–15). Der Mensch ist Tyrannen unterworfen, unter welchen er große Not und Angst leidet: der Teufel, das Fleisch, die Welt, die Sünde, das Gesetz und der Tod mit der Hölle, von welchen allen das Gewissen unterdrückt wird (10I.2, 27, 9–14). Wenn der Mensch aus den Geboten sein Unvermögen gelernt und empfunden hat, so dass ihm Angst wird, wie er dem Gebot genug tue, da das Gebot erfüllt sein muss oder er verdammt wird, so ist er recht gedemütigt und zunichte geworden in seinen Augen, findet nichts in ihm, womit er möge fromm werden. Dann kommt das andere Wort, die göttliche Verheißung und Zusagung (7, 24, 5–10; vgl. 8, 8, 35–9, 2). Wir müssen lernen, dass jeder Christ, wenn er getauft ist und sich zu Christus begeben hat, sich auch darein schicken soll, dass ihm auch begegnen wird Schrecken und Angst, die ihm das Herz verzagt machen (45, 470, 11–14; vgl. 46, 104, 35). Die heilige Schrift sagt, dass das christliche Leben durch Angst zunehmen und von diesem Leben zu dem anderen kommen muss (17I, 195, 34f.).