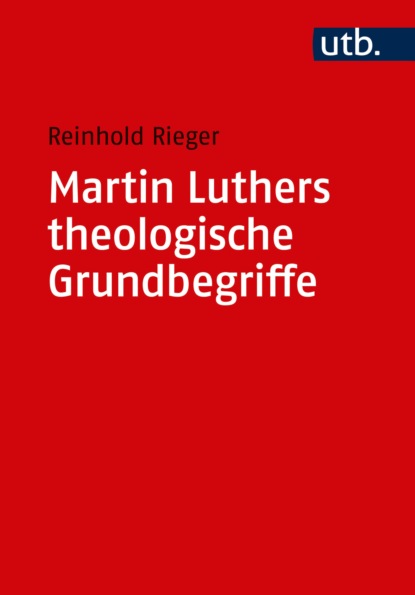- -
- 100%
- +
2. Hilfe gegen die Angst: Wer in Angst und Widerwärtigkeit kommt und ein neuer Mensch wird, der halte nur stille und lass Gott mit sich machen, der wird es wohl machen ohne irgendein menschliches Zutun (10I.2, 255, 39–256, 2). Gott lässt den Menschen in solcher Angst so tief fallen, dass gar kein Rat noch Hilfe mehr da ist, und will doch, dass wir nicht verzweifeln sollen, sondern dem vertrauen, der aus einem unmöglichen Ding ein mögliches und aus nichts etwas machen kann (10I.2, 386, 19–23). Aus aller Not und Angst herauszukommen ist es notwendig, die Sünden frei zu bekennen. Man muss die Sinne von der Angst kehren und am meisten die Sünde ansehen (19, 215, 1–16). Wir sollten uns daran gewöhnen, sobald uns eine Angst und Not zustößt, nur auf die Knie zu fallen und Gott die Not vorzulegen, nicht mit unseren eigenen Gedanken Hilfe zu suchen (32, 491, 29–32). Darum wird der heilige Geist niemand gegeben als denen, die in Betrübnis und Angst stehen, da schafft das Evangelium Nutzen und Frucht (12, 574, 2f.; 21, 443, 18–20). Das ist sehr tröstlich allen Christen, dass sie wissen: schreien sie in ihrer Angst und Not zu Gott, so wird er sie erhören und aus der Verfolgung erlösen (16, 11, 21–22).
3. Angst Christi: Das Evangelium ist eine Predigt und fröhliche Botschaft, wie Christus für uns in die Angst des Todes getreten ist, alle Sünde auf sich genommen und sie ausgelöscht hat (10I.2, 236, 27–29).
📖 Thorsten Dietz, Martin Luthers theologischer Umgang mit Angsterfahrungen, in: Luther 82 (2011) 88–98. Jakob Knudsen, Angst – der junge Mann Luther, 1914.
[Zum Inhalt]
|24|Annehmen
1. Während für mittelalterliche Theologen die Annahme des Menschen durch Gott entweder dessen Willkür unterworfen war oder bestimmte Bedingungen erforderte, nimmt für Luther Gott den Menschen bedingungslos aus reiner Gnade an: Die Sünder hat Gott durch Christum angenommen (1, 203, 22). Gott nimmt nicht die Person wegen der Werke, sondern die Werke wegen der Person an, also die Person vor den Werken (56, 268, 4–6). Nicht ihre Verdienste sind es, sondern die Christi in ihnen, wegen derer Gott ihre Werke annimmt, die er anders nicht annehmen würde (56, 290, 16–18). Jede gute Handlung ist von Gott angenommen durch die Vergebung und durch Barmherzigkeit. Dasselbe aber ist abgelehnt, also Sünde, insofern es eine Handlung aus der Bosheit des Fleisches ist. Es gibt keine Handlung, die Gott schlechthin akzeptiert, sondern er verzeiht jede unserer Handlungen und schont uns. Wenn er also verzeiht, nimmt er nicht an oder lehnt ab, sondern er verzeiht, und so nimmt er seine Barmherzigkeit in unseren Werken an, d.h. die Gerechtigkeit Christi für uns (1, 370, 17–28). Ohne das göttliche Verzeihen wäre niemand von Gott angenommen (2, 420, 19). Die Formalursache der Rechtfertigung und unseres Heils ist das göttliche Erbarmen, die Anrechnung und Annahme durch Gott (39I, 228, 7–9). Gott nimmt keine Werke an, sondern den Glauben, der die in Christus verheißene Barmherzigkeit ergreift (39I, 238, 4f.; 40I, 233, 16–24).
2. Christus hat menschliche Natur angenommen, die sterblich und dem schrecklichen Zorn und Gericht Gottes wegen der Sünde des menschlichen Geschlechts unterworfen ist, welchen Zorn das schwache und sterbliche Fleisch in Christus gefühlt und erlitten hat (46, 632, 23–26). Denn er ist darum in die Welt gekommen, hat unsere menschliche Natur angenommen, dass er uns vom Zorn erlöste und zu Kindern Gottes machte und dass wir seine Fülle genießen sollten (46, 650, 14–16).
3. Christus soll von den Menschen im Glauben angenommen werden (10I.2, 204, 8f.). Christus kommt durch das Evangelium in unser Herz, er muss auch mit dem Herzen angenommen werden (10III, 349, 32f.). Die Christus annehmen, die sollen die Gerechtigkeit und Gewalt haben, dass sie sich rühmen können, Kinder Gottes zu sein (46, 621, 40–622, 1).
4. In den Sachen, die der Seelen Seligkeit betreffen, soll nichts als Gottes Wort gelehrt und angenommen werden (11, 263, 5f.; vgl. 33, 161, 25–30).
5. Das Leiden muss um Christi willen angenommen werden: Weil Christus selbst gelitten hat, ist das Leiden zu köstlich geworden, dass seiner niemand würdig ist, und es ist für eine große Gnade anzunehmen und anzubeten (8, 382, 2–4).
📖 Werner Detloff, Die Lehre von der acceptatio divina bei Johannes Duns Scotus, 1954. Richard Ellsworth Gillespie, Gratia creata and Acceptatio divina in the theology of Robert Holcot, 1974.
[Zum Inhalt]
Antichrist
Für Antichrist wird auch Endchrist gesagt, da der Antichrist am Ende der Zeiten erwartet wird (10I.2, 47, 9–13).
Nachdem im Spätmittelalter der Antichrist mehr und mehr von einer apokalyptischen Gestalt der Endzeit zu einer Personifizierung von Verfallserscheinungen in der |25|Kirche wurde und auch mit dem jeweiligen Papst identifiziert werden konnte (John Wyclif; Jan Hus), wurde er bei Luther seit Mitte 1520 zu einer Charakterisierung der Institution des Papsttums, nicht des einzelnen Papstes.
1. Seit der Dominanz der antiken Philosophie in der Theologie und dem Entstehen des geistlichen Rechts herrscht der Geist des Antichrists in der Kirche (5, 649f.; 7, 757; 8, 46). Die Kirche hat der Teufel durch den Antichrist auf zweierlei Weise angegriffen: einerseits durch epikuräische Verachtung des Sakraments und Wortes Gottes, zum anderen durch Angst und Verzweiflung des Gewissens, da kein rechter Trost der Gnaden durch Pochen auf Verdienste vorhanden ist (DB 11II, 111, 6–9). Der Antichrist beansprucht das alleinige Recht, die Schrift auszulegen und zwingt die Auslegung aller anderen, sich ihm unterzuordnen. Er hebt nicht offen das Evangelium auf, sondern mit Hinterlist und verborgener Kraft (5, 339, 14–20). Dies tut der Papst (7, 80, 30; 81, 5).
2. Der Papst ist der in der Schrift angekündigte Antichrist, geht doch all sein Wesen, Werk und Vornehmen gegen Christus, um nur Christi Wesen und Werk zu zerstören (6, 434, 3–17; 7, 242, 15–17). Der Papst handelt unter dem Namen Christi, dessen Statthalter er sich zu sein rühmt, gegen die heilige Schrift (8, 167, 17–22). Nicht der Papst als Person ist der Antichrist, wohl aber sein Amt.
3. Hilfe gegen den Antichrist: Christus, der nun wieder sein Evangelium an den Tag gebracht hat, zerstört das Reich des Antichrist (11, 395, 11–13). Durch die Taufe werden die Christen Glieder Christi und erringen den Sieg über den Antichrist (26, 148, 3–5).
📖 Volker Leppin, Luthers Antichristverständnis vor dem Hintergrund der mittelalterlichen Konzeptionen, in: KuD 45 (1999) 43–68. Hans Preuß, Die Vorstellungen vom Antichrist im späteren Mittelalter, bei Luther und in der konfessionellen Polemik, 1906. Ingvild Richardsen-Friedrich, Antichrist-Polemik in der Zeit der Reformation und der Glaubenskämpfe bis Anfang des 17. Jahrhunderts, 2003. Gottfried Seebaß, Die Antichristvorstellung in der Reformation 1. Luther, in: TRE 3, 1978, 28–31.
[Zum Inhalt]
Apostel
1. Wesen: Die Apostel sind die ersten Lehrer der Gnade (3, 115, 11f.). Der Apostel ist gesetzt zwischen Gott und die Menschen. Für Gott ist er Diener, den Menschen ist er der Vermittler der Geheimnisse Gottes: damit dient er Gott, dass er das Evangelium predigt, und darin vermittelt er das Geheimnis, dass er predigt (7, 495, 1–4; 10I.2, 123, 3–5). Wer dem anderen das Evangelium lehrt, der ist wahrlich sein Apostel und Bischof (10II, 301, 27f). Die Apostel haben durch ihr Sterben und Blutvergießen das Evangelium bestätigt (17II, 253, 10–13). Ihre Lehre ist der reine Glaube, denn sie haben von dem Herrn selbst das Evangelium empfangen und wurden dadurch freie, gläubige Menschen und ohne alle Werke gerechtfertigt (10I.1, 426, 20–427, 3).
2. Funktion: Die Apostel predigen allein von der Gerechtigkeit, die Gott in uns wirkt, und gar nicht die Gerechtigkeit, die die Menschen vermögen zu wirken (1, 215, 33–35; vgl. 9, 522, 11–24). Sie predigen und lehren nichts anderes als Christus, nicht ihre eigene Lehre oder Menschengebote; denn das Evangelium lehrt nur zu Christus zu kommen und Christus recht zu erkennen (10I.2, 53, 21–23).
3. Amt: Alle Apostel, Bischöfe, Priester und der ganze geistliche Stand sind allein um des Wortes willen berufen und eingesetzt (7, 22, 19–22). Das Amt eines rechten |26|Apostels ist, dass er von Christi Leiden und Auferstehung und Amt predige und den Grund desselben Glaubens lege (DB 7, 385, 22–24).
4. Lehre: Alles, was die Apostel gelehrt und geschrieben haben, das haben sie aus dem Alten Testament gezogen; denn in demselben ist alles verkündigt, was in Christus zukünftig geschehen und gepredigt werden sollte. Denn das Neue Testament ist nicht mehr als eine Offenbarung des Alten (10I.1, 181, 15–25). Die Lehre der Apostel ist das eine Evangelium, auch wenn es vier Evangelisten und vier Evangelien gibt (12, 259, 5–8).
5. Rang: Petrus war der erste der Apostel, aber er hatte keine Autorität über sie, eher umgekehrt hatten die Apostel Autorität über Petrus (2, 203, 5–7). Kein Apostel ist über den anderen gesetzt, sondern allein von Gott ist jeder gleich dem anderen berufen und eingesetzt (2, 235, 27f.). Was auch immer die Person der Apostel sei, ihr Amt ist sicherlich dasselbe und bei allen gleichwertig: sie lehren denselben Christus, haben dieselbe Gewalt, sind von demselben gesandt (2, 471, 35–37). Alle Apostel hatten dieselbe Berufung zum selben Evangelium. Alle waren göttlich belehrt und berufen, d.h. sowohl die Berufung als auch der Auftrag aller Apostel war schlechthin unmittelbar von Gott (40I, 186, 25–30).
6. Schwäche: Auch die heiligen Apostel im Evangelium, und besonders Petrus, waren schwach im Glauben (6, 234, 12f.; vgl. 17II, 26, 38–27, 4).
7. Maßgebliche Zeit war die Zeit der Apostel, da die Christenheit am besten stand (6, 256, 21f.).
8. Christus als Apostel: Jesus Christus ist ein Prediger, Lehrer, Apostel, Bote gewesen und von Gott nur zu dem jüdischen Volk geschickt worden (10I.2, 87, 19–21). Er ist ein Apostel, das ist der höchste Bote, der in die Welt gesandt ist (16, 84, 30f.).
📖 Bernt T. Oftestad, Evangelium, Apostel und Konzil, in: ARG 88 (1997) 23–56.
[Zum Inhalt]
Arbeit
1. Wesen: Luther sagt nicht, dass niemand arbeiten und Nahrung suchen soll, sondern nicht sorgen, nicht geizig sein, nicht verzagen, er werde genug haben, denn wir sind in Adam alle zur Arbeit verurteilt (6, 271, 33–35; vgl. 2, 115, 33–39). Wie der Mensch durch die Sünde im Geist fiel, so fiel er auch im Leib in Strafe. Denn die Arbeit ist Strafe, die im Zustand der Unschuld Spiel und Vergnügen war (42, 78, 19–21). Aber der Mensch ist nicht zum Müßiggang, sondern zur Arbeit geschaffen, auch im Zustand der Unschuld (42, 78, 26f.). Arbeit wird in der Schrift als Sünde verstanden, weil sie die Seele betrübt und ermüdet. In Sünden und gemäß dem Fleisch leben ist Arbeit und Tod des Gewissens (3, 309, 1–27).
2. Sinn: Wir sind nicht zum Müßiggang berufen, sondern zur Arbeit als Kampf gegen die Leidenschaften (56, 350, 8f.). Darum hat Gott mancherlei Stände verordnet, in welchen man sich üben und Leiden lehren soll, den einen den ehelichen, den anderen den geistlichen, den andern den regierenden Stand, und allen befohlen, Mühe und Arbeit zu haben, dass man das Fleisch töte und gewöhne zum Tode (2, 734, 24–28; 6, 246, 7–11). Die Arbeit dient nicht der Rechtfertigung des Menschen vor Gott (7, 31, 22–25).
|27|3. Gottes Hilfe: Der Christ soll nicht faul und müßig sein, auch nicht auf eigene Arbeit und Tun sich verlassen, sondern arbeiten und doch alles von Gott allein erwarten. Es muss alles im Glauben und Vertrauen zu Gott geschehen (31I, 437, 12–15; 444, 29f.). Wo Gott nicht durch sein Wort alles schafft, so hülfe doch alle unsere Mühe und Arbeit nichts (31I, 446, 11f.). Gott heißt uns arbeiten, und dann gibt er die Frucht nicht um unserer Arbeit willen, sondern aus reiner Güte und Gnade (10I.2, 377, 23f.; vgl. 10I.2, 379, 7–10; 16, 263, 28f.; 22, 81, 23f.; 267, 9f.).
4. Arbeit als Abgott: Wir haben einen anderen Gott, nämlich unsere Arbeit und unser Handwerk (28, 731, 20f.). Mühe und Arbeit heißt die Schrift Abgötterei oder falschen Gottesdienst und was ohne Glauben geschieht (DB 8, 513). Mühe und Arbeit machen den Menschen nicht gerecht vor Gott (5, 241–247. 337f. 346. 419).
📖 Gerhard Müller, Martin Luther über Kapital und Arbeit, in: Reinhold Mokrosch, Hg., Humanismus und Reformation, 2001, 109–122. Hellmut Zschoch, Sinn und Grenze menschlicher Arbeit nach Martin Luther, in: H. Kasparick, Hg., Die neue Frage nach der Arbeit, 2007, 29–46.
[Zum Inhalt]
Armut
→ Elend
1. Es gibt drei Arten von Armen, dem Leib nach, die nicht arm sein wollen, dem Leib und dem Geist nach, was den Mönchen eigen sein soll, und allein der Seele und dem Geist nach, was von allen die härteste Armut ist, wenn man muss mitten unter den Kreaturen sein und doch sich nicht auf sie verlassen, Gott Ehre, Leib und Seele allein befehlen und sich sonst keiner Kreatur trösten (9, 380, 2–6; vgl. 8, 641, 27–642, 18; 10I.1, 700, 24–701, 6). Es ist klar, dass das Gelübde der Armut den äußeren Gebrauch der Dinge ablegt. Die geistliche Armut geloben wir allgemein in der Taufe (8, 332, 34f.). Die Armut ist eine doppelte, leiblich und geistlich. Evangelisch arm wird nicht einer genannt, der nichts hat, sondern der arm im Geist ist, nicht am Leib, das heißt, dass, obwohl er viel besitzt, sein Gefühl dennoch das gleiche bleibt, ob die Güter da sind oder weniger, ob sie hinzugefügt werden oder weggenommen, er ist im Gefühl frei, als ob das Äußere nicht zu ihm gehöre (4, 610, 39–611, 3).
2. Leibliche Armut: Armut nimmt Gott nicht von seinen Heiligen, aber er lässt sie nicht untergehen noch verderben (8, 226, 8f.). Die arm sind, gelten vor Gott nicht mehr als ein Reicher, denn vor Gott ist kein Unterschied der Person. Es gilt ein weiser Mensch genauso viel wie ein Unweiser, ein reicher wie ein armer, ein junger wie ein alter, eine Magd wie ein Knecht, obwohl es vor der Welt einen Unterschied hat, aber vor Gott nicht (10III, 403, 31–404, 3). Das ist der Trost der Gerechten, dass sie in der Armut reich sind, in der Schande Ehre haben und mitten in der Unlust haben sie Lust und Freude (19, 315, 24f.). Armut und Reichtum tun beide der Kirche nicht gut. Armut hält die Personen auf, Reichtum wehrt ihrem Werk und Amt (22, 117, 35–38). Ein Priester oder Mönch, der die Werke seiner Regel, also Keuschheit und Armut gehalten hätte, um durch sie gerechtfertigt und gut zu werden, ist gottlos und leugnet Christus, da er sie als schon Gerechtfertigter gebrauchen muss, um das Fleisch und den alten Menschen zu läutern, damit der Glaube an Christus wächst (2, 562, 40–563, 3).
|28|3. Geistliche Armut: Evangelische Armut bedeutet, nichts zu begehren im Geist und die Dinge frei zu verwalten zum Wohl der anderen (8, 587, 3f.). In denen, die durch Qual ihrer Gewissen nach Hilfe und Trost durch einen gnädigen Gott verlangen und weder zeitliches Gut noch Ehre begehren, ist rechte geistliche Armut (10I.2, 160, 3–7). Jeder muss vor Gott, das ist geistlich und von Herzen, arm sein. Das ist, dass er seine Zuversicht und Trost nicht setze auf zeitliche Güter noch das Herz daran hänge (32, 307, 30–34).
4. Christus hat sich um unseretwillen arm gemacht, der überschwenglich reich war, hat uns seine Güter dienen lassen, auf dass wir in seiner Armut reich würden (10III, 217, 11–13).
📖 Christian Peters, Der Armut und dem Bettel wehren, in: Irene Dingel, Hg., Gute Ordnung, 2014, 239–255. Fritz-Rüdiger Volz, Armut, in: Volker Leppin, Hg., Das Luther-Lexikon, 2014, 74–77.
[Zum Inhalt]
Auferstehung
→ Jüngster Tag
Dass im Glaubensbekenntnis ‚Auferstehung des Fleisches‘ steht, ist nicht gut deutsch geredet. Denn wo wir ‚Fleisch‘ hören, denken wir nicht weiter als an die Fleischläden. Auf rechtes Deutsch aber würden wir so reden: Auferstehung des Leibes oder Leichnams (30I, 191, 12–16).
1. Auferstehung Christi: Paulus zeigt, dass Christus gestorben ist um unserer Sünde und auferstanden um unserer Gerechtigkeit willen, das ist, in seinem Leiden macht er unsere Sünde bekannt und überwindet sie, aber durch sein Auferstehen macht er uns gerecht und frei von allen Sünden, wenn wir das glauben (2, 140, 22–26; 5, 636, 15–19). Durch seine Auferstehung vernichtete Christus die Sünde, richtete Gerechtigkeit auf, überwand den Tod und gab das Leben zurück, besiegte die Hölle und schenkte die ewige Herrlichkeit (6, 132, 37–133, 2). Wichtig ist, dass man auch glaube, dass er mir auferstanden ist und dass ich mit ihm auferstehe (9, 659, 4–16). Glauben an die Auferstehung Christi ist nichts anderes, als glauben, dass wir einen Versöhner vor Gott haben, welcher Christus ist, der uns Gott dem Vater angenehm macht (10III, 2–4). Allein der Glaube erfasst Christi Tod und Auferstehung ohne alle Werke, so dass er versteht, dieser Tod und Auferstehung sei unser Leben und unsere Gerechtigkeit (30II, 642, 17–19). Wie wir gehört haben in dem Leiden des Herrn, dass es nicht genug ist, die Historien und die Geschichte allein zu wissen, so ist es auch nicht genug, dass wir wissen, wie und wann der Herr Christus auferstanden ist, sondern man muss auch predigen und wissen den Nutzen und Gebrauch des Leidens und der Auferstehung, nämlich was er uns damit erworben hat. Denn wenn die Historie allein da ist, so ist es eine unnütze Predigt, die der Teufel und die Gottlosen ebenso wohl wissen, lesen und verstehen wie wir anderen. Dann aber, wenn man predigt, wozu es dient, so ist es eine nützliche, heilsame, tröstliche Predigt (10I.2, 214, 8–16; vgl. 17I, 183, 31–34). Also ist seine Auferstehung und Himmelfahrt unser Trost, Leben, Seligkeit, Gerechtigkeit und alles miteinander (12, 547, 8f.). Das ist die Kraft und Frucht seiner Auferstehung, dass wir Friede und Freude haben, das ist getröstet, fröhlich und lebendig gemacht werden in den schweren Gedanken, Traurigkeit und Jammer unseres Herzens. Denn aus dem |29|Tode kommen, des Herzens Furcht, Angst und Schrecken überwinden, dazu gehört eine göttliche Kraft (28, 465, 37–39). Paulus hat bewiesen, dass Christi Auferstehung die Ursache ist, dass auch wir auferstehen müssen. Gleichwie Adam der Anfang und Erstling ist, durch welchen wir alle sterben müssen, wie er gestorben ist, so ist Christus der Erstling, durch welchen wir alle zum neuen Leben auferstehen sollen, wie er zum ersten auferstanden ist (36, 551, 12–18).
2. Auferstehung der Christen: Wer an den sterbenden Christus glaubt, stirbt zugleich selbst in seiner Sünde mit Christus, und wer an den auferstehenden und lebenden Christus glaubt, erfährt durch diesen Glauben selbst die Auferstehung und lebt in Christus und Christus in ihm. Also ist die Auferstehung Christi unsere Gerechtigkeit und unser Leben, nicht nur durch ihr Beispiel, sondern auch durch ihre Kraft. Ohne die Auferstehung Christi aufersteht niemand, wieviele gute Werke er auch getan hätte (2, 455, 19–23; vgl. 57II, 54, 9–12; vgl. 2, 455, 23–25). Wenn wir an Christus glauben, dann auferstehen wir mit ihm und sterben unserem Grab, d.h. dem Gesetz, das uns gefangen hält, entkommen ihm und es hat nicht das Recht, uns anzuklagen und zurückzuhalten, weil wir auferstanden sind (40I, 270, 8–10). Die Taufe bedeutet Tod und Auferstehung, die wir Neuschaffung, Wiederherstellung und geistliche Geburt nennen, die man nicht nur allegorisch vom Tod der Sünde und dem Leben der Gnade verstehen darf, wie es viele tun, sondern vom wahren Tod und der wahren Auferstehung. Denn wenn wir beginnen zu glauben, fangen wir an, dieser Welt abzusterben und Gott zu leben im zukünftigen Leben, da der Glaube wahrhaftig ist Tod und Auferstehung (6, 534, 8–16). Durch Gnade und Glaube werde ich befreit von Gesetz, Sünde und Tod, lebe ich wahrhaft. Deshalb ist jene Kreuzigung und jener Tod, durch den ich gekreuzigt werde und dem Gesetz, der Sünde, dem Tod und allen Übeln sterbe, für mich Auferstehung und Leben (40I, 281, 24–26). Ich glaube die Auferstehung nicht allein des Geistes (wie die Ketzer sagten), sondern eben des Fleisches oder Leibes, dass er auch ein himmlischer, geistlicher Leib werden soll (36, 671, 26–28).
3. Auferstehung allgemein: Wer verneint und leugnet, dass eine Auferstehung der Toten sei, der verneint und leugnet auch zugleich, dass Gott allmächtiger Schöpfer Himmels und der Erden sei (49, 400, 9–11). Der Artikel von der Auferstehung ist aus dem Artikel von der Schöpfung stark und gewaltig geschlossen (49, 400, 26f.). Es ist alles zu tun um diesen Artikel von der Auferstehung, dass er fest in uns gegründet werde, denn er ist unser endlicher, seliger ewiger Trost und Freude wider den Tod, Hölle, Teufel und alle Traurigkeit (35, 479, 16–18).
📖 Ulrich Asendorf, Die Theologie Martin Luthers nach seinen Predigten, 1988, 115–149. Axel Wiemer, Martin Luthers eschatologische Theologie, 2003.
[Zum Inhalt]
Auslegung
→ Allegorie, Bedeutung, Buchstabe/Geist, Figur, Geheimnis, Schrift, Sinn, Verstehen
Auslegen ist, den Sinn anderen vorgeben (DB 7, 125).
1. Grundsätze: Der die Bibel lesen will, der muss eben darauf schauen, dass er nicht irre, denn die Schrift lässt sich wohl dehnen und leiten, aber keiner leite sie nach seinem Affekt, sondern führe sie zu dem Brunnen, das ist, zu dem Kreuz Christi, so |30|wird er es gewiss treffen und nicht verfehlen (1, 52, 15–18). Die heilige Schrift will in Furcht und Demut behandelt und eher mit dem Bemühen des frommen Gebets als mit der Schärfe des Geistes durchdrungen werden, denn sie ist kein menschliches Wissen (1, 507, 25f.). Wer nicht geistliche Anfechtung erfährt, bleibt in leiblichen Gedanken und kann deshalb die heilige Schrift nicht recht auslegen (40III, 515, 7–9). Man darf nicht so freveln an Gottes Worten, dass jemand ohne ausdrückliche klare Schriftzeugnisse einem Wort der Schrift eine andere Bedeutung geben wollte, als seine natürliche Bedeutung ist (11, 434, 19–22). Das heißt nicht christlich gelehrt, wenn ich einen Sinn in die Schrift trage und ziehe danach die Schrift darauf, sondern wenn ich zuvor die Schrift klar habe und danach meinen Sinn darauf ziehe (11, 438, 12–14). Den göttlichen Worten darf keine Gewalt angetan werden, sondern sie sollen so weit wie möglich in ihrer einfachsten Bedeutung erhalten bleiben, und, wenn nicht offensichtliche Umstände nötigen, sollen sie nicht außerhalb der grammatischen und eigentlichen Bedeutung verstanden werden, damit nicht den Gegnern Gelegenheit gegeben werde, mit der ganzen Schrift zu spielen (6, 509, 8–12). Die Aussagen der heiligen Schrift dürfen nicht so verstanden werden, dass sie das eine sagen, das andere aber meinen (11, 434, 30–435,4). Eine solche figürliche Interpretation entzöge der heiligen Schrift ihre Kraft. Aber was geistlich gedeutet wird, das soll man immer auf den Glauben an Christus und aufs Evangelium beziehen (16, 283, 13f.; vgl. 16, 275, 15–18; 18, 179, 39). Wer die heilige Schrift, das Wort Gottes, falsch auslegt, indem er es seinen Interessen anpasst, verstößt gegen das achte Gebot (1, 506, 17–27). Nichts darf in der heiligen Schrift ausgelegt werden, ohne dass es von der Autorität beider Testamente bestätigt wird und mit ihnen übereinstimmt (4, 180, 11f.).
2. Methode: Die Schrift kann nicht genug ausgelegt werden, wenn sie nicht durch Beispiele der gegenwärtigen Zeit angepasst und bewährt wird (5, 227, 15f.). Wenn die Väter einen Ort der Schrift auslegen, so tun sie es nicht mit ihrem eigenen Sinn oder Wort, sondern bringen einen anderen Ort herzu, der klarer ist, um also Schrift mit Schrift zu erleuchten und auszulegen (7, 639, 3–11). Man soll nicht leichtfertig Mysterien suchen, bevor man die Historie ausgelegt hat. Darum ist es unrecht, dass man von zweierlei Meinung oder Verstand der Schrift spricht: Der heilige Geist und die Wahrheit sind einfältig und ungeteilt (9, 601, 16–26). Die heiligen Lehrer haben die Weise, die Schrift auszulegen, dass sie helle klare Sprüche nehmen und damit die dunkeln, wankenden Sprüche klarmachen. Es ist auch des heiligen Geistes Weise, mit Licht die Finsternis zu erleuchten (23, 225, 1–3). Wer die Schrift geistlich auslegen will oder in einem verborgenen Sinn, soll vor allen Dingen darauf sehen, dass es sich reime mit dem Glauben oder, wie Paulus lehrt, dass es dem Glauben ähnlich sei (24, 549, 18–32).