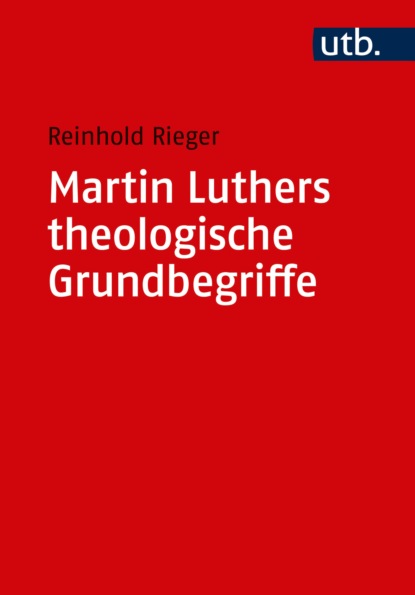- -
- 100%
- +
2. Symbol: Das ganze Evangelium ist im Symbol enthalten. Aber das Evangelium ist nicht allein im Symbol, sondern im Affekt, d.h. in der Übung (11, 48, 23–49, 1). Wir wollen den ganzen Glauben kurz fassen in drei Hauptartikel nach den drei Personen der Gottheit, wohin alles, was wir glauben, gerichtet ist, so dass der erste Artikel von Gott dem Vater die Schöpfung, der andere vom Sohn die Erlösung, der dritte von dem heiligen Geist die Heiligung erkläre (30I, 183, 3–11).
3. Beichten heißt Bekennen (30III, 567, 31). Darum soll ein Beichter oder Bekenner nicht allein Sünde wissen zu erzählen, sondern auch aufsagen, was er vom Glauben und Christus gelernt hat und was dagegen gehandelt heiße (30III, 568, 3–6). Du sollst dir in keiner Weise anmaßen, lässliche Sünden oder alle Todsünden zu bekennen, weil es unmöglich ist, dass du alle Todsünden kennst. Zum Unmöglichen ist aber niemand verpflichtet (1, 322, 22–24). Das Gewissen ist etwas leichter geworden durch Bekenntnis der Sünden. Der Glaube bekennt den rechten Gott, Schöpfer Himmels und der Erden, was nicht ein geringer Anfang ist des Glaubens und der Seligkeit (19, 214, 21–25). Das Bekenntnis ist das Licht des Geistes, durch das wir uns erkennen, was wir in uns sind und was Gott in uns ist, was wir aus uns, was wir aus Gott haben. Die Erkenntnis dieser beiden Dinge ist das wahre Bekenntnis, nämlich unseres Elends und der Barmherzigkeit Gottes, unserer Sünde und der Gnade Gottes, unseres Übels und der Güte Gottes. Deshalb wird dies im eigentlichen Sinn Bekenntnis genannt, weil jedem das seine zugeschrieben wird (4, 109, 19–26). Das Bekenntnis der Sünde, da es Wahrheit ist, rechtfertigt und heiligt (6, 117, 18–22).
📖 Walther von Loewenich, Wahrheit und Bekenntnis im Glauben Luthers, 1974. Thomas Reinhuber, Kämpfender Glaube, 2000. Friedrich-Otto Scharbau, Hg., Christus bekennen, 2004.
[Zum Inhalt]
Berufung
→ Amt
1. Es gibt zwei Arten von Berufung: die innerliche durch den heiligen Geist, die äußerliche durch Menschen. Die erste geschieht allein von Gott und ohne Mittel, und die andere muss äußerliche Zeichen und Zeugnisse haben (16, 33, 13–22; vgl. 1, 695, 31–35). Niemand soll sich in ein öffentliches Amt ohne Gottes Berufung hineindrängen (16, 32, 12–16; 30III, 386, 19f.). Denn Gott will nichts aus eigener Wahl oder Andacht, sondern alles aus Befehl und Beruf getan haben, besonders das Predigtamt (31I, 211, 31–32; vgl. 212, 1f.).
2. Niemand darf in der Kirche lehren, außer er wäre von Gott berufen. Er darf nicht vergessen, was diese Berufung Gottes sei, wenn er gegen seinen Willen durch die Autorität seiner Vorgesetzten in Kirche oder Staat in das Amt des Wortes berufen |39|wird (5, 259, 27–31). Ein Amt kann niemand haben ohne Befehl oder Berufung (30III, 521, 9–24; 520, 34–36). Wer dazu berufen ist und Befehl hat, dass er das Evangelium predigen soll, taufen, von Sünden entbinden durch Kraft der Absolution, in den Bann tun durch die Gewalt der Schlüssel, strafen und vermahnen, der gehe getrost hin und lasse sich nicht schrecken, was ihm auch darüber begegnen mag (28, 471, 22–26). Jeder Diener des Wortes Gottes soll seiner Berufung gewiss sein, dass er vor Gott und den Menschen sich mit Vertrauen rühmen kann, das Evangelium zu predigen als der, der dazu berufen und gesandt ist (40I, 56, 22–24).
3. Die Berufung ist allgemein, sie gilt auch für Ehe, Kinder, Knechte und jeden Stand (10I.1, 308, 6–9). Wie niemand ohne Befehl und Beruf ist, so ist auch niemand ohne Werk, wenn er recht tun will. Jeder müsse seinem Stand gerecht werden (10I.1, 309, 14–18; vgl. 10I.1, 413, 5–7; 22, 295, 21–24).
4. Wir haben eine doppelte Berufung, eine geistliche und eine äußere. Die geistliche, durch die wir alle durch das Wort, die Taufe und den Glauben Christus einverleibt werden und Brüder, Gesellschaft Jesu Christi genannt werden. Dort sind wir alle gleich. Die Berufung ist allen gemeinsam. Aber sie wird vielfältig in den Früchten. Wenngleich die Ordnung der äußeren Werke verschieden ist, ist dennoch die Berufung dieselbe. Denn Christus ist der Leib, zu dem wir berufen sind, wie er selbst die Gerechtigkeit, das Heil, das Leben ist. Also sollen wir auch leben, dass er Ehre hat von unserem Beruf (34II, 300, 23–301, 27). Die andere Berufung, die äußere, macht einen Unterschied, sie ist irdisch, wenngleich auch göttlich. Dort ist der Fürst kein Bauer, der Schüler nicht Lehrer, der Knecht nicht Herr, der Vater nicht Sohn, der Mann nicht Frau. Das heißt ein leiblicher Beruf, in dem wir so ungleich sind, wie in jenem gleich. In der ersten Berufung sind wir desselben Berufs in Christus, aber in der äußeren Berufung sind wir ungleich, da muss unterschieden sein. In der ersten Berufung in Christus sind Vater und Sohn usw. gleich, aber in der zweiten Berufung ungleich (34II, 306, 11–307, 29). Die erste Berufung ist unmittelbar von Gott selbst, wie die der Apostel und Propheten. Die zweite mittelbar durch Menschen, die zu Größe und Autorität eingesetzt werden, wie die Apostel ihre Nachfolger beriefen, wie bis jetzt von irdischen Mächten und Obrigkeiten berufen wird. Eine von beiden muss der, der in der Kirche lehren will, besitzen (38, 493, 39–494, 3). Die göttliche Berufung ist eine doppelte, eine unmittelbare, die andere mittelbar. Gott beruft uns heute alle zum Dienst am Wort mittelbar, d.h. durch Berufung, die durch ein Mittel erfolgt, also durch Menschen. Die Apostel aber wurden unmittelbar berufen von Christus selbst, wie die Propheten im Alten Testament von Gott selbst. Die Apostel beriefen nachher ihre Schüler, diese dann Bischöfe, die Bischöfe beriefen ihre Nachfolger bis zu unseren Zeiten und weiter bis ans Ende der Welt. Das ist die mittelbare Berufung, weil sie durch Menschen geschieht, aber dennoch göttlich ist (40I, 59, 16–23). Die Berufung Christi bringt Gnade und ist heilsam, versetzt die Berufenen aus dem Gesetz ins Evangelium, aus dem Zorn in die Gnade, aus der Sünde in die Gerechtigkeit, aus dem Tod ins Leben (40I, 107, 26–28).
📖 Rudolf Mau, Beruf und Berufung bei Luther, in: J. Rogge / G. Schille, Hg., Themen Luthers als Fragen der Kirche heute, 1982, 11–28. Gustaf Wingren, Luther on Vocation, 2004.
[Zum Inhalt]
|40|Betrachtung
→ Andacht
1. Betrachten gehört eigentlich allein dem Menschen zu, da auch die Tiere Vorstellung und Denken zu haben scheinen. Die Kraft der Betrachtung ist vernünftig. Es unterscheiden sich nämlich Betrachten und Denken insofern, als Betrachten eindringliches, tiefgehendes, genaues Denken ist und eigentlich ein Vertiefen (55II, 11, 26–12, 5). Betrachtung ist die höchste, wirksamste und kürzeste Bildung (3, 539, 23f.). Betrachten ist innerlich erkennen und Inneres erforschen und immer dem inneren Geist folgen und sich keine Grenze setzen, wie wenn man das Ziel des Verstehens und Handelns schon erreicht hätte (4, 319, 27–30). Wenn auch die Menschwerdung und die Passion Christi zur Bildung des Gefühls und Verstandes betrachtet werden sollen, so sind sie doch am meisten zu betrachten, um die uns durch die heilige Schrift gezeigte Liebe Gottes zu uns zu erkennen (1, 341, 37–40). Gott lehrt uns durch seine Gnade Christi Leiden recht betrachten, herzlich fassen und seliglich in unser Leben bilden (6, 16, 13f.).
2. Aus herzlicher, gründlicher Gunst zu Christus und Ungunst auf uns selbst die Sünde betrachten, das ist eine rechte Reue und fruchtbare Buße. Denn die Reue soll zuvor sein, die Sünde zu betrachten, dass das Betrachten der Sünde aus der Reue fließe und bereit werde, nicht wiederum die Reue folge und aus der Betrachtung bereit werde. Es muss Reue da sein vor aller Betrachtung der Sünde, gleich wie Liebe und Lust da sein müssen vor allen guten Werken und ihrer Betrachtung: die Betrachtung ist eine Frucht der Reue (7, 361, 5–11).
3. Christus zeigt klar an, dass die Speise und Sättigung, wodurch das Leben der Seele erhalten wird, bestehe in der Anhörung und Betrachtung des göttlichen Wortes (9, 143, 12–14). Das Evangelium ist so klar, dass es nicht viel Auslegens bedarf, sondern es will nur wohl betrachtet, angesehen und tief zu Herzen genommen sein (10I.1, 62, 5–8). Gott hat die heilige Schrift uns armen sündigen Menschen gegeben, dass wir sollen nicht allein lesen, sondern auch forschen, nachdenken oder betrachten. So wird man darin das ewige Leben finden (48, 141, 4–7). Es gibt zweierlei Betrachtung des Lebens, Sterbens und Auferstehens Christi: Erstens die Historie, die anzeigt, wie die Geschichte ergangen ist mit allerlei Umständen. Zweitens, was das nötigste ist und um welches willen die Historie auch gepredigt wird, Kraft, Nutzen und Trost der fröhlichen Auferstehung des Herrn und wie man diese durch den Glauben gebrauchen soll (21, 214, 6–22). Der Glaube soll durch beständige Behandlung der heiligen Schrift und fromme Betrachtung genährt und bestärkt werden (40III, 686, 19f.).
4. Betrachtung, Versuchung, Gebet machen einen Theologen aus (48, 276; vgl. 50, 659, 3f.).
📖 Oswald Bayer, Oratio, Meditatio, Tentatio, in: LuJ 55 (1988) 7–59. Manuel Goldmann, Oratio – Meditatio – Tentatio, in: Luther 82 (2014) 115–124. Martin Nicol, Meditation bei Luther, 2. Aufl. 1991. Rolf Schäfer, Oratio, meditatio, tentatio, in: Oswald Bayer, Hg., FS Friedrich Lang, 1978, 671–681.
[Zum Inhalt]
|41|Bild
→ Abgott, Allegorie, Figur, Mensch, Metapher
1. Bildnisse anbeten hat Gott verboten, und es ist wahr, dass sie gefährlich sind, und es wäre gut, es wären keine auf den Altären. Aber sie deshalb verbrennen und schänden, ist nicht recht (10II, 33, 18–23). Die Bilder in den Kirchen sind unnötig, aber es ist frei gelassen, sie zu haben oder nicht zu haben, obwohl es besser wäre, wir hätten keines dieser Bilder um des leidigen Missbrauchs und Unglaubens willen (10III, 26, 21–24; 28, 716, 23–717, 11). Man darf Bilder machen und haben, aber nicht anbeten (10III, 28, 21f.). Wo solcher Missbrauch und Irrtum geschieht in Anbetung der Bilder, sollte man die Kreuze oder Bilder abreißen, wegtun, die Kirche einreißen, obwohl die Bilder nicht gänzlich zu verwerfen sind, denn wir haben davon eine Figur im Alten Testament von der durch Mose in der Wüste aufgerichteten ehernen Schlange (10III, 7–17). Nach dem Gesetz Mose ist kein anderes Bild verboten ist als Gottes Bild, das man anbetet, ein Kruzifix aber oder sonst eines Heiligen Bild ist nicht verboten (18, 68, 28–30). Weniger das Anbeten von Bildern ist schädlich, als das Anbeten falscher Götter.
2. Gleichnis, Parabel: Die Erschaffung der leiblichen Dinge ist der Anfang und das Bild und der Schatten der Erlösung und der geistlichen Dinge, die ihr Ziel sind, ohne die sie vergeblich wären. Deshalb werden sie als Gleichnisse des Geistlichen aufgefasst (3, 550, 33–35). Jedes sichtbare Geschöpf ist ein Gleichnis der Weisheit Gottes (3, 560, 35–561, 2). Auslegung der Gleichnisse nach dem Skopus: Deshalb muss man die Gleichnisse nicht in allen Stücken ansehen, sondern auf das Hauptstück achten, was es damit wolle (17II, 137, 4–17). Wer aber in Gleichnissen redet, der macht aus allgemeinen Worten neue und andere Wörter, sonst wären es nicht Gleichnisse, wenn er die allgemeinen Worte gebraucht in der bisherigen Bedeutung (26, 277, 27–29). Wo ein Tropus oder erneuertes Wort in der heiligen Schrift verwendet wird, da werden auch zwei Deutungen gebraucht, eine neue nach der ersten, alten oder bisherigen (26, 379, 24–33; vgl. 382, 25–383, 3). Voraussetzung für eine Figur, Symbol oder Gleichnis ist, dass es etwas Gemeinsames gibt, auf das sich das Bild gründet (26, 391, 29–31).
3. Christus als Bild Gottes: In der Theologie kann nicht mit Begriffen verstanden, sondern muss mit Bildern verkündigt werden. Man kann die geistlichen Sachen nicht begreifen, es sei denn, dass man sie in Bilder fasse (46, 308, 8f.). So bezeichnet Luther Christus als ein Bild Gottes und erklärt das mit der Menschwerdung (46, 308, 22f.). Denn wer das Bild hat, der hat die Erkenntnis und Offenbarung (29, 361, 33). Wenn Christus nicht Gott gleich wäre, so könnte er nicht Gottes Ebenbild sein, da keine Kreatur Ebenbild des göttlichen Wesens sein kann. Wenn er nicht unterschiedene Person wäre, so könnte er nicht Gottes Ebenbild sein (45, 274, 36–38). Wir Menschen sind anfänglich nach dem Bild und zu dem Bild Gottes geschaffen, sind aber nicht das Ebenbild Gottes noch Gott gleich, sondern sind als Kreaturen von Gott geschaffen. Aber Christus ist das Ebenbild Gottes und ein solches Ebenbild, welches Gott ganz und gar gleich ist, nicht nach dem Bild Gottes geschaffen noch gemacht, sondern das Ebenbild Gottes selbst, vom Vater in Ewigkeit geboren und ein solches Bild, das Gott gleich ist oder Gott selbst ist, gleicher Natur und Wesens mit Gott (45, 275, 27–34). Christus ist aber nicht nur ein Abbild, er ist die Wirklichkeit, die er darstellt. Die Differenz zwischen Bild und Abgebildetem ist aufgehoben. Wenn nach einem Menschen ein Bild gemacht wird, so ist das Bild nicht ein Bild des menschlichen Wesens oder |42|der Natur, denn es ist nicht ein Mensch, sondern Stein oder Holz, und es ist ein Bild des steinernen oder hölzernen Wesens nach dem Menschen gemacht. Alle Bilder, die gemacht werden, sind eines anderen Wesens und Natur als das, dessen Bild sie sind. Aber hier ist der Sohn ein solches Bild väterlichen Wesens, dass das väterliche Wesen das Bild selbst ist (10I.1, 155, 8–19). Christus ist ein Götterbild, das, so wahr als jenes Bild Holz ist, so wahr ist dieses Bild Gott. In allen Kreaturen ist das Bild eines anderen Wesens als der, dessen Bild es ist. Aber hier ist das Bild und der, dessen Bild es ist, eines Wesens (10I.1, 156, 2–11). Am Kreuz hat Christus uns sich selbst bereitet ein dreifaltiges Bild für unseren Glauben gegen die drei Bilder des Todes, der Sünde, der Verdammnis: Er ist das lebendige und unsterbliche Bild wider den Tod, den er erlitten, und doch mit seiner Auferstehung von den Toten überwunden in seinem Leben hat. Er ist das Bild der Gnade Gottes wider die Sünde, die er auf sich genommen und durch seinen unüberwindlichen Gehorsam überwunden hat. Er ist das himmlische Bild, der verlassen von Gott als ein Verdammter und durch seine allmächtigste Liebe die Hölle überwunden hat und bezeugt, dass er der liebste Sohn sei und uns allen dasselbe zu eigen gebe, wenn wir glauben (2, 691, 12–21). Diese Einheit des Bildes Gottes mit Gott selbst hat zur Folge, dass Gott uns in Christus das Bild des Lebens, der Gnade, der Seligkeit zeigt und gibt, dass wir uns vor des Todes, der Sünde, der Hölle Bild nicht entsetzen (2, 697, 15–18; vgl. 10I.1, 160, 10–14).
4. Die Gottebenbildlichkeit des Menschen besteht darin, dass die Seele nach Augustin eine Ähnlichkeit mit der heiligen Trinität hat: sie ist im Körper verborgen wie Gott in der Welt unsichtbar ist, sie regiert in ähnlicher Weise den Körper (4, 599, 19–21). Der Mensch ist dazu geschaffen, dass er Gottes Bild sein soll und eben dazu Gottes Bild, dass Gott durch ihn soll und will erkannt werden, darum sollte Gott ja auch in das ganze Leben des Menschen als in einen Spiegel scheinen und leuchten, und deshalb soll es keine höhere noch größere Sorge eines Christen sein, als so zu leben, dass nicht Gottes Name verunehrt werde (22, 294, 31–36). Der Mensch muss ein Bild sein entweder Gottes oder des Teufels, denn nach welchem er sich richtet, dem ist er ähnlich. Der Mensch ist am Anfang geschaffen als ein Bild, das Gott ähnlich war, voll Weisheit, Tugend und Liebe. Nun ist er nicht so geblieben und das Bild ist verloren gegangen, und wir sind dem Teufel ähnlich geworden (24, 51, 12–24; vgl. 37, 453, 15–32). Die scholastischen Lehrer folgten Augustin, der die Unterscheidung des Aristoteles übernahm, und sagten, dass das Bild Gottes die Vermögen der Seele seien, Gedächtnis, Geist oder Verstand, und Wille. Die Ähnlichkeit, sagen sie, bestehe in den Gnadengaben. Wie nämlich die Ähnlichkeit eine Vervollkommnung des Bildes sei, so meinen sie, werde die Natur durch die Gnade vervollkommnet. So besteht die Ähnlichkeit mit Gott darin, dass das Gedächtnis durch die Hoffnung geschmückt werde, der Verstand durch den Glauben und der Wille durch die Liebe. Auf diese Weise, meinen sie, ist der Mensch zum Bild Gottes geschaffen, d.h. der Mensch hat einen Verstand, Gedächtnis und Willen. So ist der Mensch auch geschaffen zur Ähnlichkeit mit Gott, d.h. der Verstand ist erleuchtet durch den Glauben, das Gedächtnis befestigt durch die Hoffnung und die Beständigkeit und der Wille geschmückt durch die Liebe (42, 45, 5–17). Das Evangelium handelt davon, dass wir zu diesem noch besseren Bild wiederhergestellt werden, weil wir im ewigen Leben oder vielmehr in der Hoffnung auf das ewige Leben wiedergeboren werden durch den Glauben, damit wir in Gott und mit Gott leben und mit ihm eins sind (42, 48, 12–15). Wenn Mose |43|sagt, der Mensch sei zur Ähnlichkeit mit Gott geschaffen, zeigt er, dass der Mensch sich nicht nur so auf Gott bezieht, dass er Vernunft oder Verstand und Willen hat, sondern auch, dass er Ähnlichkeit mit Gott hat, d.h. einen solchen Willen und Verstand, durch den er Gott versteht und will, was Gott will (42, 248, 9–13). Durch die Sünde gingen sowohl das Bild wie die Ähnlichkeit verloren. Sie werden aber wiederhergestellt durch den Glauben (42, 248, 16–18). Die falschen Theologen behaupten, das Bild und die Ähnlichkeit Gottes blieben auch im unfrommen Menschen erhalten. Aber das Bild Gottes ging nach der Sünde so zugrunde, wie die ursprüngliche Welt und das Paradies vergingen (42, 68, 31–34). Wir sind Bild Gottes eher für uns als für Gott, weil Gott sich nicht durch uns, sondern wir Gott durch uns erkennen (57III, 100, 13–101, 2).
📖 Hans von Campenhausen, Die Bilderfrage in der Reformation, in: ders., Tradition und Leben, 1960, 97–129. Werner Hofmann, Hg., Luther und die Folgen für die Kunst, 1983. Theodor Jörgensen, Wort und Bild bei Luther, in: Anja Ghiselli, Hg., Luther und Ontologie, 1993, 142–154. Thomas Kaufmann, Die Bilderfrage im frühneuzeitlichen Luthertum, in: Peter Blickle, Hg., Macht und Ohnmacht der Bilder, 2002, 407–454. Angelika Michael, Luther und die Bilder, in: LuJ 79 (2012) 101–137. Margarete Stirm, Die Bilderfrage in der Reformation, 1977. Christoph Weimar, Luther, Cranach und die Bilder, 1999, 30–42. Karl-Heinz Zur Mühlen, Luther und die Bilder, in: ders., Reformatorische Prägungen, 2011, 184–198.
[Zum Inhalt]
Böses
→ Fleisch, Sünde, Teufel
Bosheit ist die böse Gefühlsausrichtung des Geistes, durch die der Mensch geneigt ist, das Böse zu tun, und alles Gute missbraucht zur bösen Tat (56, 187, 3–5).
1. Es gibt ein dreifaches Übel: das der Natur, der Schuld, des Verderbens. Das erste ist gegen das Sein, das zweite gegen die Gnade, das dritte gegen die Ehre (4, 596, 18f.; vgl. 601f.). Das Gesetz offenbart ein doppeltes Böses, ein inneres und ein äußeres. Das eine, das wir uns selbst zugefügt haben, die Sünde oder das Verderbnis der Natur, das andere, das Gott zufügt, den Zorn, den Tod und die Verdammnis, Schuld und Strafe (8, 104, 22–25).
2. Die heilige Schrift beschreibt den Menschen als in sich gekrümmt, so dass er nicht nur leibliches, sondern auch geistliches Gutes auf sich bezieht und sich in allem sucht. Diese Gekrümmtheit ist jetzt natürlich, ein natürliches Laster und ein natürliches Übel (56, 356, 4–7). Das erste Übel ist Ungerechtigkeit, dass der Mensch nicht fromm ist vor Gott. Das andere sind die bösen Werke, die folgen als der andere Schaden aus dem ersten. Diese Ungerechtigkeit sind auch die guten Werke, die geschehen in beraubter und abwesender wahrer Frömmigkeit, die aus Gnaden geboren wird. Das dritte, die Sünde, ist das Böse der Natur, das geblieben ist und allezeit bleibt, wenn die Missetat geschieht und Ungerechtigkeit verwirklicht wird, und da sind böse Lust, Liebe, Furcht angeboren, welche reizen zu den ersten zwei (1, 168, 11–29). Des Menschen Herz und Sinn stehen allezeit zu dem Bösen, das ist Hoffart, Ungehorsam, Zorn, Hass, Geiz, Unkeuschheit etc. und in allem, was er tut und lässt, sucht er mehr seinen Nutzen, Willen und Ehre, als Gottes und seines Nächsten; darum sind alle seine |44|Werke, alle seine Worte, alle seine Gedanken, all sein Leben böse und nicht göttlich (6, 244, 8–13). Das Gebot, du sollst nicht böse Begierde haben, beweist, dass wir alle Sünder sind und kein Mensch vermag zu sein ohne böse Begierde, er tue, was er will. Daraus lernt er an ihm selbst verzagen und anderswo Hilfe zu suchen, dass er ohne böse Begierde sei (7, 23, 36–24, 2). Der Mensch vermag von ihm selbst kein Gutes, sondern nur Böses (7, 355, 33f.). Wenn der Geist glaubenslos ist, sind wegen solchen Irrtums der Seele und falschem Gutdünken auch alle Werke des Leibes böse und verworfen (7, 553, 1–6). So ist nun das erste Böse aller Menschen, dass sie gottlos, heillos, gnadenlos sind, nur aus natürlichem Vermögen und Vernunft leben und wandeln (10I.1, 25, 12–16). Was nicht aus Gott ist und nicht vom heiligen Geist in uns gewirkt wird, ist böse (11, 202, 17f.).
3. Das Übel ist ein doppeltes: die Missachtung des Geistlichen, was Verderben bedeutet, und das Verlangen nach Irdischem, was Verkrümmung heißt (3, 212, 35f.). Unser Übel ist ein doppeltes: erstens dass wir nicht um die Gnade Gottes bitten, zweitens dass wir nicht daran denken und uns nicht dessen bewusst sind, ihrer zu entbehren. Denn wir wissen nicht, wie übel wir sind (3, 584, 26–28).
4. Woher kommt aber solcher Streit des Bösen wider das Gute in uns selbst, als von der leiblichen Adamsgeburt, welche nach dem angefangenen guten Geist in der Taufe und Buße übrigbleibt, bis dass es durch Gottes Gnade und des Geistes Zunehmen überwunden und zuletzt durch den Tod ausgetrieben werde (7, 331, 25–29). Die Theologen können nicht leugnen, dass zwei Übel nach der Taufe bestehen bleiben, die Sünde und ihre Begierde (8, 96, 33f.). Obwohl der Glaube uns erlöst auf einmal von aller Schuld des Gesetzes und uns freimacht, bleiben doch übrig böse Neigungen in Leib und Seele (10I.1, 52, 14f.).
5. Erkenntnis: Das Licht des Geistes Gottes lehrt, das Übel des Fleisches wahrzunehmen (56, 345, 23–28). Die Gebote Gottes lehren uns erkennen unsere Sünde, Bosheit, das ist die geistliche Krankheit, durch die wir nicht tun noch lassen, wie wir wohl schuldig sind (7, 205, 6f.). Das Gesetz Gottes ist gegeben, dass der Mensch dadurch seine Bosheit und Unwillen zum Guten erkenne, zu sich selbst komme und demütig seine böse Natur bekenne, verklage und Gottes Gnade begehre, die ihm nicht das Gesetz ablegt, welches er wohl sieht, dass es recht, gut und heilig sei, sondern ein anderes Herz mache, das solches rechtes, gutes und heiliges Gesetz lieb habe (10I.1, 460, 12–17).
6. Ursache: Böse Werke machen niemals einen bösen Menschen, sondern ein böser Mensch macht böse Werke. Also muss der Mensch in der Person zuvor fromm oder böse sein, ehe er gute oder böse Werke tut. Kein böses Werk kann ihn böse und verdammt machen, sondern der Unglaube, der die Person böse macht, der tut böse und verdammte Werke. Darum wenn man fromm oder böse wird, beginnt es nicht mit den Werken, sondern dem Glauben (7, 32, 6–33, 3). Vor dem Gesetz sündigt der Mensch und die böse Natur schlechthin für sich, denkt nicht an das Gesetz. Wenn aber das Gesetz kommt und wehrt und droht, so wird die Natur allererst böse und unwillig auf das Gesetz, fängt nun an, nicht allein die Sünde zu lieben, sondern auch die Gerechtigkeit zu hassen (10I.1, 464, 10–13).
7. Erlösung vom Bösen: Im Vaterunser bittet man zuletzt um die Erlösung vom Übel: Man findet viele, die Gott und seine Heiligen ehren und bitten, aber nur, dass sie das Übel los werden, und nichts anderes suchen, nicht einmal denken an die erste |45|Bitte, dass sie Gottes Ehre, Namen und Willen voransetzten. Darum suchen sie ihren Willen und kehren dieses Gebet ganz um, heben am letzten an und kommen nicht zu dem ersten, sie wollen ihr Übel los sein, es sei Gott zu ehren oder nicht, es sei sein Wille oder nicht. Weil dieses Leben nichts anderes ist als ein unseliges Übel, davon gewiss auch Anfechtungen erwachsen, so wollen wir das Übel darum begehren los zu werden, dass Anfechtung und Sünde aufhören und also Gottes Wille geschehe und sein Reich komme zu Lob und Ehre seinen heiligen Namens (2, 126, 10–27).