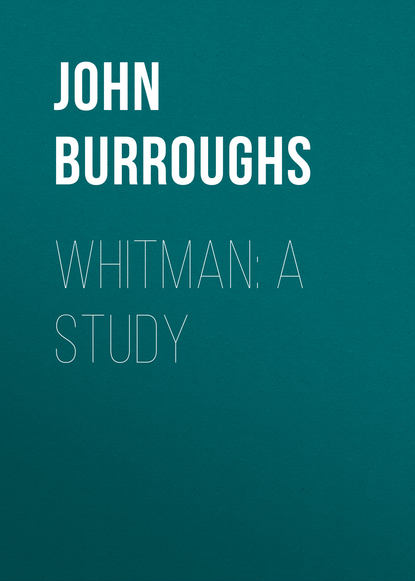»Wir kriegen euch alle!« Braune Spur durchs Frankenland

- -
- 100%
- +
Sie erinnerte sich an diesen Satz aus seinem Mund, und wieder wurde sie von heftigen Zweifeln geplagt. Die ganze unschöne Angelegenheit wühlte sie innerlich auf. Schlechte Nachrichten schlugen bei ihr immer auf das vegetative Nervensystem. Dann bekam sie meist Schwierigkeiten mit der Atmung, manchmal auch mit der Verdauung und dem Stoffwechsel. War das alles nur Süßholzraspeln, was Walter ihr kürzlich ins Ohr flüsterte? Nur leere Worte? Dachte er dabei bereits an das nächste Wiedersehen mit dieser türkischen Nutte? Nein, das konnte nicht sein. Ihr Walter war anders als die anderen jungen Männer. Er las ihr doch immer jeden Wunsch von den Augen ab, und er konnte so zärtlich sein, wenn er sie in die Arme nahm. Nein, Walter ging nicht fremd. Aber wer weiß, vielleicht hatte ihm dieses türkische Satansweib doch schöne Augen gemacht, und er ist auf sie hereingefallen? Sie sah ja extrem gut aus. So exotisch. Das musste man ihr lassen. Der Teufel in Person. Falls …, na dann konnte die was erleben. Sie würde ihr ihre schwarzen Glubschaugen auskratzen. Sie würde ihr ihren türkischen Arsch bis zum Gehtnichtmehr aufreißen. So ein Luder. Doris Kunstmann nahm ihr iPhone zur Hand und wählte die eingespeicherte Nummer von Norbert Amon. Norbert war Walters bester Freund. Die beiden steckten doch ständig zusammen. Wenn jemand Bescheid wusste, dann Norbert. Das Mobiltelefon tickerte. Besetzt. Die beiden quatschten bestimmt gerade miteinander. Sie würde es später noch einmal probieren und wehe, an der Sache war was dran, dann würde sie nicht nur dieser türkischen Amazone den Arsch aufreißen. Dann war auch Walter dran, aber daran mochte sie im Moment noch gar nicht denken. Und wenn doch? Auf jeden Fall ließ sie sich nicht vor dem ganzen Dorf lächerlich machen. Das stand außer Zweifel.
7
Müselüm Yilmaz war höchst verärgert. Nein er war hochgradig wütend. Unruhig tigerte er in seiner Erlanger Zweizimmerwohnung auf und ab. So eine Schande. Sie hatte ihm Hörner aufgesetzt, dieses Weib. Müselüm rieb sich seinen überdimensionalen Riechkolben. Das tat er immer, wenn er in höchster Aufregung war. Seine siebzehnjährige Freundin hatte ihn gedemütigt. Vor aller Welt. Das war ihm nun klar. Sie hatte ein neunzehnjähriges dahergelaufenes Bürschlein, einen Deutschen zudem – noch grün hinter den Ohren – ihm, einen gesunden und kräftigen vierundzwanzigjährigen türkischen Mann, vorgezogen und damit gegen alle traditionellen Regeln der türkischen Lebensanschauung verstoßen. Das musste Konsequenzen haben. In beide Richtungen. Er würde sich diesen Deutschen, dem noch die Eierschalen hinter den Ohren klebten, bei nächster Gelegenheit ordentlich vornehmen. Er musste seine verletzte Würde wieder ins rechte Lot bringen. Aber auch Akgül musste bestraft werden. Da ging kein Weg daran vorbei. Sie würde schon noch lernen, den ihr versprochenen zukünftigen Ehemann zu achten und seine Anordnungen zu befolgen. Wie oft hatte er ihr schon gesagt, dass er es nicht mochte, wenn sie sich so aufreizend kleidete. Er war wohl bisher zu weich und nachsichtig mit ihr gewesen. Das war ein Fehler, doch das würde sich ab sofort fundamental ändern. Ganz sicher. Er konnte auch andere Saiten aufziehen, wenn er wollte. Da würde sie sich noch wundern. Doch Müselüms größte Sorge war, dass Akgül zwischenzeitlich keine Jungfrau mehr war. Diese deutschen Halbstarken wären die reinsten Hurenböcke, hatte er gehört. Immer wieder tauchte dieser schreckliche Gedanke im hintersten Winkel seines Gehirns auf und versetzte ihn in Panik. Er mochte gar nicht daran denken, was geschehen würde, wenn dies der Fall sein sollte. Wirklich nicht auszudenken. Er würde dem Deutschen eigenhändig den Schwanz abschneiden. Er würde ihm seine Eier einzeln ausreißen. Eine unbändige Wut stieg in ihm hoch, wenn er nur daran dachte. Der Zweifel nagte tief in ihm und ließ ihm keine Ruhe. Dann griff er, immer noch hoch erzürnt, zum Telefon und wählte Ahmet Özkans Nummer. Er wollte endlich wissen, was sein Schwiegervater in spe über Akgüls Seitensprung herausgefunden und was der Familienrat beschlossen hatte.
8
Auch Walter Fuchs hatte daheim Probleme mit seinen Eltern.
»Bring uns fei bloß keine türkische Schnalln ins Haus geschleift«, musste er sich von seinem Vater, Moritz Fuchs, anhören, »und wehe du machst dieser Zigeunerin ein Kind! Ein türkischer Balg kommt mir fei net ins Haus. Sonst enterb ich dich. Merk dir das!«
»Dass du überhaupt mit so einem Madla was anfängst«, geiferte seine Mutter Gerta, »die stinkn doch alle nach Knoblauch. Dass du dich da net ekelst! Waschn tun die sich wahrscheinlich auch net. Die hat es doch bloß auf unser Haus abgsehn. Dass du das nicht merkst! Du bist doch unser einziger Bu!«
»Etz lasst mich doch endlich in Ruh«, geiferte der junge Mann zurück, »schließlich bin ich erwachsen und kann machen und tun, was ich will. Und dass ihr das endlich mal wisst: Auf eure Bruchbudn kann ich sowieso gern verzichtn.«
»Da pass etz aber auf, was du sagst”, fing Vater Moritz erbost zu schreien an, »solang du deine Füß unter unsern Tisch ausstreckst, hast du herinna überhaupt nix zu sagen. Das sag ich dir! Wenn du willst, kannst du morgen scho ausziehn, und glaub bloß net, dass wir dir irgendeine Träne nachgreina!«
»Papa«, klagte Gerta Fuchs nun ihren Mann an, »um Himmels Willn, etz sei doch nicht so streng mit unserm Bubm. So was sagt mer doch net zu seinem eigenen Fleisch und Blut.«
»Na, weils doch wahr ist«, ließ Moritz Fuchs nicht locker. »Soll er doch schaun, wie er allein zurechtkommt, das Siebngscheiderla. Erwachsen will er sein, mit seine neunzehn Jährli, dabei hat er noch keinen Strich gärwert. Dass ich fei net lach! Sein ganzes Leben hat er noch nix gschafft. Der hockt doch bloß in der Schul rum und reißt Türken-Weiber auf.« Dann wandte er sich wieder an seinen Sohn: »Wie ich so alt war wie du, da hab ich scho fünf Jahr aufm Bau gärwert und Geld verdient! Da hab ich keine so Flausn im Kopf ghabt wie du.«
»Warst halt auch a weng zu bleed für das Gymnasium”, konterte sein Sohn sichtlich aufgebracht.
»Walter, das sagt man fei net zu seim Vadder! Jahrzehntelang ham wir nur buckelt und gärwert. Und für wen? Doch nur für dich. Du sollst es doch mal besser ham als wir.«
»Siehst du«, brauste Moritz Fuchs auf, »frech wird er auch noch zu seine Eltern, der Rotzlöffel! Wer hat denn dir das alles ermöglicht, das schöne Leben, das wo du heut führst? Vom Maul ham wir uns das alles abgspart, ich und dei Mudder. Und dann kriegst du so was gsagt! Do hört sich doch alles auf. Undank ist der Welt Lohn! Wenn ich des vorher gewusst hätt …, dann hätt ich andere Saitn aufzogen. Das kannst mir glauben. Etz weiß ich auch, warum deine Notn in der Schul immer schlechter werdn … , weilst dieser türkischn Büchsn nachstellst. Die hat dich ja scho ganz schön am Wickel, das Luder. Is dir das bisserla, was von deinem Verstand noch übrig is, auch scho in die Hosn grutscht? Der Lack vo derer Türkin wird fei a bald abgschleckt sein, gell Mudder? Dann kommt der Alltag, … mit dera Schlampn. Da möcht ich net amol dran denkn. Was meinst, wie die aufgehn, wenns amol verheiratet sind? Wie ein Hefeküchla, sag ich dir. Schau dir die Mama an.«
Walter Fuchs konnte sich das Genörgel seines Vaters nicht mehr länger anhören. Genervt und wutentbrannt sprang er von seinem Sessel auf und verließ grußlos das Wohnzimmer, in welchem seine Eltern ihn zur Rede gestellt hatten. Er dachte an Akgül. Ob sie zuhause ähnliche Probleme hatte? Hoffentlich nicht. Er hatte nicht vor, seine Beziehung zu seiner neuen Freundin zu beenden. Egal, wer oder was da komme. Er würde es seinen Eltern schon zeigen. Er war neunzehn. Da ließ man sich doch nicht mehr wie ein Zehnjähriger herumkommandieren.
»So ein Früchtla«, waren die letzten Worte seines Vaters an seine Mutter, bevor Walter außer sich vor Zorn die Haustüre von außen zuknallte, »ich frag mich im Nachhinein bloß, wie du den so erziehn hast können, den Bangert, den nichtsnutzigen?«
9
Norbert Amon quälte ein schlechtes Gewissen. Er war nicht mehr davon überzeugt, dass es richtig war, Müselüm Yilmaz von der Beziehung zwischen Walter und der Akgül berichtet zu haben. Er fühlte sich wie ein Verräter. Schließlich war der Walter doch immer noch sein bester Freund, auch wenn er zwischenzeitlich mehr Zeit mit seiner türkischen Freundin verbrachte als mit ihm. Aber er war einfach wütend, als er selbst von der Geschichte erfuhr. Zufällig. Er hatte das Gespräch zwischen der schwatzhaften Daggi Weber von nebenan und seiner Mutter belauscht, als die Daggi davon erzählte, dass sie den Walter knutschenderweise in Coburg gesehen hatte. Mit der Akgül Özkan. Der Türkin.
»So was macht mei Norbert net«, hatte seine Mutter stolz geantwortet. So ein Blödsinn. Natürlich würde er der Akgül jederzeit gerne an ihre strammen Titten greifen, wenn er die Chance dazu hätte. Aber er hatte bei Frauen eben kein Glück. Er war nun mal kein Adonis, mit seiner Körpergröße von nur einem Meter siebzig, seinen vierundachtzig Kilogramm Lebendgewicht, den Rettungsringen um seine Taille und seiner pockennarbigen Gesichtshaut. Eigentlich hatte er noch nie eine feste Beziehung mit einem Mädchen gehabt. Das kurze Techtelmechtel mit der spindeldürren Hannelore Adam konnte man nicht als Beziehung bezeichnen. Eher als gescheiterten Fehlversuch. Selbst die hatte ihm den Laufpass gegeben. Na ja, daran war er auch nicht ganz schuldlos. Er erinnerte sich noch genau. Ein halbes Jahr war es jetzt her, als sie sich nachts nach einer Party, leicht vom süßen Alkohol betutelt, gemeinsam auf den Nachhauseweg machten. Er spielte den Charmeur und hatte ihr angeboten, sie zu begleiten. »Brauchst ka Angst zu ham, ich bring dich schon heim«, hatte er ihr gesagt und sie dabei schmachtend angesehen. Sie lächelte ihn dankbar an. Als sie an der Lohmühlhalle vorbeikamen, nahm er all seinen Mut zusammen und drängte Hannelore mit seinem Körpergewicht zielstrebig in das gegenüberliegende Wäldchen. Sie ließ es geschehen. Als er sie dann stürmisch küsste, hatte sie noch immer nichts dagegen. Er wollte mehr. Ermutigt griff er ihr blitzschnell mit beiden Händen unter ihren Pullover und schob ihr den BH fast bis unters Kinn. Dann griff er zu. Besser gesagt, er wollte zugreifen. Doch da war nichts, außer zwei nicht erwähnenswerten, leichten Schwellungen, auf denen je eine Brustwarze saß. Statt der erhofften, straffen Schnaufhügel legte er einen Wust an Stofftaschentüchern frei, welche sanft auf den Waldboden fielen. Anstelle sexueller Wallungen bekam er dann einen kräftig geführten Boxhieb auf die Nase, und Hannelore lief schreiend und schluchzend davon. Er war so verdattert, dass er zunächst überhaupt nicht reagierte. Er stand einfach nur da und in seinem Gehirn hämmerten die Geräusche, welche Hannelores klappernde Absätze auf dem Straßenasphalt verursachten, als sie in der Dunkelheit verschwand. Seine Schwellung im Schritt war auch längst verflogen. Dann hob er die am Boden liegenden Taschentücher auf und zeigte sie am nächsten Tag seinen Saufbrüdern vom Stammtisch Sauf mer nu ans. Norberts Erlebnis machte die Runde unter den Heranwachsenden und Jugendlichen in Röttenbach. Leider ließ es sich in der Folgezeit nicht ganz vermeiden, dass er und Hannelore sich ab und zu im Dorf über den Weg liefen. Hätten ihre Blicke töten können, wäre er jedes Mal einen extrem qualvollen Tod gestorben.
Norberts Gedanken glitten in die Gegenwart zurück. Vor fünf Minuten hatte ihn Doris Kunstmann angerufen. Er hatte sich am Telefon gewunden wie ein Aal, aber sie bestand darauf, dass er ihre Fragen beantwortete. Er war eben kein guter Lügner.
10
Adem Gökhan war vor drei Jahren aus seiner Heimatstadt Ankara an das Türkische Generalkonsulat in der Regensburger Straße in Nürnberg versetzt worden. Von Anbeginn fühlte er sich in der fränkischen Metropole pudelwohl. Mit seiner Frau Ipek und seiner Tochter Akasya bewohnte er seitdem einen kleinen Bungalow im südöstlichen Stadtteil Nürnberg-Fischbach. Wenn da nicht dieser unglückselige Unfall gleich zu Beginn seines Amtsantritts gewesen wäre, ginge es ihm heute noch deutlich besser. Von Zeit zu Zeit erinnerte er sich an das tragische Ereignis von damals. Es war am 17. März 2010. An diesem Tag war er mit seinem Pkw dienstlich zur türkischen Botschaft in Berlin unterwegs, um sich persönlich beim Botschafter seines Landes vorzustellen. Er war fast am Ziel angelangt, als auf der Tiergartenstraße in Höhe Clara-Wieck-Straße ein Junge quer über die Fahrbahn lief. Der Kleine ignorierte den schnell dahinfließenden Verkehr. Er war plötzlich da, ein huschender Schatten. Adem hatte nicht die geringste Chance zu reagieren. Ein wuchtiger Schlag gegen das Fahrzeug, dann wirbelte ein kleiner Körper durch die Luft, flog über das Dach seines silbergrauen Volvos hinweg und schlug hart auf dem Straßenasphalt hinter ihm auf. Auch der nachfolgende Fahrer des grünen Ford Escort hatte keine Chance mehr, rechtzeitig zu bremsen. Er überrollte den reglosen Körper, der bereits aus Nase und Ohren blutete. Der zehnjährige Muhammed Abusharekh, Sohn von Ali Abusharekh, war sofort tot. Die Gerichtsverhandlung im Frühjahr dieses Jahres ging wie erwartet gut für Adem Gökhan aus. Der Richter sah keinerlei Verschulden, welches dem Unglücksfahrer hätte angelastet werden können, und sprach den Mitarbeiter des Türkischen Generalkonsulats von jeglicher Schuld frei. Die palästinensische Großfamilie Abusharekh aus Berlin-Neukölln sah die Schuldfrage allerdings völlig anders als der deutsche Richter: Der Sohn der Abusharekhs sei getötet, der Täter aber nicht bestraft worden. Der Vorfall müsse nach den Bestimmungen der Scharia geregelt werden, forderten sie.
Als Adem Gökhan sich Anfang 2013 erneut auf den Weg nach Berlin machte, um, wie er hoffte, mit den Abusharekhs in einem Versöhnungstreffen zu erreichen, dass man sich nach alter arabischer Tradition die Hände reichen und Tee trinken würde, stellte er schnell fest, dass er sich gewaltig geirrt hatte. Als er die Wohnung der Familie Abusharekh betrat, wusste er, dass die Familie des Unfallopfers keine Friedenspfeife rauchen wollte. Fünfunddreißig Familienmitglieder und der Imam einer Neuköllner Moschee empfingen ihn. Der Geistliche rezitierte aus dem Koran und empfahl erneut, dass der Fall nach der Scharia geregelt werden sollte. Adem protestierte. »Ich akzeptiere die Scharia nicht«, stieß er wütend aus. »Wir leben in Deutschland und unterliegen der deutschen Rechtsprechung. Ich bin von einem ordentlichen deutschen Gericht freigesprochen worden. Mich trifft keine Schuld an dem unglücklichen Unfall.« Seine Argumente beeindruckten den Imam jedoch in keinster Weise. Er forderte Schadenersatz für die leidvoll geplagte Familie. Die Abushareks hörten die Worte des Imam und nickten mit versteinerten Mienen. Adem Gökhan solle den Gegenwert von achtzig Kamelen entrichten, dann wäre die Angelegenheit erledigt. Der Imam errechnete einen Betrag von 44.000 Euro. Nach heftigen Verhandlungen blieb immer noch ein Betrag von 30.000 Euro übrig, aber auch den lehnte Adem Gökhan aus Prinzip ab. »Wir wollen dich nicht bedrohen, aber wenn du auf der Straße bist, können wir für dein Leben nicht garantieren«, erklärte ihm Ali Abusharekh mit hasserfüllten Augen. Adem Gökhan wandte sich sowohl an die Berliner, als auch an die Nürnberger Polizei. »Die Abusharekhs gehen geschickt vor, sie haben keine direkte Bedrohung ausgesprochen«, erklärte ihm Lorenz Illgen, Leiter des Dezernats Organisierte Kriminalität beim Berliner Landeskriminalamt. »Obwohl wir wissen, dass Teile der Familie sich in der Vergangenheit durch Eigentums- und Gewaltdelikte hervorgetan haben, können wir aktiv nichts gegen sie unternehmen. Wir sind quasi zur Zuschauerrolle verdammt.«
11
Die Röttenbacher Kirchweih gehörte bereits der Vergangenheit an, und der September neigte sich seinem Ende zu. Die Tage waren merklich kühler geworden, und in den frühen Morgenstunden hingen die ersten herbstlichen Morgennebel über den feuchten Wiesen und den zahlreichen Karpfenweihern. Auch die milde Sonne war zwischenzeitlich immer öfter von tief segelnden Wolken verdeckt und trug einen nahezu aussichtslosen Kampf aus, um die Nebelschwaden bis zur Mittagszeit aufzulösen. Die Röttenbacher Störche hatten ihr Nest auf dem Brauhaus der Brauerei Sauer vor Kurzem verlassen und sich auf ihren weiten Weg in Richtung Süden begeben. CDU/CSU hatten die Bundestagswahlen mit deutlichem Abstand gewonnen, und die SPD und die Grünen leckten ihre Wunden. Die Freien Demokraten waren in ein Loch der Bedeutungslosigkeit abgestürzt.
Das alles hatte für Bernd Auerbach keine wirkliche Bedeutung. Keine der genannten politischen Parteien vertrat seine Interessen. Er und seine Lebenspartnerin hatten sich in Röttenbach zwischenzeitlich einigermaßen zurechtgefunden. Einigermaßen, denn mit den Franken hatten die beiden noch so ihre Probleme. Nicht mit den zwischenmenschlichen Beziehungen. Die waren im Grundsatz kein Thema, denn die einheimischen Aborigines sind von Grund auf gutmütige Menschen. Sie hatten ja nicht die geringste Ahnung, warum die beiden Sachsen ins Fränkische gezogen waren und was sie vorhatten. Der mittelfränkische Dialekt war es, der den beiden Neubürgern aus Sachsen noch Schwierigkeiten bereitete. Der Ausspruch »Tut euch na net o, des wird schon noch wern« klang für die zwei Ostdeutschen wie Jodeln auf Fränkisch. Auf ihre Frage, wie sie denn zur nächsten Gaststätte gelangen könnten, erhielten sie zur Antwort: »Da gehst die Straß gar nauf, auf die ander Seitn nieber, a Stückerla grad aus – net weit – dann bist scho da.« Dennoch, die Franken waren okay, nette Leute, aber auch unheimlich neugierig. »Gell, ihr seid net vo da? Wo kommen wir denn her?« Mit dem »wir« konnten die beiden Sachsen schon rein gar nichts anfangen. »Was macht ihr denn bei uns, in Franken?« Immer wieder wurden sie während der einheimischen Kirchweih im Festzelt mit solchen Fragen konfrontiert. »So, aus Saxn seid ihr! Gibts dort a Karpfn und Schäuferle? Net? Was esstn dann ihr?« Ständig sprachen die Einheimischen über Karpfen, das Aischgründer Karpfenland oder der Einfachheit halber einfach nur von ihrem Karpfenland. Bernd Auerbach hatte keine Ahnung und konnte nicht mitreden, bis er bei der NORMA einen der Ur-Röttenbacher traf, den Sieberts Schorsch, der ihn ansprach. »Wohnst du a in Röttenbach? Dich habbi hier bei uns goar nunni gsehn«, wollte der Schorsch wissen. »So, aus Saxn kommst. Kennst du dich denn bei uns im Karpfnland scho aus? Net, gell?« Der Sieberts Schorsch schien alle Zeit der Welt zu haben sowie ein großes Mitteilungsbedürfnis und folgte ihm bis hinaus auf den Parkplatz, wo sein Fahrrad stand. »Unser Karpfnland is ka einheitlichs Gebilde«, setzte der Schorsch seine Rede draußen fort. »Wir liegn scho a weng abseits vom Schuss, und des Auffälligste in unserer Gegend sen die vielen Weiherketten, in dene unser Aischgründer Spiegelkarpfn heranwächst. Mehr als siebentausend Karpfenweiher gibts bei uns, mit aner Flächn vo mehr als dreitausend Hektar. Drei Joahr braucht su a Fisch, bis er aufn Teller kummt. Scho die Mönch im Mittelalter ham den Karpfn als Fastenspeise zücht. Du musst wissen, den Spiegelkarpfen gibts nur in den Monaten, die ein R in ihrm Noma tragn, vo September bis April, und unser Karpfnland liegt in einem Dreieck, des die Städte Nermberch, Bamberch und Neustadt an der Aisch verbindet. Drum redn wir a hauptsächlich vom Aischgrund. Bei uns gibts Störch, Mühln und a Haufn Burgn und Felsenkeller. Soll ich dir auch die Gschicht vo unsere Felsnkeller derzähln? Do kriegst du eine hervorragende Brotzeit und ein Spitznbier.«
»Nein, danke«, antwortete Bernd Auerbach höflich. »Vielleicht das nächste Mal.« Er musste grinsen, wenn er über die Einheimischen nachdachte. Den Fußweg zum nächsten Bierkeller in Neuhaus hatten er und seine Freundin bereits Anfang September längst für sich entdeckt, und sie genossen die kurze Wanderung durch den Wald, um sich auf dem Felsenkeller der Familie Würth niederzulassen und das schmackhafte Kellerbier sowie eine deftige Brotzeit zu genießen. Sie hatten noch nie von einem Bratwurstsalat oder Bratwurst-Schaschlick gehört. Auch der knusprige Krustenbraten war ihnen fremd gewesen. Durch Zufall schlenderten sie in Röttenbach die Schulstraße dorfauswärts entlang und kamen bald zum Neubaugebiet Am Sonnenhang. Riesige Erdbewegungen waren dort zu beobachten. Baumaschinen, Kräne und Bagger waren im Einsatz, als ihnen ein Jogger entgegenkam. »Entschuldigung«, sprach ihn Anna Wollschläger an, »können Sie uns sagen, wohin dieser Weg führt?« Dabei deutete sie in Richtung Westen, raus aus dem Dorf.
»Wenn Sie hier hochgehen«, antwortete der Freizeitsportler und schnaufte dabei wie ein mittelalterlicher Postgaul, »kommen Sie in den Wald. Laufen Sie immer den Hauptweg entlang, bis zu einer Weggabelung. An einem Baumstamm finden Sie ein Hinweisschild, das Ihnen den Weg zum Neuhauser Bierkeller zeigt, ungefähr drei Kilometer von hier.« Er sah auf seine Armbanduhr. »In einer halben Stunde wird geöffnet.« Dann drehte er sich, ohne ein weiteres Wort zu verlieren, um und lief wieder davon.
»Dankeschön«, rief ihm Anna Wollschläger nach. Die beiden Sachsen nahmen ihren Weg wieder auf und durchliefen, kurz nachdem die Schulstraße in einen breiten Feldweg übergegangen war, einen Hohlweg, dessen Ränder mit dichten Schlehenhecken und wilden Kirschbäumen bewachsen waren. Immer weiter ging es bergan. Links und rechts des Weges standen nun Getreidefelder. Bald würden die mächtigen Mähdrescher mit ihren riesigen, messerbewehrten Mäulern kommen und sich die satt gewachsenen Ähren einverleiben. Doch noch drang das kräftige Blau der Kornblumen und das tiefe Rot des Klatschmohns aus den Rändern der Getreidefelder. Als die beiden die Anhöhe erklommen hatten, kurz vor dem Waldrand, blieben sie stehen. Rechter Hand erschlossen sich ihnen weite Blicke bis nach Erlangen und Nürnberg. Geradeaus und links konnten sie bis in die hügelige Landschaft der Fränkischen Schweiz sehen. »Schön hier«, entfuhr es Anna Wollschläger. Fasziniert genossen sie weitere fünf Minuten die Schönheit der Landschaft und tauchten bald darauf in den kühlenden Schatten des Waldes ein. Mühelos fanden sie das beschriebene Hinweisschild und ließen sich eine halbe Stunde später auf einer der schattigen Bänke des Bierkellers nieder. »Das nenne ich Lebensqualität«, urteilte Bernd Auerbach, als er den ersten, tiefen Schluck des süffigen und kühlen Kellerbieres zu sich genommen hatte. »Die Franken leben im Paradies«, meinte er. Drei Mal besuchten die beiden Sachsen den Neuhauser Bierkeller in kurzen Abständen.
*
Bernd Auerbach fuhr in einem alten VW Golf, den er in Fürth auf einem öffentlichen Parkplatz aufgebrochen und kurzgeschlossen hatte, das Stadtgebiet von Nürnberg an. Bereits Tage zuvor hatte er sich vergewissert, dass der Parkplatz nicht kameraüberwacht war. Der schwere Rucksack, den er getragen hatte, lag nun auf der Rücksitzbank. Die Kapuze seines Anoraks hatte er vom Kopf gezogen, aber die Sonnenbrille behielt er nach wie vor auf der Nase, obwohl die Sonne selbst überhaupt nicht zu sehen war. Nun fing es sogar leicht zu nieseln an. Seine Hände, welche den Pkw in eine leichte Linkskurve zogen, steckten in feinen Lederhandschuhen. Aufmerksam kontrollierte Bernd Auerbach den rollenden Verkehr vor und hinter sich. Immer wieder wanderten seine Augen auf den Innenspiegel des Pkw. In dieser frühen Morgenstunde war noch nicht viel los auf den Straßen der Stadt. Der Berufsverkehr setzte gerade erst ein und er hatte noch mehr als eine Stunde, um sein Vorhaben auszuführen. Zeit, schnell noch im bunten Treiben der Bahnhofshalle bei McCafé ein Frühstück einzunehmen.
Der warme Kaffee tat ihm gut, und er dachte an seinen ersten Auftrag, den er vor zwei Wochen von Thomas Keller erhalten hatte. Endlich ging es los. Endlich konnte er seinen bescheidenen Beitrag für ein besseres Deutschland leisten. Nun konnte er beweisen, was in ihm steckte, und auch die angemietete Scheune in Röttenbach konnte nun sinnvoll genutzt werden – die Scheune, in die er sich die letzten Tage zurückgezogen hatte und seiner Arbeit nachgegangen war. »Würden die Röttenbacher wissen, was in dem Gebäude gelagert ist«, dachte er sich, »wären sie kaum so umgänglich und hilfsbereit.« Wie weise von Thomas Keller, so einen geräumigen Lager-und Arbeitsraum gleich mit anzumieten. Der plastische C4 Sprengstoff aus den ehemaligen NVA-Beständen, die TNT-Zünder, die Sprengkapseln, die Relais und Handtastaturen, die Metallkugeln, die zwei automatischen Schnellfeuergewehre, die amerikanischen Splitterhandgranaten, die Thomas Keller aus dem Kosovo besorgt hatte, Pistolen und Munition – kurzum alles, was sich zum Kampf gegen die verhassten Ausländer einsetzen ließ und sich im Umzugsgut befand, hatte in der Scheune ausreichend Platz gefunden. Als Ergebnis lagen nun zwei selbstgebastelte Bomben auf dem Rücksitz des alten VW Golfs und warteten auf ihren tödlichen Einsatz. Zwei Feuerlöscher der Marke Gloria steckten in dem Rucksack. Er hatte das Löschpulver sorgfältig entfernt, den Boden sowie die Seitenwände der Behälter mit Blei verstärkt und den verbliebenen Raum mit Stahlkugeln aufgefüllt. Der kittähnliche Sprengstoff, die TNT-Zünder, Relais, Akkus – alles war professionell arrangiert. Sobald er die Zündung auslöste, würden die Metallkugeln an den schwächsten Stellen der Behälter in einem berechneten Sechzig-Grad-Winkel mit einer derartig gewaltigen Zerstörungskraft und Geschwindigkeit nach vorne austreten und verheerende Schäden an Mensch und Material anrichten. So war es geplant, so sollte es sein. Bernd Auerbach freute sich schon insgeheim auf das bevorstehende Feuerwerk. Er sah auf seine Armbanduhr. Noch eine halbe Stunde. Danach würde das Türkische Konsulat nicht mehr das sein, was es im Moment noch war.