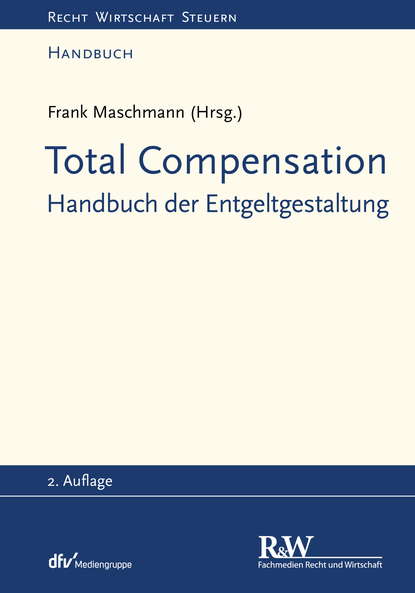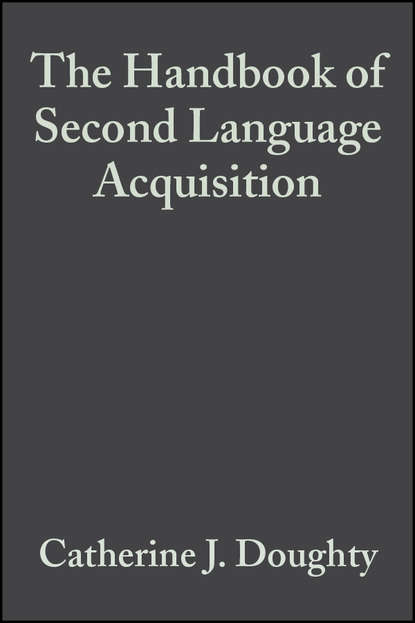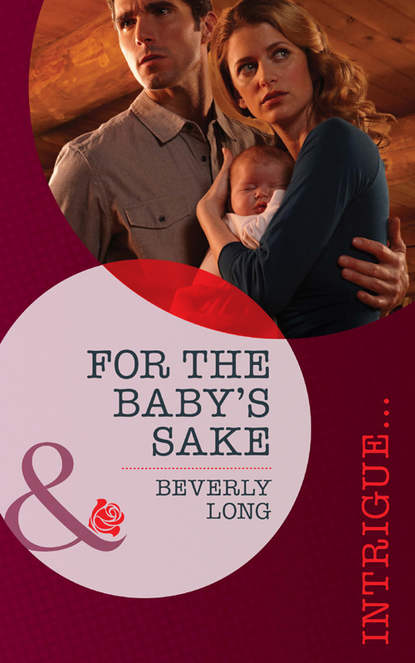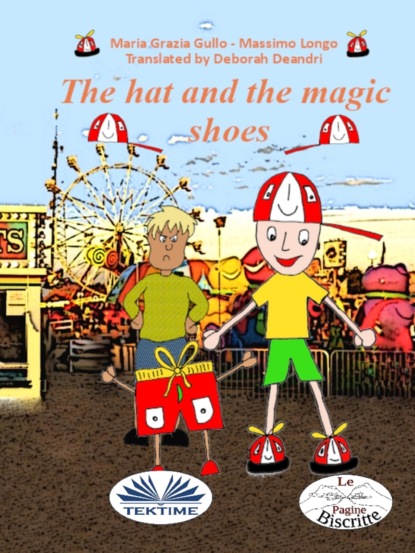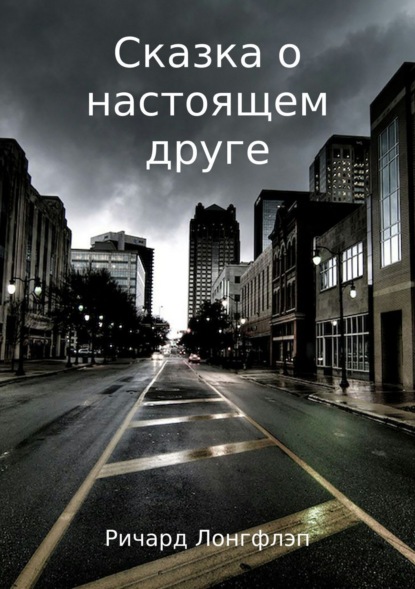Compliance-Handbuch Kartellrecht
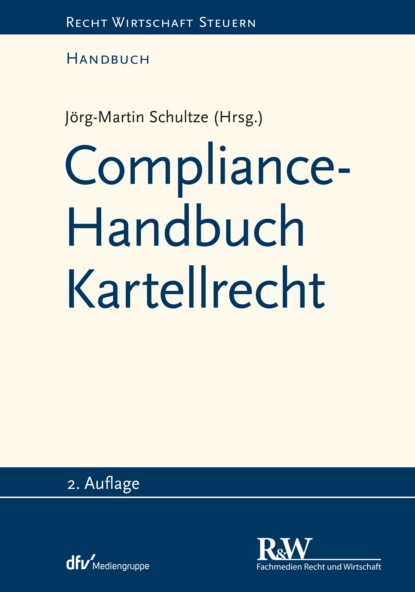
- -
- 100%
- +
133
Wie vermeintlich unkompliziert ein kartellrechtlich verbotener Informationsaustausch mit modernen Kommunikationswegen erreichbar ist, belegt das Rekordbußgeld der Kommission von EUR 1 Mrd. gegen verschiedene Großbanken im Devisenhandel aus dem Jahr 2019:
Am 16.5.2019 einigte sich die Kommission auf die Beendigung von Verfahren mit verschiedenen Großbanken gegen ein Gesamtbußgeld von EUR 1,07 Mrd. für Kartellrechtsverstöße im Devisenkassahandel.153 Dem Bußgeld lagen Informationsaustausch und auf diesen gestützte stillschweigende Kartellabsprachen zugrunde: Nach Ermittlungen der Kommission hatten Händler, die bei den betroffenen Großbanken für den Forex-Kassahandel mit den liquidesten und weit verbreitetsten Währungen weltweit betraut waren, in Online-Chatrooms sensible Informationen und Handelsabsichten ausgetauscht und ihre Handelsstrategien auf diese Weise koordiniert. Devisenhandelsgeschäfte werden ausschließlich am selben Tag zu den geltenden Wechselkursen durchgeführt. Die in den Chatrooms „Three-Way-Banana-Split“ (organisiert von Händlern der Banken Barclays, Royal Bank of Scotland, JP Morgan, Citigroup und UBS) sowie „Essex Express“ (organisiert zwischen Händlern der Banken Barclays, RBS, MUFG und UBS) ausgetauschten sensiblen Geschäftsinformationen betrafen: offene Kundenaufträge (d.h. den vom Kunden angefragten Tauschbetrag und die jeweiligen Währungen sowie Angaben darüber, welcher Kunde an einem bestimmten Geschäft beteiligt war), Kurse für bestimmte Transaktionen, die offenen Risikopositionen der Händler (die Währung, die sie verkaufen oder kaufen mussten, um ihre Portfolios in die Währung ihrer Bank umzutauschen) und bestimmte Einzelheiten zu laufenden oder geplanten Handelstätigkeiten. Aufgrund des Informationsaustauschs konnten die Händler entscheiden, ob ihre Konditionen wettbewerbsfähig waren und sich – auf Basis informeller Absprachen – dann zugunsten einzelner Händler von Transaktionen zurückhalten. Die im direkten Wettbewerb zueinander stehenden Händler, von denen viele persönlich gut miteinander bekannt waren, loggten sich in der Regel für den gesamten Arbeitstag in multilaterale Chatrooms auf Bloomberg-Terminals ein und tauschten sich umfassend zu den genannten Themen aus. Der jahrelang andauernde Informationsaustausch wurde schließlich von UBS im Rahmen eines Kronzeugenantrags angezeigt. UBS erhielt vollständige Bußgeldimmunität.
134
Auch das Bundeskartellamt hat eine Reihe empfindlicher Bußgelder gegen Unternehmen wegen Kartellabsprachen,154 aber insbesondere auch wegen unzulässigen Informationsaustausches erlassen.155 Gegenstand dieses Informationsaustausches waren dabei nicht nur Informationen zu Verkaufspreisen, sondern auch zu sonstigen strategischen Informationen wie insbesondere Kundenforderungen, aktuelle Marktanteils-, Absatz- oder Umsatzzahlen.
„Bestimmte Arten des Informationsaustauschs zwischen Wettbewerbern sind kartellrechtlich unzulässig. Der Wettbewerb wird durch solche Verhaltensweisen beeinträchtigt, auch wenn es sich nicht um klassische Hardcore-Absprachen über Preise, Gebiete, Kunden oder Quoten handelt.“
Andreas Mundt, Präsident des Bundeskartellamtes in der Pressemitteilung vom 17.3.2011 zum Bußgeld von EUR 38 Mio. gegen drei Konsumgüterhersteller wegen Informationsaustausches.
135
Die Europäische Kommission gibt Unternehmen in ihren Horizontal-Leitlinien eine gewisse Hilfestellung bei der Identifizierung strategischer Informationen und nennt in diesem Zusammenhang beispielhaft, aber keinesfalls abschließend: Preise, Preisbestandteile, Kundenlisten, Produktionskosten, Mengen, Umsätze, Verkaufszahlen, Kapazitäten, Qualität, Marketingpläne, Risiken, Investitionen, Technologien, F&E-Programme und deren Ergebnisse.156 Letztlich fallen unter den Begriff der strategischen Informationen alle Informationen, die nicht ohne Weiteres öffentlich verfügbar sind und die Rückschlüsse auf das aktuelle bzw. künftige Marktverhalten eines Unternehmen ermöglichen. Dies muss nicht zwingend nur aus den ausgetauschten Informationen selbst gelingen. Es kann nach den Leitlinien der Kommission vielmehr bereits der marginale Zusatznutzen sein, der zu einem auf Informationsaustausch basierenden Kollusionsergebnis führt.157
136
Der Informationsaustausch ist dann ohne kartellrechtliche Relevanz, wenn aus den Informationen keine Rückschlüsse mehr auf das aktuelle oder künftige Verhalten eines Unternehmens gezogen werden können, etwa weil die Daten zu alt oder generisch bzw. aggregiert sind, oder wenn es sich um echte öffentliche Informationen handelt.158 Ob diese Voraussetzungen vorliegen, ist jeweils im Einzelfall zu prüfen.
137
Erhält ein Unternehmen strategisch relevante Informationen nicht direkt vom Wettbewerber, sondern vom neutralen Dritten, wie z.B. von einem Kunden im normalen Geschäftsverlauf, kann dies zulässig sein. Vorsicht ist geboten, wenn Dritte strategisch oder institutionalisiert zur Informationsbeschaffung eingesetzt werden159 oder gar als Moderator für einen unzulässigen Informationsaustausch oder eine Verhaltenskoordinierung eingesetzt werden. Letzteres ist unter dem Stichwort der Hub-and-spoke-Kartelle unter anderem von den Kartellbehörden in Großbritannien und Frankreich scharf sanktioniert worden.160 Der unzulässige Informationsaustausch über Dritte ist auch bei der Teilnahme eines Unternehmens an Marktinformationssystemen oder anderen statistischen Datensammlungen, wie z.B. Benchmarking-Studien auf Verbandsebene, kartellrechtlich stets genau zu prüfen.161
138
Da der unzulässige Informationsaustausch für nahezu jedes Unternehmen von besonderer praktischer Relevanz ist, sind Verhaltensrichtlinien in diesem Bereich besonders wichtig, um Mitarbeitern konkrete Anweisungen an die Hand zu geben, wie sie auf kritische Situationen richtig reagieren bzw. eine unzulässige Diskussion strategischer Informationen oder ihre bloße „Entgegennahme“ von vornherein vermeiden können. Aus diesen Verhaltensrichtlinien muss deutlich werden, dass:
– das bloße passive Zuhören die Risiken aus einem rechtswidrigen Informationsaustausch nicht ausschließt;
– der Mitarbeiter strategische Informationen von einem Wettbewerber stets explizit zurückweisen muss;
– Vorfälle solcher Art unverzüglich an die Rechts-/Compliance-Abteilung oder eine andere geeignete Stelle im Unternehmen gemeldet werden müssen, damit eine Risikoanalyse stattfinden und geprüft werden kann, ob weitere Reaktionen oder Konsequenzen erforderlich sind.
3. Gefahrenbereich Verbandstätigkeit
139
Die Compliance-Bemühungen auf Verbandsebene haben sich in den letzten Jahren signifikant verbessert, nachdem Verbände zunehmend in das Visier der Kartellbehörden geraten sind.162 Dennoch bleiben Verbandstreffen ein klarer Risikobereich für unzulässige Kartellabsprachen und insbesondere den unzulässigen Informationsaustausch zwischen Wettbewerbern, da der Verband ein Ort ist, an dem Wettbewerber regelmäßig und organisiert zusammenkommen. Es gibt zahlreiche (legale) Initiativen, die ein solches Zusammenkommen rechtfertigen und vielleicht sogar notwendig machen. Es gibt aber auch zahlreiche Gelegenheiten, um anlässlich solcher Zusammenkünfte gewollt oder ungewollt Teil einer kartellrechtswidrigen Abrede zu werden.
140
Aus Unternehmenssicht muss für eine wirkungsvolle Compliance-Arbeit zunächst geklärt werden, welche Mitarbeiter an welchen Verbandsaktivitäten teilnehmen. Je nach Ergebnis dieser Bestandsaufnahme bietet es sich in diesem Zusammenhang an, kritisch zu hinterfragen, ob die Teilnahme der jeweiligen Mitarbeiter sachlich gerechtfertigt ist. Eine sehr effektive Maßnahme ist es, Unternehmensmitarbeiter mit hoher operativer und strategischer Bedeutung (z.B. den Leiter Vertrieb oder Einkauf) aus der Verbandsarbeit auszuklammern und von vorneherein nur Personen zu schicken, die aufgrund ihrer Funktion keine unmittelbare Gefahr eines unzulässigen Informationsaustausches auslösen. Für die Zukunft sollte sichergestellt sein, dass jede Verbandsmitarbeit erfasst und zuvor freigegeben ist, bevor der jeweilige Unternehmensmitarbeiter seine Tätigkeit aufnimmt. Bestehen Zweifel, muss die Teilnahme ausgesetzt werden, bis die Zulässigkeit geklärt ist.
141
Auf diese Weise lässt sich sicherstellen, dass Unternehmensmitarbeiter, die an Verbandsaktivitäten teilnehmen
– vorrangig kartellrechtlich geschult werden und
– klare Verhaltensregeln an die Hand bekommen, wie sie sich in konkreten Situationen richtig verhalten.
142
Im Verbandskontext ist es dabei besonders wichtig, dass die entsprechend geschulten Mitarbeiter schon die Tagesordnung auf kartellrechtlich kritische Punkte hin durchsehen, um Zweifel über Diskussionen einzelner Tagesordnungspunkte bereits im Vorfeld abzuklären und ausräumen zu lassen. Zudem müssen in die Verbandsarbeit eingebundene Unternehmensmitglieder verinnerlicht haben, dass sie kartellrechtlich problematische Diskussionen unter deutlichem Hinweis abbrechen und ggf. die Sitzung verlassen und dies im Protokoll vermerken lassen müssen, um kartellrechtliche Risiken für das Unternehmen (d.h. ein eigenes Bußgeld oder eine Ausfallhaftung für einen zahlungsunfähigen Verband, siehe Rn. B 144) auszuschließen.
143
Neben dem generellen Risiko, dass der Verband als Ort für unzulässige Absprachen oder einen unzulässigen Informationsaustausch genutzt wird,163 ist im Verbandskontext insbesondere darauf zu achten, dass jede Form der statistischen Datensammlung, gleich ob im Zusammenhang mit Absatzstatistiken oder Benchmarking-Aktivitäten, mit kartellrechtlichen Grundsätzen im Einklang steht. Eine zulässige Datensammlung setzt insbesondere voraus, dass die individuellen Unternehmensdaten von einer neutralen, zur Verschwiegenheit verpflichteten Person (und nicht etwa vom Angehörigen eines Mitgliedsunternehmens) ausgewertet werden und nur in nicht-identifizierbarer Form, d.h. nur in solcher Form wieder an die Mitgliedsunternehmen herausgegeben werden, dass Rückschlüsse auf aktuelles oder künftiges Wettbewerbsverhalten von Wettbewerbern nicht mehr möglich sind.164
144
Auch aus Verbandssicht ist es notwendig, sich proaktiv mit kartellrechtlicher Compliance zu befassen. Gerade in Branchen, in denen auf Mitgliederebene noch wenig Bewusstsein für die Gefahren von Kartellverstößen besteht, ist der Verband ein zentrales Forum, um dieses Bewusstsein zu schärfen. Dies gilt schon deshalb, weil der Verband und seine Organe selbst sicherstellen müssen, nicht gegen Kartellrechtsregeln zu verstoßen. Haben Verbandsorgane und -mitarbeiter Kartellaktivitäten gefördert, sind sie nach ständiger Praxis, insbesondere des Bundeskartellamtes, selbst Verfahrensbeteiligte und werden bei Nachweis der kartellrechtswidrigen Aktivitäten auch mit Bußgeldern belegt.165 Dies gilt wegen des im deutschen Ordnungswidrigkeitenrecht geltenden Einheitstäterbegriffs auch dann, wenn ihr Tatbeitrag regelmäßig „nur“ in physischer oder psychischer Beihilfe zu den Verstößen ihrer Mitglieder bestanden hat. Mit der 10. GWB-Novelle können Geldbußen gegen einen Verband – statt am eigenen Gesamtumsatz – alternativ auch am Gesamtumsatz seiner Mitglieder ausgerichtet werden, die auf dem vom Kartellverstoß des Verbandes betroffenen Markt tätig waren (§ 81c Abs. 4 GWB). Bei fehlender Zahlungsfähigkeit des Verbandes kann die Geldbuße auch direkt bei den Mitgliedsunternehmen eingetrieben werden. Für Unternehmen, deren Vertreter zum Zeitpunkt des Verstoßes den Entscheidungsgremien des Verbandes angehört haben, besteht dabei ein erhöhtes Risiko der Ausfallhaftung. Die neu eingeführte Regelung des § 81b GWB entspricht der europäischen Regelung in Art. 23 Abs. 4 VO Nr. 1/2003. Auch wenn die Ausfallhaftung in der Praxis der Kommission bislang keine besondere Relevanz erlangt hat, bedeutet dies nicht, dass das Bundeskartellamt künftig davon keinen Gebrauch machen wird. Vor diesem Hintergrund ist die genaue Prüfung umso wichtiger, welche Unternehmensvertreter in welcher Funktion in welchen Verbänden aktiv sind.
145
Der Fallbericht zur Wirtschaftsvereinigung Stahl166 zeigt, dass nicht selten eine umfassende Reorganisation von Verbandsabläufen nach Feststellung von Kartellverstößen erforderlich ist, um die Überlebensfähigkeit eines Verbandes zu sichern. Rein praktisch ist die Kündigung der Verbandsmitgliedschaft für viele Unternehmen ein zentraler erster Schritt, um ein positives Nachtatverhalten zu demonstrieren, wenn Kartelluntersuchungen im Verbandskontext eingeleitet wurden. Es ist hier also im elementaren Interesse der Verbände selbst, Vertrauen bei ihren Mitgliedern zu schaffen, indem sie durch Änderung von Strukturen und Abläufen zeigen, dass eine sichere Verbandsarbeit möglich ist. Diese verbandsinternen Schritte entbinden die Mitgliedsunternehmen natürlich nicht von der Verpflichtung, eigene Vorkehrungen und Compliance-Maßnahmen zur Einhaltung von Kartellrechtsregeln zu treffen, wenn sie die Risiken von Rechtsverstößen durch ihre Mitarbeiter künftig eindämmen wollen. Ohne eine Entsprechung auf Verbandsseite gehen diese unternehmensspezifischen Schritte allerdings ins Leere. Die Risiken, dass Mitarbeiter die Grenzen von Kartellrechtsverstößen anderenfalls verkennen und weiterhin an kartellrechtswidrigen Diskussionen, Datensammlungen etc. teilnehmen, sind ohne wechselseitige Vorkehrungen zu groß.
4. Gefahrenbereich Ausschreibungen
146
Der bereits 1997 eingeführte Sondertatbestand der Submissionsabsprache in § 298 StGB sieht vor, dass sich strafbar macht, wer bei einer Ausschreibung über Waren oder gewerbliche Leistungen ein Angebot abgibt, das auf einer Absprache beruht, die den Ausschreibenden zur Annahme eines bestimmten Angebots veranlassen soll. Ein Verstoß kann mit einer Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren oder mit Geldbußen geahndet werden.167 Von § 298 StGB sind öffentlich-rechtliche unbeschränkte und beschränkte Ausschreibungen aller Art erfasst. Auch private, d.h. durch Unternehmen oder auch Privatpersonen erfolgende Ausschreibungen fallen darunter, wobei die Anforderungen an das Vorliegen privater Ausschreibungen sehr gering sind. Der Gesetzgeber wollte Ausschreibungen möglichst lückenlos erfassen und bezieht deshalb in § 298 Abs. 2 StGB auch die freihändige Vergabe in den Schutzzweck der Norm ein. In der Vergangenheit ist das Zusammenspiel zwischen Strafrecht und GWB z.B. in den Kartellverfahren Feuerwehrfahrzeuge und Schienen sowie jüngst bei Technischer Gebäudeausrüstung zum Tragen gekommen.168
147
Nach der Rechtsprechung des BGH zu § 298 StGB ist davon auszugehen, dass von § 298 StGB alle Absprachen erfasst sind, die gegen das Kartellverbot verstoßen, sofern sie vom Wortlaut der Norm gedeckt sind.169 Damit kann der § 298 StGB auch dann verwirklicht werden, wenn die wettbewerbswidrige Abrede nicht zwischen aktuellen oder potenziellen Bietern, sondern zwischen Ausschreibendem und Bieter, also auf vertikaler Ebene getroffen wurde.170
148
Im Compliance-Kontext ist es zentral, dass allen Mitarbeitern, die mit Ausschreibungen befasst sind, die hohen kartellrechtlichen Risiken im Hinblick auf den Umgang mit ausschreibungsrelevanten Informationen bewusst sind. Das Bundeskartellamt hat bereits 2015 eine hilfreiche Broschüre auf ihrer Webseite veröffentlicht, die sehr konkrete Anhaltspunkte für Verdachtsmomente für das Vorliegen von Submissionsabsprachen enthält.171 Das Dokument ist vom Bundeskartellamt als Checkliste für Vergabestellen entwickelt worden, um diesen die Aufdeckung von Kartellrechtsverstößen zu erleichtern. Aus dieser Broschüre wie auch aus der Fallpraxis des Bundeskartellamtes wird deutlich, dass unter den Tatbestand selbstverständlich die Abgabe von Schutzangeboten wie auch der reine Informationsaustausch, etwa im Hinblick auf Angebotshöhe oder Interessenlage der Bieter fällt.172 Absprachen bzw. Informationsaustausch zu jedem einzelnen Projekt stellen insoweit eine eigene Tat dar.
149
Eine sorgsame Überprüfung des Angebotsverhaltens in Vergabeverfahren ist – wie bereits angesprochen – nicht nur zwingend, um Risiken für das Unternehmen, sondern auch um persönliche Risiken für die handelnden Mitarbeiter auszuschließen. Aufgrund des weiten Begriffs der kartellrechtswidrigen Abrede, die wie ausgeführt173 ja bereits die abgestimmte Verhaltensweise und damit letztlich auch den Informationsaustausch erfasst, der zu einer solchen Verhaltensweise führt, ist jede Kommunikation über eine Ausschreibung zu unterlassen. Dies bezieht sich nicht nur auf den Inhalt eines möglichen Angebots, sondern schon auf die Frage, ob ein Unternehmen an einer Ausschreibung teilnimmt oder nicht. Die Tragweite dieses Verbots ist den wenigsten Mitarbeitern ohne entsprechende Schulung bewusst.
150
Die Verfolgungsaktivitäten der Staatsanwaltschaft im Zusammenhang mit Submissionsabsprachen nehmen ständig zu.174 Submissionsabsprachen werden an das Wettbewerbsregister (siehe Rn. B 80) gemeldet.
5. Risikofaktoren für unzulässige Absprachen zwischen
Wettbewerbern – Checkliste Compliance
151
Folgende Fragen können einen ersten Ansatzpunkt bei der Analyse von Risikofaktoren für unzulässige Absprachen und/oder abgestimmte Verhaltensweisen zwischen Wettbewerbern liefern. Eine wirkungsvolle Compliance-Arbeit im Unternehmen muss ermitteln, ob und wenn ja welche besonderen Gefahrenbereiche in einem Unternehmen im Hinblick auf einen möglicherweise unzulässigen Informationsaustausch mit Wettbewerbern bestehen.
152
Checkliste: Risikofaktoren für unzulässige Absprachen
✓ Gibt es in den Geschäftsfeldern des Unternehmens bereits Anhaltspunkte für kartellrechtliche Untersuchungen?
✓ Haben in den Geschäftsfeldern oder bei Zulieferern oder Händlern des Unternehmens Durchsuchungen stattgefunden?
✓ Ist das Unternehmen auf Märkten aktiv, in denen eine hohe Markttransparenz herrscht oder auf andere Weise eine Reaktionsverbundenheit mit Wettbewerberverhalten festgestellt werden kann?
✓ Sind die Marktverhältnisse auf den relevanten Märkten starken Veränderungen ausgesetzt oder sind sie weitgehend stabil?
✓ Stellt das Unternehmen Produkte her, die sich von Wettbewerberprodukten vor allem über den Preis unterscheiden oder spielen andere Kriterien wie Qualität, Innovation etc. eine größere Rolle?
✓ Gab es in der Vergangenheit Umstände, die für alle Unternehmen am Markt Konsequenzen für die jeweilige Absatzstrategie hatten (z.B. Rohstoffpreiserhöhungen, Aufschläge, Steuererhöhungen, Umweltvorgaben etc.)? Wenn ja, gibt es Anhaltspunkte, dass Wettbewerber sich hier gleichförmig verhalten haben?
✓ Wie häufig finden Preisänderungen auf den relevanten Märkten statt? Gibt es einen einheitlichen Zeitpunkt für Preisänderungen, wenn ja, warum?
✓ Gibt es engen Kontakt zu Wettbewerbern? Wenn ja, von wem und zu welcher Gelegenheit?
✓ Sind die Kunden des Unternehmens z.T. auch seine Wettbewerber?
✓ Nimmt das Unternehmen an Ausschreibungen teil? Ist das Unternehmen Teil eines Bieterkonsortiums?
✓ Gibt es regelmäßigen Wettbewerberkontakt über Fachverbände, Messen oder ähnliche Veranstaltungen? Wer geht zu diesen Veranstaltungen? Wie wird über diese Veranstaltungen im Unternehmen berichtet?
✓ Gibt es Situationen, in denen sich das Unternehmen mit Wettbewerbern über Preise oder Verkaufsbedingungen austauscht?
✓ Sendet das Unternehmen Wettbewerbern direkte Informationen wie z.B. Preislisten zu oder erhält es solche Informationen von Wettbewerbern?
✓ Welche Rolle spielt die Preissetzung des Unternehmens für andere Teilnehmer im Markt?
✓ Kennt das Unternehmen die Preise, sonstige Verkaufsbedingungen oder künftige Strategien seiner Wettbewerber? Falls ja: woher? Kennen die Wettbewerber die Preise bzw. künftigen Strategien des Unternehmens? Falls ja: woher?
✓ Hat das Unternehmen jemals Schritte unternommen, um Wettbewerbern zu signalisieren, wie es sich im Markt verhalten wird bzw. welches Verhalten es von Wettbewerbern erwartet?
✓ Bestehen Kooperationsverträge mit Wettbewerbern?
✓ Setzt das Unternehmen Dritte systematisch zur Informationsbeschaffung ein?
✓ Gibt es Gemeinschaftsunternehmen oder sonstige Kooperationen mit Wettbewerbern, z.B. Einkaufskooperationen oder Internet-Marktplätze?
✓ Nimmt das Unternehmen an Marktinformationssystemen oder Meldeverfahren mit Wettbewerbern, z.B. auf Verbandsebene, teil?
✓ Nimmt das Unternehmen an Benchmarking-Studien teil?
6. Sonstige Absprachen zwischen Wettbewerbern
153
Nicht alle Vereinbarungen oder Kontakte zwischen Wettbewerbern sind verboten. Insbesondere Kooperationen, die es Unternehmen erst gemeinsam ermöglichen, einen Markt zu bedienen, den sie allein so hätten nicht betreten können, sind häufig kartellrechtlich zu rechtfertigen. Allerdings ist bei allen Kooperationen ein genaues kartellrechtliches Augenmerk erforderlich. Außerhalb der oben angesprochenen Hardcore-Kartelle und des unzulässigen Informationsaustauschs ist für die Beurteilung von wettbewerbsbeschränkenden Vereinbarungen das Regel-Ausnahme-Prinzip des europäischen und deutschen Kartellrechts, einschließlich der GVOen und der entsprechenden Leitlinien, besonders relevant. Dies bedeutet, dass es neben der konkreten inhaltlichen Ausgestaltung der jeweiligen Kooperation auch auf die Marktanteile und das Wettbewerbsumfeld der an der Absprache beteiligten Unternehmen ankommt.
154
In der Praxis müssen Kooperationen zwischen Wettbewerbern stets rechtlich geprüft werden. Das Kartellrecht muss dabei früh Beachtung finden, da es unmittelbare Auswirkungen auf die inhaltliche Ausgestaltung der Kooperation und nicht zuletzt deren Machbarkeit hat. Auch bereits seit langen Jahren bestehende Kooperationen müssen diese Prüfung durchlaufen.
155
Die Erfahrung zeigt: Gerade langjährige Kooperationen werden auf der Arbeitsebene als Muster für weitere Kooperationen ähnlichen Zuschnitts genutzt. Mit dem Argument, dass man ja „schon immer so gehandelt habe“ oder dass die Regelung gar „in der Industrie üblich“ sei, passiert es im Unternehmensalltag leicht, dass auch Vereinbarungen zwischen Wettbewerbern ohne Prüfung oder gar vollständig an der Rechtsabteilung vorbei geschlossen werden. Dies kann gravierende Folgen haben: Gerade auf der vertragskartellrechtlichen Ebene hat sich in den letzten Jahren durch die Reform der einschlägigen GVOen sowie die diese begleitenden Leitlinien Vieles verändert. Ältere Verträge spiegeln diese Veränderungen nicht wider. Dies gilt im besonderen Maße für Abreden, die vor der grundlegenden Reform des deutschen Kartellrechts im Jahr 2005 geschlossen wurden.
156
Nachfolgend werden insoweit nur die wichtigsten Rahmenbedingungen für eine solche Vertragsprüfung genannt. Die vertiefte Prüfung der jeweiligen Vereinbarung muss dann auf Ebene der Rechtsabteilung bzw. ihrer Berater im konkreten Einzelfall erfolgen.
6.1 Kooperationen im Rahmen der Gruppenfreistellungsverordnungen
157
Die Kommission hat mit den GVOen typisierte Ausnahmen vom Kartellverbot für eine Reihe von Vertragskonstellationen geschaffen (siehe ausführlich oben Rn. B 104ff.).
158
Die folgenden, besonders praxisrelevanten GVOen sind dabei (auch) zwischen Wettbewerbern anwendbar: