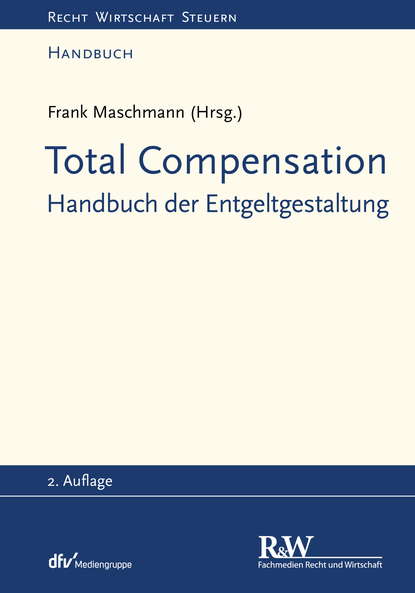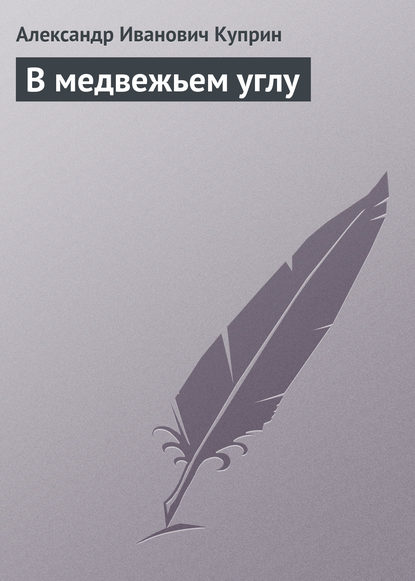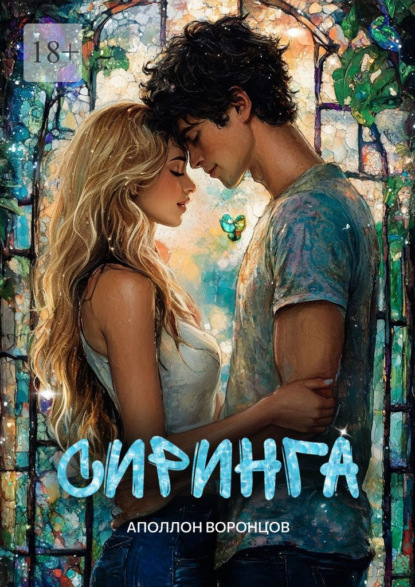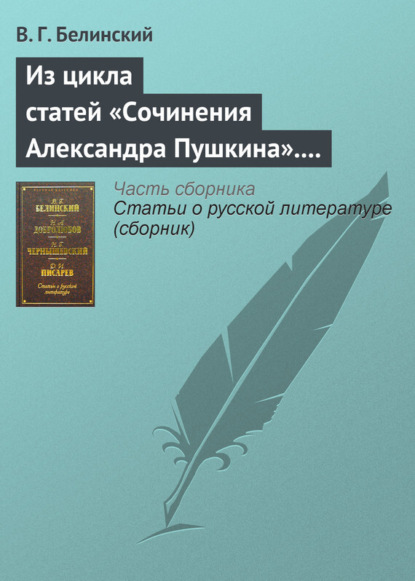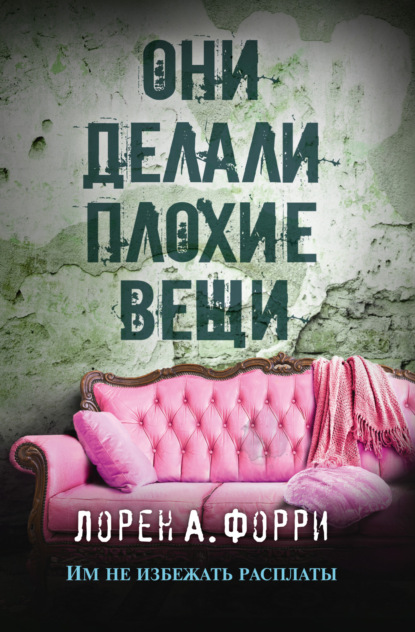Compliance-Handbuch Kartellrecht
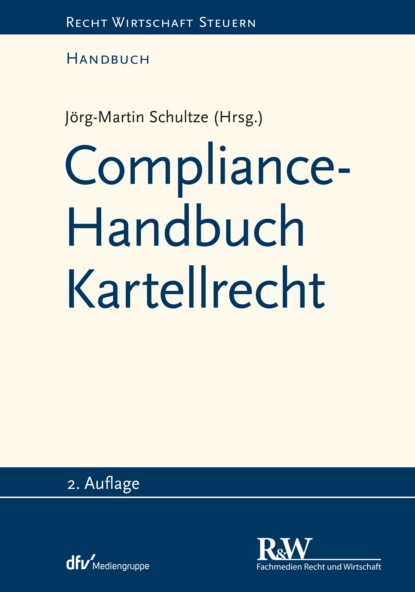
- -
- 100%
- +
– Spezialisierungs-GVO: Erfasst einseitige und zweiseitige Produktionsabreden mit ein- oder zweiseitigen Belieferungs- und Bezugsvereinbarungen zwischen Wettbewerbern bis zu einem gemeinsamen Marktanteil von höchstens 20 %.175
– F&E-GVO: Erfasst Forschungskooperationen und Auftragsforschung mit oder ohne gemeinsame Verwertung der Forschungsergebnisse. Die F&E-GVO gilt auch zwischen Wettbewerbern, sofern deren Marktanteil bei Abschluss der Vereinbarung höchstens 25 % beträgt.176
– TT-GVO: Erfasst Technologietransfer in Form von Know-how und/oder Patentlizenzen zur Herstellung von Vertragsprodukten. Die TT-GVO gilt auch zwischen Wettbewerbern, sofern deren Marktanteil höchstens 20 % beträgt.177
159
Es ist an dieser Stelle nicht möglich, vertieft auf diese Vertragstypen einzugehen. Als Grundregel gilt jedoch für alle oben genannten Kooperationen: Für ihre Strukturierung ist eine Kenntnis der einschlägigen GVOen und der begleitenden Horizontal-Leitlinien erforderlich. Die in den jeweiligen GVOen genannten Kernbeschränkungen sind bezweckte Wettbewerbsbeschränkungen, die die Anwendung der gesamten GVO für die beschränkenden Vereinbarungen entfallen lassen und für die innerhalb oder außerhalb der Grenzen einer GVO eine Ausnahme vom Kartellverbot nach den Grundsätzen der Legalausnahme grundsätzlich nicht in Betracht kommt.178
6.2 Kooperationen im Rahmen der Horizontal-Leitlinien
160
Für eine Reihe von Kooperationen zwischen Wettbewerbern gibt es keine typisierten und damit keine „automatischen“ Ausnahmen vom Kartellverbot in Form einer GVO. Dies gilt insbesondere für Einkaufskooperationen, Vermarktungskooperationen und Kooperationen zur Normung und Standardisierung. Sofern derartige Vereinbarungen nicht bereits die Ausschaltung zentraler Wettbewerbsparameter bezwecken und damit die Voraussetzung eines Hardcore-Kartells erfüllen, sind diese stets im Einzelfall daraufhin zu prüfen, ob sie die Voraussetzungen für die Legalausnahme nach Art. 101 Abs. 3 AEUV bzw. § 2 Abs. 1 GWB erfüllen. Hilfestellung dabei bieten die Horizontal-Leitlinien sowie daneben ggf. die Vertikal-Leitlinien der Kommission.179 Diese Leitlinien haben als Verwaltungsrichtlinien unmittelbare Bindungswirkung nur für die Kommission selbst, nicht jedoch für Gerichte oder nationale Behörden. Anders ist es nur, soweit sie unmittelbar den Verordnungstext erläutern. In der Praxis ist ihre faktische Wirkung allerdings auch im Übrigen hoch.
6.2.1 Einkaufskooperationen
161
Einkaufskooperationen zwischen Wettbewerbern sind sowohl im Hinblick auf ihre Auswirkungen auf dem Einkaufsmarkt wie auch auf den Absatzmärkten zu prüfen. Überschreiten die gemeinsamen Marktanteile der beteiligten Unternehmen auf allen von der Kooperation betroffenen Märkten einen Anteil von 15 % nicht, sind derartige Kooperation häufig zulässig.180 Dies setzt jedoch voraus, dass es über die Einkaufsgemeinschaft nicht zu einer unzulässigen Koordinierung des Wettbewerbsverhaltens kommt. Insofern ist stets eine genaue Prüfung ihrer Ausgestaltung notwendig. Wichtig ist insbesondere, dass die im Rahmen der Kooperation erforderlichen Beschränkungen der Mitglieder nicht „über das Ziel hinausschießen“. Kritische Punkte sind dabei insbesondere (i) etwaige Exklusivitätsregeln, die es den angeschlossenen Mitgliedern verbieten, ihren Bedarf außerhalb der Kooperation zu decken; (ii) Art und Umfang von Informationen, die zur Durchführung der Einkaufskooperation ausgetauscht werden, und (iii) der Grad, in dem die gemeinsam eingekauften Produkte oder Dienstleistungen zu einer Kostenvergemeinschaftung auf der Absatzseite zwischen den betroffenen Unternehmen führen.181
6.2.2 Vermarktungskooperationen
162
Vermarktungskooperationen zwischen Wettbewerbern sind die wohl kritischste Form der formellen Zusammenarbeit. Sofern die Unternehmen nicht über geringe Marktanteile von weniger als 15 % verfügen, sind derartige Kooperationen oft unzulässig, da sie in aller Regel den zentralen Wettbewerbsparameter Preis zwischen den kooperierenden Unternehmen ausschalten.182
163
Unter Compliance-Gesichtspunkten wird man sich eine Vermarktungskooperation zwischen Wettbewerbern also stets genau ansehen müssen. Eine Vermarktungskooperation ist grundsätzlich dann wettbewerblich unbedenklich, wenn sie objektiv erforderlich ist, einer Partei den Eintritt in einen Markt zu ermöglichen, auf dem sie sich allein oder in einer Gruppe, die kleiner ist als die an der Zusammenarbeit beteiligten Unternehmen, nicht behaupten kann.183 In praktischer Hinsicht ist dabei zentral, dass diese Analyse nicht auf die Gründungsphase einer solchen Kooperation beschränkt bleibt, sondern fortlaufend erfolgt. Zum einen, um sicherzustellen, dass die Unternehmen nicht „unbemerkt“ aus dem Rechtsrahmen herauswachsen, zum anderen, um sicherzustellen, dass die rechtlichen Grenzen auch bei der praktischen Zusammenarbeit nicht überschritten werden. Die Horizontal-Leitlinien halten insoweit fest, dass derartige Kooperationen stets unter dem Gesichtspunkt der unzulässigen Kollusion sowie dem Austausch von sensiblen Geschäftsdaten zu prüfen sind.184
6.2.3 Standardisierungskooperationen
164
Vereinbarungen über Normen oder Standardisierungen sind weit verbreitet und werden oft unterhalb des „Radars“ der Rechtsabteilung geschlossen, da sie sich allein auf die technische Zusammenarbeit beziehen und von den beteiligten Unternehmen stets nur unter dem Stichwort der positiven und effizienzfördernden Zusammenarbeit gesehen werden. Sie spielen insbesondere auf Verbandsebene eine besondere Rolle.
165
Auch die Kartellbehörden erkennen die positiven Wirkungen solcher Kooperationen grundsätzlich an.185 Unter Compliance-Gesichtspunkten sind diese Vereinbarungen jedoch schon deshalb im Auge zu behalten, weil stets sichergestellt sein muss, dass die handelnden Mitarbeiter die Grenzen des zulässigen Informationsaustausches kennen.
166
Darüber hinaus hält die Kommission in den Horizontal-Leitlinien fest, dass eine wettbewerbsbeschränkende Wirkung eines Normungs- oder Standardisierungsprozesses nur dann ausgeschlossen werden kann, wenn die Möglichkeit der uneingeschränkten Mitwirkung am Prozess gegeben, der Prozess transparent gestaltet und der effektive Zugang zur Norm/dem Standard unter fairen, zumutbaren und diskriminierungsfreien Bedingungen gewährleistet wird.186
167
In diesem Zusammenhang ist insbesondere darauf zu achten, ob der Prozess nur ein „Deckmantel“ ist, um sich gegen unliebsame Wettbewerber abzusetzen. Eine weitere Gefahr besteht in sog. Patentfallen. Hier wird die Technologie eines Unternehmens zum Standard erhoben, ohne dass dieses seine IP-Rechte zuvor offengelegt hat. Eine klare Kommunikation existierender Schutzrechte sowie die Abgabe einer sog. FRAND-Erklärung187 können kartellrechtswidrige Bedenken beseitigen.
127 Siehe dazu bei Rechtsfolgen unter Rn. B 69ff. 128 Siehe z.B. BKartA, Informationsbroschüre „Erfolgreiche Kartellverfolgung“, abrufbar unter www.bundeskartellamt.de. 129 Siehe dazu unter Rn. B 153ff. 130 Das GWB geht – anders als das europäische Kartellrecht – von einem relativen Begriff des kleinen und mittleren Unternehmens (KMU) aus, der sich weniger an den Konzernumsätzen als vielmehr an der Größe der Wettbewerber und sonstigen Marktteilnehmer orientiert. Ein KMU liegt zumindest dann vor, wenn ein Unternehmen weniger als EUR 25 Mio. Gesamtumsatz (einschließlich Konzernunternehmen) erzielt, Bechtold/Bosch, GWB, 9. Aufl. 2018, § 20 Rn. 9f., § 3 Rn. 11. 131 Siehe Merkblatt des Bundeskartellamtes über Kooperationsmöglichkeiten für kleine und mittlere Unternehmen, März 2007, abrufbar unter www.bundeskartellamt.de. 132 Weiterführend Ellger/Fuchs, in: Immenga/Mestmäcker, Wettbewerbsrecht, Bd. 2/GWB, 6. Aufl. 2020, § 3 Rn. 35ff. 133 Siehe dazu Rn. B 34. 134 Horizontal-Leitlinien, Rn. 61, mit Verweis auf EuGH, Rs. C-7/95, Rn. 87 (John Deere). 135 So in dem von der Kommission geahndeten Logistik-Kartell (2012). 136 So das von der Kommission geahndete Kartell im Bereich Bildröhren (2012). 137 So das vom Bundeskartellamt geahndete Kartell gegen Kaffeeröster (2009). 138 So die vom Bundeskartellamt geahndete Schlossrunde im Bereich Luxuskosmetika (2008). 139 So das vom Bundeskartellamt geahndete Schienen-Kartell (2012). 140 So das von der Kommission 2019 geahndete Kartell gegen Großbanken betreffend den Devisenhandel. 141 Siehe z.B. die vom Bundeskartellamt geahndeten Kartelle gegen Kaffeeröster (2009), Hersteller von Drogerieartikeln (2009 und 2013), Hersteller von Brillengläsern (2010), Stahl (2018) oder die von der Kommission geahndeten Kartelle gegen Hersteller von Badezimmerausstattungen (2010), Waschmitteln (2011), Fensterbeschläge (2012). 142 Komm., Pressemitteilung v. 5.12.2012, IP/12/1317. 143 BKartA, Pressemitteilung v. 13.1.2020. 144 Komm., Pressemitteilung v. 23.1.2013, IP/13/39. Die 116 Seiten lange Entscheidung ist auf der Webseite der Kommission veröffentlicht (AT. 39839). 145 Die Kommission muss das Bußgeld nach der Entscheidung des EuGH v. 13.12.2017 in Rs. C-487/16 P jedoch neu bestimmen. 146 Ausführlicher zum Informationsaustausch z.B. Dreher/Hoffmann, WuW 2011, 1181ff.; Auf’mkolk, WuW 2011, 699ff., Ewald, in: Wiedemann, Handbuch des Kartellrechts, 4. Aufl. 2020, § 7 Rn. 97. 147 Horizontal-Leitlinien, Rn. 62. 148 Horizontal-Leitlinien, Rn. 62. 149 Horizontal-Leitlinien, Rn. 62. 150 EuGH, Urt. v. 4.6.2009, Rs. C-8/08, Slg. 2009, I-4529 (T-Mobile Netherlands BV). 151 Autoriteit Consument en Markt, Pressemitteilung v. 27.9.2004. 152 EuGH, Urt. v. 4.6.2009, Rs. C-8/08, Slg. 2009, I-4529, Rn. 61, 62 (T-Mobile Netherlands BV). 153 Komm., Pressemitteilung v. 16.5.2019, IP 19/2568. 154 Siehe dazu bereits das Beispiel oben unter Rn. B 125. 155 Z.B. Bußgeld gegen Fernsehstudiobetreiber in Höhe von EUR 3,1 Mio., Pressemitteilung v. 27.7.2016; Bußgelder gegen Hersteller von Wärmeabschirmblechen in Höhe von insges. EUR 9,6 Mio., Fallbericht v. 18.8.2017, Az. B 12 16/13; Bußgeld gegen Nestlé Deutschland in Höhe von EUR 20 Mio., Pressemitteilung v. 27.3.2013; Bußgelder gegen sechs Hersteller von Marken-Drogerieartikeln in Höhe von EUR 39 Mio., Pressemitteilung v. 18.3.2013; Bußgelder gegen elf Markenhersteller von Süßwaren in Höhe von EUR 60,8 Mio. für Preisabsprachen und unzulässigen Informationsaustausch, Pressemitteilung v. 31.1.2013. 156 Horizontal-Leitlinien, Rn. 86. 157 Horizontal-Leitlinien, Rn. 93. 158 Horizontal-Leitlinien, Rn. 89–93. 159 Siehe z.B. die Verpflichtungszusage der Lufthansa gegenüber dem Bundeskartellamt wegen unzulässiger Rabatte für Firmenkunden, die der Lufthansa zur Umsatzrückvergütung ihrer Gesamtumsätze mit einer bestimmten Kreditkarte abgewickelte Flüge, einschließlich der Flüge mit Lufthansa-Konkurrenten, offenlegen mussten, BKartA, Pressemitteilung v. 1.12.2012. 160 Hasbro/Argos/Littlewood, Office of Fair Trading, 2003, No. CA98/8/2003; Hasbro/Carrefour et al., Autorité de la Concurrence, 20.12.2007, 07-D-50; kritisch dazu Stöcker, WuW 2012, 934ff. 161 Siehe dazu auch unter Rn. B 143. 162 Siehe z.B. Bußgeld gegen den Markenverband e.V., BKartA, Pressemitteilung v. 18.3.2013, oder gegen die Edelstahl-Vereinigung e.V., BKartA, Pressemitteilung v. 12.7.2018. 163 Siehe dazu unter Rn. B 127 und 139. 164 Nach den Grundsätzen des Bundeskartellamtes im Abschlussbericht zur Sektoruntersuchung Milch vom 1.12.2012 bedeutet dies, dass die Daten von mindestens fünf Unternehmen ausgewertet werden müssen, von denen das größte nicht über einen Marktanteil von mehr als 33 % verfügt und die beiden größten nicht einen gemeinsam Marktanteil von unter 60 % aufweisen. Zudem hielt das Bundeskartellamt für die Milchwirtschaft fest, dass Daten, die älter als sechs Monate sind, „historisch“ und damit nicht länger „strategisch“ relevant sind. 165 Siehe das Bußgeld des Bundeskartellamtes gegen den Markenverband im sog. Drogerie-Kartell, BKartA, Pressemitteilung v. 18.3.2013. 166 BKartA, Fallbericht v. 15.8.2018, Az. B5-16/18 -001 (Wirtschaftsvereinigung Stahl). 167 Siehe bereits unter Rn. B 70. 168 BKartA, Fallbericht v. 27.3.2020, Az. B11-21/14 (Technische Gebäudeausrüstung). 169 BGH, Urt. v. 25.7.2012, Az. 2 StR 154/12; dazu ausführlich Heuking, BB 2013, 1155ff. 170 BGH, Urt. v. 25.7.2012, Az. 2 StR 154/12. 171 BKartA, „Wie erkennt man unzulässige Submissionsabsprachen“ v. 19.8.2015, abrufbar unter www.bundeskartellamt.de. 172 Instruktiv insoweit Fallbericht BKartA v. 27.3.2020, Az. B11-21/14 (Technische Gebäudeausrüstung). 173 Siehe dazu bereits unter Rn. B 121. 174 Siehe dazu bereits unter Rn. B 72 sowie Fn. B 80. 175 Weiterführend zu Produktionsabreden Fuchs, in: Immenga/Mestmäcker, Wettbewerbsrecht, Bd. 1/EU, 6. Aufl. 2019, IV. Abschnitt VO 1218/2010 Rn. 1ff. 176 Weiterführend zur F&E-GVO Pautke, in: Wijckmans/Tuytschaever, Horizontal Agreements in EU Competition Law, 2015, 379ff.; Fuchs, in: Immenga/Mestmäcker, Wettbewerbsrecht, Bd. 1/EU, 6. Aufl. 2019, IV. Abschnitt VO 2017/2010 Rn. 1ff. 177 Ausführlich zur TT-GVO Fuchs, in: Immenga/Mestmäcker, Wettbewerbsrecht, Bd. 1/EU, 6. Aufl. 2019, IV. Abschnitt VO 316/201 Rn. 1ff. 178 Siehe zur Regelungstechnik der GVOen oben unter Rn. B 104. 179 Horizontal-Leitlinien, Rn. 194ff. 180 Horizontal-Leitlinien, Rn. 208. 181 Weiterführend Zimmer, in: Immenga/Mestmäcker, Wettbewerbsrecht, Bd. 1/EU, 6. Aufl. 2019, Art. 101 Abs. 3 Rn. 234ff. 182 Siehe dazu ausführlich Horizontal-Leitlinien, Rn. 252ff.; Zimmer, in: Immenga/Mestmäcker, Wettbewerbsrecht, Bd. 1/EU, 6. Aufl. 2019, Art. 101 Abs. 1 Rn. 240ff. 183 Horizontal-Leitlinien, Rn. 237. 184 Horizontal-Leitlinien, Rn. 242ff. 185 Horizontal-Leitlinien, Rn. 257ff. 186 Horizontal-Leitlinien, Rn. 280ff. 187 „FRAND“ steht für „fair, reasonable and non-discriminatory“.
VII. Vertikale Vereinbarungen
168
Neben den verbotenen Absprachen zwischen Wettbewerbern gehören auch bestimmte Wettbewerbsbeschränkungen zwischen Unternehmen auf verschiedenen Stufen der Produktions- bzw. Lieferkette, d.h. also im Vertikalverhältnis, zu den Kernpunkten wirksamer Compliance-Arbeit im Kartellrecht. Vereinbarungen zwischen Nicht-Wettbewerbern werden von nahezu allen Kartellrechtsordnungen weltweit im Grundsatz wohlwollender betrachtet als horizontale Vereinbarungen. Auch von bestimmten Vereinbarungen zwischen Nicht-Wettbewerbern geht jedoch ein kartellrechtliches Bußgeldrisiko aus. Dies gilt in besonderem Maße in Deutschland, wo vertikale Kartellverstöße bei den Verfolgungsaktivitäten des Bundeskartellamtes seit jeher eine wichtige Rolle einnehmen.
1. Typische vertikale Vereinbarungen
169
Entsprechend dem oben dargestellten Regel-Ausnahme-Verhältnis des europäischen und deutschen Kartellverbots188 beurteilen sich vertikale Wettbewerbsbeschränkungen insbesondere nach der Gruppenfreistellungsverordnung für Vertikale Vereinbarungen Nr. 330/2010 (Vertikal-GVO) sowie den Vertikal-Leitlinien.189 Die Vertikal-GVO sieht für ihre Anwendbarkeit neben dem Vorliegen einer „vertikalen Vereinbarung“ – wie für GVOen üblich – auch eine Marktanteilsschwelle vor. Von der automatischen Freistellung der Vertikal-GVO können Vereinbarungen profitieren, die den Kauf, Bezug oder Weiterverkauf von Waren oder Dienstleistungen zwischen zwei Unternehmen betreffen, die für Zwecke der Vereinbarung auf verschiedenen Stufen der Produktion oder des Vertriebs stehen. Die Marktanteile von Lieferant und Abnehmer dürfen dabei auf keinem der von der Vereinbarung betroffenen Märkte einen Anteil von 30 % überschreiten. Zudem ist die Vertikal-GVO – entsprechend der Regelungstechnik aller GVOen – insgesamt unanwendbar, wenn die vertikale Vereinbarung mindestens eine sog. Kernbeschränkung enthält.
170
Diese Kernbeschränkungen sind in Art. 4 der Vertikal-GVO aufgeführt. Der Einordnung dieser Beschränkungen als Kernbeschränkung liegt die durch die Gerichte bestätigte Auffassung der Kommission zugrunde, dass diese im Grundsatz eine Wettbewerbsbeschränkung bezwecken und eine Ausnahme vom Kartellverbot nach der Legalausnahme im Rahmen der individuellen Selbsteinschätzung grundsätzlich nicht in Betracht kommt.190 Verstöße gegen das Verbot dieser Kernbeschränkungen sind zudem unmittelbar bußgeldrelevant. Unter Compliance-Gesichtspunkten sind dabei insbesondere das Verbot der Preisbindung (Art. 4 lit. a Vertikal-GVO) und das Weiterverkaufsverbot im Hinblick auf Gebiete und/oder Kunden (Art. 4 lit. b Vertikal-GVO) von besonderer praktischer Bedeutung.191
1.1 Besonderheit für Handelsvertreter und andere Absatzmittler ohne vertrags- und marktspezifische Risiken
171
Wie bereits oben angesprochen, gibt es auch Beschränkungen in vertikalen Vereinbarungen, denen die Europäische Kommission sowie das Bundeskartellamt, bestätigt durch die Gerichte, eine wettbewerbsbeschränkende Wirkung gänzlich absprechen, da sie für das Zustandekommen einer kartellrechtlich neutralen Vereinbarung objektiv notwendig sind.192
172
Ein Beispiel für derartige Beschränkungen im Kontext vertikaler Vereinbarungen sind Handelsvertreterverträge.193 Handelt ein Handelsvertreter – oder ein in diesem Punkt mit einem Handelsvertreter vergleichbarer Absatzmittler, wie z.B. ein Kommissionär – ohne vertrags- und marktspezifische Risiken für die von ihm oder dem Prinzipal vertriebenen Produkte, bildet er mit dem Geschäftsherren eine wirtschaftliche Einheit und infolgedessen sind alle Beschränkungen, die ihm im Hinblick auf diese Produkte auferlegt werden (wie z.B. eine Preis- oder Kundenbindung, Gebietsbeschränkungen etc.) vom Anwendungsbereich des Kartellverbots ausgenommen. So stellen die Kommission und die Gerichte sicher, dass diese Vertragsform, die letztlich durch eine vollständige Steuerungsmöglichkeit der Absatzpolitik des Handelsvertreters durch den Prinzipal gekennzeichnet ist,194 überhaupt gelebt werden kann. Die Folgen eines „verunglückten“ Handelsvertretervertrags in kartellrechtlicher Hinsicht sind gravierend: Die in Handelsvertreterverträgen vorgenommene Absatzsteuerung mittels Preis-, Kunden- und Gebietsbeschränkungen führt unweigerlich zu Kernbeschränkungen, sollte der Absatzmittler wegen der von ihm zu tragenden Risiken doch als Händler anzusehen sein.
173
Die richtige Ausgestaltung von Handelsvertreterverträgen und die dort enthaltene vollständige Risikoübernahme durch den Prinzipal ist deshalb in der Praxis stets genau zu überprüfen.
1.2 Vertikale Preisbindung
174
Verboten und sowohl von der Kommission195 als auch vom Bundeskartellamt196 regelmäßig mit substanziellen Bußgeldern belegt sind direkte oder indirekte Beschränkungen des Verkaufspreises des Abnehmers in einer vertikalen Vereinbarung, die die Wirkung eines Fix- oder Minimumpreises haben. Unverbindliche Preisempfehlungen und Höchstpreisbindungen sind dagegen zulässig, solange sie nicht wie Fix- oder Mindestpreisbindungen wirken (vgl. Art. 4 lit. a Vertikal-GVO).
175
Das Verbot der Preisbindung im Vertikalverhältnis gehört zu den allgemein bekannten kartellrechtlichen Verboten. In Vertriebsverträgen finden sich direkte vertragliche Preisbindungen daher mittlerweile eher selten. Ein Einfallstor für eine Preisbindung können jedoch Regelungen zur Vorlage von Marketingplänen sein, wenn diese konkrete Pläne zur Vermarktung der Vertragsprodukte einschließlich Verkaufspreisen und/oder Rabatten enthalten. Auch sonstige vertragliche Regelungen, die entsprechend dem soeben gebildeten Beispiel einen Dialog oder einen irgendwie gearteten Konsens zwischen Lieferant und Vertriebspartner voraussetzen, um zu der aus Lieferantensicht richtigen Preissetzung zu gelangen, sind stets unzulässig. Die Praxis hat gezeigt, dass besonders hohe Bußgeldrisiken durch Marktstrukturen begünstigt werden, in denen Preistransparenz, Preisüberwachung und kontinuierliche preisbezogene Kommunikation zwischen Hersteller/Lieferant und Händlern stattfindet, die oft auch von horizontalen Elementen geprägt ist. Letzteres ist insbesondere dann der Fall, wenn z.B. konkurrierende Händler Markt-Konditionen beobachten und Lieferanten auffordern, „Preisbrecher“ unter Kontrolle zu bringen, um einen – auch aus Lieferantensicht – unerwünschten Preisrutsch zu vermeiden. So hat das Bundeskartellamt in seinem bisher größten vertikalen Verfahrenskomplex im Lebensmitteleinzelhandel (LEH) in den Jahren 2014 bis 2016 insgesamt 27 Hersteller von Bier, Süßwaren, Kaffee, Tiernahrung, Körperpflegeprodukten, Babynahrung und Kosmetik sowie die großen deutschen Lebensmittelhandelsketten mit Bußgeldern von insgesamt EUR 260 Mio. für vertikale Preisbindung sanktioniert.197 Die aus den Verfahren gezogenen Erkenntnisse für die Grenze zwischen zulässiger Preisempfehlung und unzulässiger Preisbindung veröffentlichte das Bundeskartellamt anschießend am 12.7.2017 in einem Hinweispapier zum Preisbindungsverbot im LEH.198 Dieses Papier ist, wenngleich auf den LEH zugeschnitten, auch in anderen Branchen von praktischer Bedeutung. Trotz der aktiven Rolle, die die großen Einzelhandelsketten in diesen Verfahren spielten, konnte das Bundeskartellamt letztlich keine ausreichenden Beweise für ein umfassendes horizontales Zusammenwirken in Form eines durch den Hersteller gemittelten Hub-and-Spoke-Kartells beibringen, was dann als horizontale Absprache geahndet worden wäre.199 Das Phänomen des Hub-and-Spoke-Kartells erfährt in Rn. 59f. des Hinweispapiers des Bundeskartellamtes dennoch eine eigene Erwähnung. Vergleichbare Formen von Preiskoordinierung haben auch in anderen EU Mitgliedstaaten sowie in Großbritannien in der Vergangenheit eine Rolle gespielt und zu hohen Bußgeldern geführt.200
176
Im Zusammenhang mit der Aufdeckung und dem Abstellen vertikaler Kartellrechtsverstöße ist in der Praxis insbesondere auf indirekte Preisbindungsklauseln zu achten. Zu Beginn der Compliance-Maßnahmen muss deshalb vor allem klar sein, ob unverbindliche Preisempfehlungen (UVP) im Unternehmen eine Rolle spielen und, wenn ja, wie diese kommuniziert und genutzt werden. Liegen Umstände vor, die vom Abnehmer als Druck oder Anreiz verstanden werden, die UVP einzuhalten, birgt dies hohe kartellrechtliche Risiken für den Lieferanten.
177
Indirekte Preisbindungen kommen zudem in Form von Festlegung bestimmter Höchstrabatte, Margen oder Gewinnspannen für den Abnehmer vor. Unzulässige indirekte Preisbindungen sind auch gegeben, wenn der Lieferant Mechanismen einsetzt, mit denen die Einhaltung bestimmter Verkaufspreise durch den Händler zwar nicht rechtlich bindend vorgegeben, aber inzentiviert oder bei entsprechenden Abweichungen sanktioniert wird.201 Kommission und nationale Behörden werten also auch Kündigungen oder angedrohte Kündigungen eines Vertriebsvertrages als Preisbindung, wenn diese vom Preisverhalten des Vertreibers motiviert sind.202 Das Bundeskartellamt hat in seinen jüngeren Bußgeldentscheidungen auch komplexe Rabattkalkulationen für den Vertreiber bzw. Folgegespräche zu vermeintlich zu geringen Preisen des Händlers als Verstoß gegen das Preisbindungsverbot mit Bußgeldern geahndet.203
178
Ein interessantes Beispiel für die Verfolgungsarbeit des Bundeskartellamtes stellt das bereits 2012 durch das Amt abgeschlossene Bußgeldverfahren gegen TTS Tooltechnik wegen Preisbindung dar. Der Fallbericht des Bundeskartellamtes wurde von diesem selbst mit der Überschrift „Mündlichkeit schützt vor Strafe nicht“ betitelt: