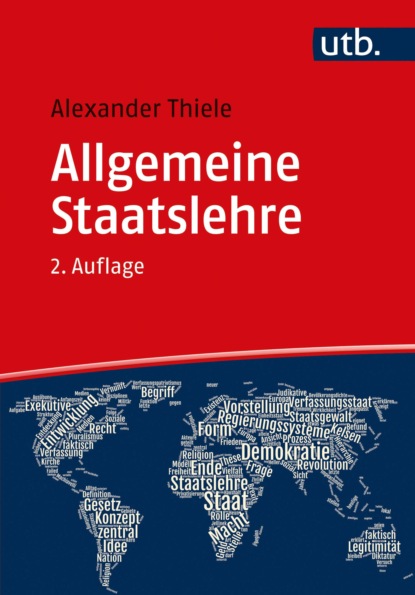- -
- 100%
- +
229
R. Hirschl/J. Mertens, Interdisziplinarität als Bereicherung. An den Grenzen von Verfassungsrecht und vergleichender Politikwissenschaft, in: J. Münch/A. Thiele (Hrsg.), Verfassungsrecht im Widerstreit, S. 105 (123).
230
C. Möllers, Der vermisste Leviathan, S. 113: „Diese Einsicht schließt nicht aus, dass es nach wie vor interessant sein mag, von sozialwissenschaftlicher wie von rechtswissenschaftlicher Seite zu suchen und zu sichten. Gerade die methodischen Einwände gegen eine engere Zusammenführung recht- und sozialwissenschaftlicher Forschung könnten sich jedenfalls aus Sicht der Rechtswissenschaften auf Dauer entschärfen.“
231
C. Möllers, Der vermisste Leviathan, S. 114.
232
Dazu zuletzt B. Oppermann/J. Stender-Vorwachs (Hrsg.), Autonomes Fahren, 2. Auflage 2019.
233
A. Doering-Manteuffel/B. Greiner/O. Lepsius (Hrsg.), Der Brokdorf-Beschluss des Bundesverfassungsgerichts, 2015.
234
Vgl. auch A. Bogner, Die Epistemisierung des Politischen, S. 98 ff.
235
R. Hirschl/J. Mertens, Interdisziplinarität als Bereicherung. An den Grenzen von Verfassungsrecht und vergleichender Politikwissenschaft, in: J. Münch/A. Thiele (Hrsg.), Verfassungsrecht im Widerstreit, S. 105 (116).
236
Siehe beispielhaft J. Lüdemann, Netzwerke, Öffentliches Recht und Rezeptionstheorie, in: S. Boysen u.a., Netzwerke, S. 266 (275 ff.). Speziell für das Verwaltungsrecht I. Augsberg (Hrsg.), Extrajuridisches Wissen im Verwaltungsrecht, 2013.
237
Vgl. auch C. Möllers, Der vermisste Leviathan, S. 113.
238
Speziell zum unsicheren Umgang der Jurisprudenz mit Fragen der Wirklichkeit A. Voßkuhle, Methode und Pragmatik, in: H. Bauer u.a., Umwelt, Wirtschaft und Recht, S. 171 (185).
239
Knapper Überblick zum Weimarer Methodenstreit bei A. Thiele, Der konstituierte Staat, S. 322 ff.
240
Siehe dazu A. Thiele, Die Europäische Zentralbank, S. 73 ff.
241
Es handelt sich insoweit vor allem um eine deutsche Debatte. Die Rechtswissenschaften in anderen Ländern (nicht zuletzt im angelsächsischen Raum einschließlich Südafrika) greifen zumeist ganz selbstverständlich auf wirklichkeitswissenschaftliche Erkenntnisse zurück.
III. Mangelt es der Allgemeinen Staatslehre an
der notwendigen Problemnähe?
Dem dritten Einwand lässt sich leichter begegnen. Danach fehlt es der Allgemeinen Staatslehre an Problemnähe. Prominent vorgetragen wurde dieser Vorwurf unter anderem von Peter Häberle. Die Allgemeine Staatslehre führe lediglich zu „leeren Abstrahierungen“.[242] Spezifische verfassungsrechtliche Fragen ließen sich mit dieser nicht beantworten, maßgeblich seien allein die konkreten Verfassungen. Dieser Vorwurf trifft gewiss zu. Welche Anforderungen das Demokratieprinzip im Einzelnen stellt, ob ein Gesetz mit Grundrechten vereinbar ist, eine Anti-Coronamaßnahme den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit achtet oder ob das aufwieglerische Verhalten eines US-Präsidenten ein Amtsenthebungsverfahren rechtfertigt, lässt sich unter Rückgriff auf die Ergebnisse einer Allgemeinen Staatslehre nicht abschließend klären.[243] Hier kann nur das Staatsrecht respektive das Verfassungsrecht weiterhelfen.[244] Dieser Vorwurf träfe die Allgemeine Staatslehre freilich |40|nur, wenn sie den Anspruch erhöbe, solche konkreten Fragen zu beantworten. Das ist aber nicht der Fall. Mit anderen Worten: Die Probleme, die die Allgemeine Staatslehre aus Sicht ihrer Kritiker wie Häberle nicht zu lösen vermag, will diese gar nicht lösen. Es geht ihr um etwas anderes; sie erhebt nicht den Anspruch an die Stelle des konkreten Staats- oder Verfassungsrechts im Sinne eines „universellen Ersatzes“ zu treten. Ziel ist vielmehr durch den kritischen, distanzierten und interdisziplinären Vergleich demokratischer Verfassungsstaaten neue Erkenntnisse und Perspektiven zu gewinnen, die es ermöglichen, losgelöst von konkreten Fragestellungen, sozusagen aus der Metaebene, Impulse für die Entwicklung des konkreten Staats- und Verfassungsrechts zu geben. Eine Allgemeine Staatslehre kann damit keine konkreten staats- und verfassungsrechtlichen Probleme lösen, aber argumentatives Rüstzeug für das Sichtbarmachen bedenklicher Entwicklungen und die Bewertung real gefundener Lösungen liefern. „Worum es geht, ist in erster Linie die Konstruktion von Typen; sodann, in zweiter Linie, ihre Verwendung als Skalen, mit deren Hilfe gerade auch die Abweichung, die Distanz erkennbar gemacht werden kann, so dass es weder ein Mangel noch eine Widerlegung ist, wenn eine individuelle historische Erscheinung nur sehr partielle Annäherungen an einen Typus aufweist.“[245] So wird in Deutschland nach der langen Regierungszeit Angela Merkels über eine verfassungsrechtliche Amtszeitbegrenzung des Regierungschefs diskutiert.[246] Eine Allgemeine Staatslehre kann nicht nur aufzeigen, wo entsprechende Begrenzungen bereits bestehen (selten in parlamentarischen, häufig in präsidentiellen Regierungssystemen), sondern auch, welche Vor- und Nachteile damit einhergehen und inwiefern sie mit parlamentarischen Regierungssystemen vereinbar sind. Sie öffnet den Erfahrungsschatz moderner Staatlichkeit für aktuelle Debatten, holt diese aus dem Bereich der Vermutungen und Mutmaßungen heraus und trägt zu deren Rationalisierung bei: „Das Spezifische dieser Disziplin besteht eben nicht in der Ausbildung abstrakt-begrifflicher (Staats-)Definitionen, sondern in der Distanz zu Einzelphänomenen, die vor allem über eine theoretisch angeleitete, typisierende und vergleichende Betrachtungsweise gewonnen wird.“[247] Wäre die Einführung direktdemokratischer Elemente sinnvoll? Wenn ja, warum, wenn nein, warum nicht?[248] Wann ist die Errichtung unabhängiger Verwaltungsbehörden empfehlenswert?[249] Wie lässt sich |41|Verwaltung generell organisieren? Wo liegen Vor- und Nachteile? Wie gehen andere Verfassungsgerichte mit dem Problem ihrer Politisierung um? Um die Beantwortung solcher Fragen geht es. Damit setzt eine Allgemeine Staatslehre keineswegs die Annahme einer „vorverfassten“ oder einer „vorverfassungsrechtlichen Staatlichkeit“ voraus. Dass es letztlich also „nur so viel Staat [gibt], wie die Verfassung konstituiert“,[250] ist eine Aussage, mit der eine moderne Allgemeine Staatslehre problemlos umgehen und die ihr daher nicht als prinzipieller Einwand entgegengehalten werden kann. Im Gegenteil: Weil der Staat eine formbare sozial-normative Konstruktion ist, kann ihr kritischer Blick etwas bewirken.
Fußnoten
242
P. Häberle, Die europäische Verfassungsstaatlichkeit, in: K. Weber/I. Rath-Kathrein (Hrsg.), Neue Wege der Allgemeinen Staatslehre, S. 29 ff.
243
Siehe auch P. Mastronardi, Verfassungslehre, Rn. 123.
244
Für eine synonyme Verwendung dieser Begriffe C. Möllers, Staat als Argument, S. 429.
245
S. Breuer, Der Staat, S. 12.
246
Dazu auch A. Thiele, Verlustdemokratie, S. 317 ff.
247
A. Voßkuhle, Die Renaissance der Allgemeinen Staatslehre im Zeitalter der Europäisierung und Internationalisierung, JuS 2004, 2 (3). Siehe auch M. Weber, Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre, S. 202: „Denn Zweck der idealtypischen Begriffsbildung ist es überall, nicht das Gattungsmäßige, sondern umgekehrt die Eigenart von Kulturerscheinungen scharf zum Bewusstsein zu bringen.“
248
Vgl. A. Thiele, Verlustdemokratie, S. 332 ff.
249
Dazu umfassend zuletzt etwa P. Tucker, Unelected Power, 2018.
250
So P. Häberle, Verfassungslehre als Kulturwissenschaft, S. 620.
[Zum Inhalt]
|43|C. Zehn Fragen an eine Allgemeine Staatslehre
im 21. Jahrhundert
„Diese Staatslehre, die der Verfasser als Ergebnis einer Bemühung von beinahe 35 Jahren vorlegt, will wahrhaft eine Lehre vom Staat sein.“
Herbert Krüger [251]
„Nach dem Standort und den Aufgaben der Staatslehre zu fragen, scheint bei dem Alter und der Tradition dieser Wissenschaft fast widersinnig zu sein.“
Roman Herzog [252]
„Der Staat ist ein in seiner Komplexität unerschöpfliches Thema.“
Martin Kriele [253]
Wenn eine Allgemeine Staatslehre nicht nur möglich, sondern zugleich sinnvoll erscheint, stellt sich die Frage nach dem Forschungsprogramm, ihren „Aufgaben“. Diese sind, wie Roman Herzog festhält, nicht statisch festgeschrieben, sondern wandeln sich mit den Herausforderungen der Staatenwelt.[254] Was sollte eine Allgemeine Staatslehre im 21. Jahrhundert umfassen, welchen Fragen an den Staat sollte sie sich widmen? Nach dem Gesagten kann es sich nur um einen subjektiven Vorschlag handeln, einen Debattenbeitrag, der zugleich mögliche Forschungsprojekte skizziert. Formuliert werden zehn Fragen, auf die eine „Allgemeine Staatslehre im 21. Jahrhundert“ Antworten liefern, zumindest Antwortvorschläge machen sollte. Die Fragen werden nicht abschließend beantwortet, sondern lediglich im Hinblick auf ihre Bedeutung für die Allgemeine Staatslehre umrissen. Die ersten vier Fragen behandeln die Grundlagen und beleuchten das Phänomen moderner Staatlichkeit an sich; sie fallen in ihrer vorläufigen Beantwortung kürzer aus. Ab der fünften Frage rücken die Charakteristika und die Struktur des |44|demokratischen Verfassungsstaates in das Zentrum der Betrachtungen – die Antworten werden länger.
Fußnoten
251
H. Krüger, Allgemeine Staatslehre, Vorwort S. V.
252
R. Herzog, Allgemeine Staatslehre, S. 15.
253
M. Kriele, Einführung in die Staatslehre, S. 1.
254
R. Herzog, Allgemeine Staatslehre, S. 15.
I. Was ist der „moderne Staat“ und wie ist sein
Verhältnis zur Gesellschaft?
1. Der moderne Staat als Gegenstand der Allgemeinen Staatslehre
Den zentralen Gegenstand der Allgemeinen Staatslehre bildet der moderne Staat. Damit ist allerdings noch nicht geklärt – es wurde angedeutet –, was den modernen Staat kennzeichnet, diesen aus historischer Perspektive von nicht-modernen Formen von Staatlichkeit früherer Hochkulturen unterscheidet. In dieser Frage besteht keine Einigkeit, weder im Hinblick auf die zeitliche und örtliche Einordnung der Entstehung des modernen Staates, noch auf die konkreten historischen Wesensmerkmale, die diesen charakterisieren.[255] Dieser Disput wird entschärft, wenn man sich das Prozesshafte der Entwicklung und die Abhängigkeit der Einordnung von der eigenen Staatstheorie in Erinnerung ruft. Der Staat entstand nicht in Form einer eruptiven Entladung aus den vormodernen Herrschaftssystemen und war plötzlich „da“. Die Suche nach einem konkreten Entstehungsdatum erscheint insofern wenig sinnvoll, angeben lässt sich allenfalls eine zeitliche Periode, in der sich der moderne Staat allmählich herausbildete. Es geht um einen schleichenden und Jahrhunderte dauernden Prozess, der zudem in unterschiedlichen Regionen in unterschiedlicher Intensität und mit unterschiedlichen Schwerpunkten ablief – noch im heutigen Staatensystem spielen diese Pfadabhängigkeiten eine Rolle und werden auch bei konkreten Problemlösungsstrategien immer wieder sichtbar. Die einzelnen historischen Wesensmerkmale, die man bei der Betrachtung dieser Periode als maßgeblich erachtet, sind zudem von den eigenen Vorstellungen über das „Wesen“ des Staates, von der eigenen „Staatslegende“ abhängig. Daraus folgt erstens, dass es ebenso erwartbar, wie unschädlich ist, dass sich die gefundenen Merkmale in den Details unterscheiden. Wichtig ist, die eigenen Ergebnisse nicht absolut zu setzen, sondern nur als ein mögliches Verständnis, ein denkbares Szenario in den Staatsdiskurs einzustellen. Zweitens ergibt sich daraus, dass die begriffliche Debatte zu keinem Zeitpunkt als abgeschlossen angesehen werden kann. Der Begriff des modernen Staates ist in seiner historischen Fundierung (schon aufgrund neuer Erkenntnisse der Geschichtswissenschaft, der politischen Anthropologie etc.) ebenso wandelbar, wie sich die heutige Staatenwelt permanent wandelt. Die historischen Wesensmerkmale des modernen Staates |45|sollten daher in all ihrer Offenheit auch in Zukunft zentraler Forschungsgegenstand der Allgemeinen Staatslehre bleiben.
Vor diesem Hintergrund sollte die Entstehungszeit des modernen Staates – im Einklang mit der überwiegenden Ansicht in der Literatur[256] – in die europäische Neuzeit verlegt werden.[257] Um möglichen Missverständnissen sogleich zu begegnen: Damit soll weder behauptet werden, dass es keinerlei außereuropäische Staatsentwicklungen gegeben hätte oder dass die Herrschaftsstrukturen dort „unmodern“, „unpolitisch“ oder gar „unzivilisiert“ gewesen seien, wie dies zur Zeit der Kolonialisierung dieser Gebiete ab dem 16. und bis ins 20. Jahrhundert oftmals geschehen ist.[258] Das Gegenteil ist richtig und die Integration der neueren Erkenntnisse über die vielfältigen historischen und keineswegs unpolitischen frühen (segmentären und tribalistischen) Gemeinschaften in Amerika, Afrika, Asien, Australien und Neuseeland in den modernen Staatsbegriff sollte stärker betrieben werden als bisher. Gleichwohl zeigt sich im Europa der Neuzeit eine Entwicklung, die zumindest für die Herausbildung des heutigen Staatensystems – es besteht mittlerweile praktisch ausschließlich aus Nationalstaaten europäischer Art, wie sie sich zum Ende des 18. und zu Beginn des 19. Jahrhunderts herausgebildet haben – prägend war und die sich in dieser Form auf den anderen Kontinenten in dieser Dichte nicht ereignet hat. Die Entdeckung der Vernunft, die gesellschaftlichen und technischen Neuerungen[259] leiteten signifikante Veränderungen der bestehenden Herrschaftsstrukturen ein. Diese verdichteten sich in der Folge, um sich sodann durch Kolonialisierung und „Selbstverwestlichung“[260] auf dem gesamten Erdball zu verbreiten[261] und im Anschluss an die im 20. Jahrhundert (formal) abgeschlossene Dekolonialisierung zum weltweiten „Staatsstandard“ zu mutieren. Erneut sei aber betont: Auch diese Ausbreitungsgeschichte ist in all ihren Facetten noch nicht |46|erzählt[262] und darf nicht die signifikanten Unterschiede negieren, die in den einzelnen Weltregionen schon aufgrund der vielfältigen Kolonisierungsformen und unterschiedlichen lokalen Herrschaftstypen bis heute bestehen. Hier bleibt – nicht nur, aber vor allem – auf dem afrikanischen Kontinent mit seinen komplexen vorkolonialen tribalistischen Herrschaftsformen außerordentlich viel zu tun.[263] Dass diese Zeit Auswirkungen auch auf die heutige Situation hat, zeigt die Auseinandersetzung der deutschen Bundesregierung mit den Herero und Nama im heutigen Namibia (ehemals Deutsch-Südwestafrika) über eine Entschädigung, aber auch über eine angemessene Erinnerungskultur[264] für die grausamen Gewalttaten bis hin zum Völkermord, die ihnen zu Beginn des 20. Jahrhunderts von deutschen Kolonialherren angetan wurden.[265] Generell ist im 21. Jahrhundert in vielen ehemaligen Kolonialstaaten eine neue Verantwortungsdebatte entstanden, die sich nicht allein auf die Frage der Rückgabe (in der Regel geraubter)[266] kolonialer Kunstschätze reduzieren lässt, sondern auch allgemeine Fragen der Staatlichkeit umfasst.[267]
Unter Beachtung dieser Einschränkungen sind es aus meiner Sicht die folgenden acht Merkmale, die das Wesen des modernen Staates europäischer Prägung ausmachen:[268]
Zentralisierung der Macht- und Herrschaftsverhältnisse. War die Macht im Feudalismus des Spätmittelalters noch in einem diffusen System auf zahlreiche Personen und die Kirche aufgeteilt,[269] kam es mit dem moralischen Verfall der Kirche und den folgenden Religionskriegen ab dem 14. Jahrhundert zu einer Machtkonzentration beim Monarchen, bei dem sich nicht zuletzt die Streitentscheidungskompetenzen bündelten. Die Stände wurden entmachtet und es folgte die Ära des |47|Absolutismus:[270] „L’État c’est moi!“[271] Theoretisch unterfüttert wurden diese Entwicklungen durch Jean Bodin, der den vielleicht umstrittensten Begriff in die Allgemeine Staatslehre einführte: „Souveränität“. Ein umfassendes, auch faktisches Gewaltmonopol ging mit der Zentralisierung allerdings zu keiner Zeit einher – die lokalen Herrschaftsträger blieben im täglichen Leben auch in der Hochzeit des Absolutismus schon aus organisatorisch-technischen Gründen von großer Bedeutung. Die „Souveränität“ der ersten modernen Staaten nachträglich zu verklären, erscheint daher wenig überzeugend.[272]
Säkularisierung bei Konfessionalisierung. Die Entdeckung der Vernunft führte zu einer Trennung der geistlichen von der weltlichen Sphäre, wobei sich der weltliche Monarch langfristig den Primat, den „Suprematieanspruch“,[273] sicherte. Er hatte auf seinem Territorium das letzte Wort und zwar auch im Hinblick auf Fragen der Religion. Religion spielte damit in der Anfangszeit noch eine große, vielleicht sogar die bedeutendste Rolle für den modernen Staat. Es kam also zu einer Säkularisierung,[274] aber nicht zu einer Entkonfessionalisierung des Staates. Bis zum „Staat ohne Gott“, wie ihn Horst Dreier zuletzt beschrieben hat und in dem die Religion prinzipiell zur Privatsache erklärt wird,[275] sollte es noch einige Jahrhunderte dauern – vollständig durchgesetzt hat sich dieses Konzept bis heute nur in wenigen modernen Staaten.
Territoriale Abgrenzung und Entpersonalisierung. Im Zusammenhang mit der Konfessionalisierung stand die Territorialisierung der Herrschaft, die sich fortan vornehmlich über ihr Staatsgebiet und weniger über die konkrete Person des Herrschers definierte. Es kam zu einer Entpersonalisierung, der Staat wurde zur Körperschaft, deren nicht zuletzt territoriale Existenz vom Herrscher unabhängig war – nach dem Tode Karls des Großen war dessen Reich noch wie selbstverständlich unter den Nachkommen aufgeteilt worden. Die seitdem entstehenden „festen“ Grenzen waren aber vornehmlich räumliche Abgrenzungen der Herrschaftsgewalt und keine für Menschen physisch unüberwindbaren Barrieren. Anfangs waren es |48|angesichts der vorherrschenden ökonomischen Theorie – dem Merkantilismus – auch weniger fremde Menschen, die auf dem eigenen Staatsgebiet unerwünscht waren als aus dem Ausland stammende Waren. Aktuell scheint es im „entfesselten und globalisierten Kapitalismus“ umgekehrt zu sein.[276] Grenzenlos ist die Welt heute allenfalls für einen kleinen Kreis privilegierter Personen, während der Großteil praktisch überall außen vor bleibt. Die Grenze ist als „Sortiermaschine“[277] im 21. Jahrhundert insofern präsenter denn je: „Den Prozess der Globalisierung in seinem Kern als Entgrenzung zu verstehen, ist daher vereinseitigend, aus meiner Sicht sogar irreführend.“[278] Der moderne Staat hat seine Territorialität in Zeiten der Globalisierung nicht verloren, die unzähligen Menschen, die vor Grenzen „gesammelt, rückgestaut oder aufgehalten“[279] werden, legen davon Zeugnis ab.
Gestaltung durch Gesetzgebung. War die Ordnung des Mittelalters noch vornehmlich eine erkennende, wurde sie mit der Entdeckung der Vernunft zunehmend zu einer vom Menschen selbst vor allem durch Recht gestalteten Ordnung:[280] Der moderne Staat ist Gesetzgebungsstaat. Damit übernahm der Herrscher zugleich die Verantwortung für die Ausgestaltung dieser Ordnung: Er konnte gestalten, aber nunmehr musste er auch gestalten. Es fanden sich umfangreiche Regelungen zur „guten Policey“ mit denen der Herrscher versuchte, sowohl die Gefahrenabwehr als auch die allgemeine Wohlfahrtspflege zu organisieren und nach seinen Vorstellungen zu gestalten. Die neuen Ordnungen ließen kaum einen Bereich aus und reichten von der Kleiderordnung bis hin zum schicklichen Verhalten in der Öffentlichkeit. Allerdings verlief dieser Prozess in den einzelnen Staaten unterschiedlich. In Großbritannien und den USA wird man der Gesetzgebung erst Ende des 19. Jahrhunderts eine größere Rolle zusprechen können.[281]
Ausbildung einer zentralen Bürokratie. Die Gestaltung durch Gesetze aber auch die Konfessionalisierung bedurfte der konkreten Umsetzung innerhalb des gesamten Territoriums der einzelnen Staaten. Nach dem Vorbild der katholischen Kirche entwickelte sich eine zentralisierte Verwaltung, die im Übrigen auch von technischen Neuerungen (wie der Postkutsche) profitierte. Verwaltung ist auch heute der Aspekt von Staatlichkeit, dem |49|die BürgerInnen am häufigsten begegnen: „Der Alltag von Herrschaft ist Verwaltung.“[282] Die effiziente Ausgestaltung der Verwaltungsstrukturen und ihre allgemeine Funktionsfähigkeit sind daher bis heute wesentliche Bausteine für die Anerkennung der Herrschaftsordnung durch die Herrschaftsunterworfenen, also die Legitimität derselben.
Errichtung eines stehenden Heeres. Mit der Veränderung der Kriegsführungstechniken ging eine professionellere Organisation der militärischen Verteidigung einher. Ausgehend von den Niederlanden und Schweden wurde der besoldete und unter Waffen stehende Soldat, der auch in Friedenszeiten seine Stellung behält, zum neuen militärischen Standard. Dazu bedurfte es eines umfassenden militärischen Verwaltungsapparates und entsprechender Infrastruktur (vor allem über das gesamte Territorium verteilte Kasernen). Das Militär wurde zu einem wirksamen Macht- und Symbolfaktor des zentral agierenden Herrschers (Frankreich, Preußen). In vielen Staaten kommt dem Militär bis heute eine erhebliche Integrationskraft selbst in Friedenszeiten zu (USA, Frankreich). In Deutschland ist das aus historischen Gründen anders.
Umfassende Steuerfinanzierung. Im Mittelalter kam der Herrscher im Wesentlichen selbst für die Kosten der Herrschaft auf. Die Finanzierung des modernen, gestaltenden und verwaltenden Staates war auf diesem Wege nicht mehr zu leisten. Im Laufe der Zeit trat daher die Steuer als dauerhafte Einnahmequelle an die Stelle der Selbstfinanzierung: Der moderne Staat ist Steuerstaat.[283] Diese Entwicklung war für den Prozess der Parlamentarisierung und damit den demokratischen Verfassungsstaat bedeutend. Die Ständevertretungen, die für die Bewilligung der Steuern verantwortlich zeichneten, waren die Vorläufer der heutigen Parlamente. Das Budgetbewilligungsrecht bildet weiterhin eine der parlamentarischen Kernkompetenzen.
Staatsvolk? Ein formales Staatsvolk, eine formale Staatsangehörigkeit kannte der moderne Staat lange Zeit nicht. Die Herrschaft war im Wesentlichen nicht personal, sondern territorial organisiert – zumindest wenn man auf die zentrale staatliche Ebene blickt.[284] Auch die Konfession ließ sich nicht als Staatsangehörigkeitsersatz interpretieren, schon weil es nur zwei (später drei) unterschiedliche Konfessionen gab[285] und diese zudem prinzipiell frei wählbar waren. Erst die Demokratiebewegung begründete das Bedürfnis ein irgendwie geartetes Volk von anderen Völkern abzugrenzen.[286] Die Idee, die in diesem Zusammenhang geboren beziehungsweise |50|„erfunden“[287] wurde, war die der Nation – ein mehr als folgenreiches Konzept für den modernen Staat.[288]
2. Der Nationalstaat als zentrale moderne (gescheiterte) Kategorie
Die modernen Staaten sind heute praktisch ausschließlich als Nationalstaaten konstruiert,[289] kennen neben einer nationalen Staatsangehörigkeit eine Nationalhymne, eine Nationalflagge sowie weitere nationale Symbole und sind – bis auf wenige Ausnahmen – in den Vereinten Nationen international organisiert.[290] Daraus wird bereits ersichtlich, dass sich dem Umstand Nationalstaat zu sein noch nichts über die innere Organisation des jeweiligen Staates entnehmen lässt. Handelt es sich um ein demokratisches oder ein autoritäres Regime, um eine Monarchie oder eine Republik? Entgegen den Vorstellungen der ersten Nationalisten hat sich das Konzept des Nationalstaats als überaus flexibel erwiesen und verträgt sich prinzipiell mit praktisch jeder innerstaatlichen Ordnung.[291] Auch ist es – noch nicht einmal in Europa – weder gelungen die einzelnen Nationen überschneidungsfrei voneinander abzugrenzen geschweige denn jeder dieser Nationen als Ausgangspunkt einer friedlichen nationalstaatlichen Weltordnung ihren eigenen Staat zuzuweisen. In jedem Nationalstaat finden sich bis heute ethnische, religiöse oder sonstige Minderheiten, mit denen die Nationalstaaten umgehen müssen, was mal besser und mal schlechter gelingt; teilweise wird durch extreme Assimilierungspolitiken versucht, die Unterschiedlichkeiten zugunsten einer erwünschten Homogenität des Staatsvolkes (gewaltsam) zu unterdrücken, in anderen Fällen werden die Minderheiten schlicht aus der Öffentlichkeit verbannt und in Arbeitslager gesteckt (so etwa die Uiguren in der Volksrepublik China). Etliche Nationen fühlen sich bis heute um ihren eigenen Nationalstaat betrogen (Kurden, Katalanen, Schotten). Faktisch bleibt der Vielvölkerstaat insofern die staatliche Normalität. Mit anderen Worten: Das Konzept des Nationalstaats wird man als im Kern gescheitert ansehen müssen. Die Idee der Nation hat zwar beachtliche Leistungen im Hinblick auf die Entwicklung des demokratischen Verfassungsstaates geleistet. Eine zentrale Aufgabe der Allgemeinen Staatslehre sollte es nun jedoch sein, Möglichkeiten aufzuzeigen, den Nationalstaat (nicht aber Staatlichkeit an sich) zu überwinden und Staatsmodelle zu entwickeln, die besser geeignet sind, die |51|heutigen komplexen staatlichen Integrationsaufgaben zu meistern und die die Schwierigkeiten, die mit dem Nationsbegriff verknüpft sind, vermeiden.[292]