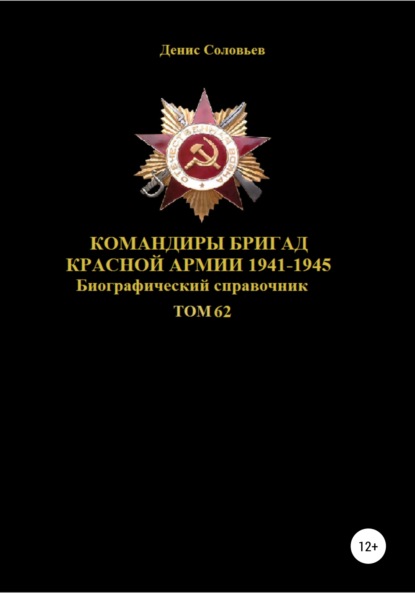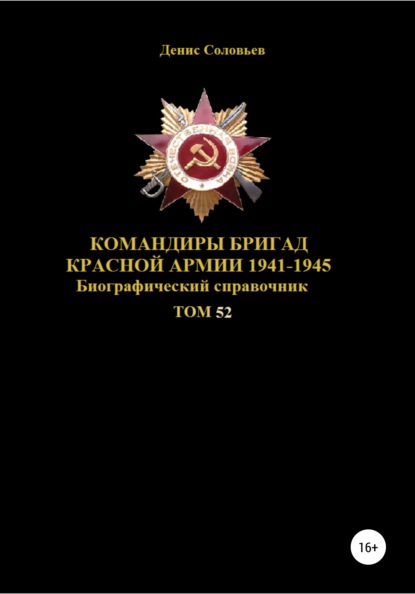Fußball-Coaching - Die 100 Prinzipien

- -
- 100%
- +
Der Schritt vom Fan zum Fanatiker ist oftmals nicht weit und kann in spezieller Ausprägung zum Hooligan oder der Ultrabewegung führen. Hier stößt die Fanbewegung eindeutig an die Grenzen der Akzeptanz durch die Vereine und die Gesellschaft, und besonders auffällige Fans werden mit Stadionverboten belegt.
VERWEISE:



»Hooligans« sind Personen, die im Rahmen von Fußballspielen durch aggressives Verhalten auffallen. Oftmals sind sie fanatische Anhänger eines Vereins, zeigen dies mit ihrer Kleidung nicht wie die normalen Fans. Für Hooligans steht die gewalttätige Auseinandersetzung mit anderen Gruppen im Vordergrund. Das Fußballspiel bietet dazu den Anlass. Hooligans sind in größeren Gruppen ähnlich wie Fans organisiert und zeigen eine hohe Gewaltbereitschaft. Hooligans unterscheiden sich deutlich von normalen Fans und Ultras.
Das aus England stammende Phänomen beschreibt das Zelebrieren von Gewaltritualen und aggressiven Handlungen gegen verfeindete Gruppen. Hooligans sind organisiert und handeln nach eigener Aussage nach einem Ehrenkodex. In der Realität stellt sich dies mitunter anders dar. Hooligans stammen aus der Mitte der Gesellschaft. Von den Arbeitern bis zu den Akademikern ist alles vertreten. Durch die erhöhte Polizeipräsenz und das konsequente Vorgehen gegen Hooligans hat sich das Problem leicht aus den Stadien nach außen verlagert. Die Stadien werden mit Videokameras überwacht, und zivile Beamte observieren die Szene. Die große Anzahl der Stadienverbote trifft mitunter die Falschen, was in der Szene stark kritisiert wird. Trotzdem gelingt es den Hooligans immer wieder, sich vor allem anlässlich großer Turniere Massenschlägereien zu liefern, bei denen mehrere Hundertschaften Polizei in den Einsatz ziehen müssen.
Die Ursachen für Hooligans und deren Tun sind weitgehend unerforscht, und es liegen unterschiedliche Analysen vor. Vor allem in Deutschland scheint es sich um eine Gruppe gut ausgebildeter und sozial abgesicherter junger Männer zu handeln, die ihrem bürgerlichen Alltag entfliehen wollen und die Gewalt als eine Art Droge empfinden.
Die Soziologie erforscht diese Aspekte des sozialen Zusammenlebens der Menschen in Gemeinschaften und Gesellschaften. Sie fragt nach dem Sinn und den Strukturen des sozialen Handelns (Handlungstheorie) sowie nach regulierenden Werten und Normen. Ihre Untersuchungsobjekte sind die Gesellschaft als Ganzes ebenso wie ihre Teilbereiche: soziale Systeme, Institutionen, Organisationen und Gruppen. Als Teilbereich ist der der Hooligans zu verstehen, und es gibt dazu noch keine eindeutigen wissenschaftlichen Erkenntnisse.
VERWEISE:




Die »Ultrabewegung« bezeichnet eine besondere Organisationsform von fanatischen Fußballanhängern. Die aus Italien stammende Bewegung von Fans, die ihre Mannschaften bestmöglich unterstützen möchte, ist in den Stadien besonders auffällig durch ihre mit Megafonen unterstützten Sprechgesänge und häufig ausgefallenen Choreografien. Sie handeln autonom und stehen der Kommerzialisierung und ihren Vereinen häufig kritisch gegenüber. Je nach Gruppengröße und Organisation üben sie Druck auf die Vereinsführung aus. So solidarisieren sich zum Beispiel alle Ultragruppen bei Fragen von Stadionverboten und anderen als Repressalien empfundenen Verboten mit den mutmaßlichen Tätern.
Die Abgrenzung zu Hooligans gelingt in der Praxis nicht eindeutig und nur auf theoretischer Ebene. Viele Ultras halten die gewalttätige Auseinandersetzung mit der Obrigkeit für legitim und sehen in der Polizei den direkten Kontrahenten. Bei den Ultras ist im Unterschied zu Hooligans eindeutig die Treue zum eigenen Verein und dem Fußballsport stärker ausgeprägt und Quelle des Handelns. Durch ihr optisch und akustisch starkes Auftreten im Stadion geraten Ultras manchmal in Konflikte mit Fangruppen des eigenen Vereins, was bei Ausschreitungen eine nachträgliche Differenzierung in Ultras, Fans oder Hooligans für die Gesetzeshüter schwer macht.
Für die Vereine sind die Ultras durch ihre Gruppengröße und ihren hohen Organisationsgrad durchaus ernst zu nehmende Partner, weil sie vor allem im Stadion für Atmosphäre sorgen, bei Versammlungen meinungsbildend sein können. In den drei deutschen Profiligen gibt es in fast jedem Verein Ultragruppen, die meist kontinuierlichen Zulauf haben. Kriterium für die Aufnahme vor allem junger Fans ist die unbedingte lokale Loyalität für den Verein.
Die Polizei differenziert die verschiedenen Fangruppen nicht nach ihrer Zugehörigkeit zu Fans, Hooligans oder Ultras, sondern nach ihrer Gewaltbereitschaft in »A-, B- oder C-Fans«, wobei »C-Fans« Hooligans sind. Die Ultrabewegung ist zwar im Fußball am stärksten vertreten und stark lokal geprägt, findet sich mittlerweile auch in anderen Sportarten.

Ultras machen mit ihren Choreographien die Ränge zur Bühne um den Platz.
VERWEISE:



Das Internationale Olympische Komitee definiert »Doping« als »die beabsichtigte oder unbeabsichtigte Verwendung von Substanzen aus verbotenen Wirkstoffgruppen und die Anwendung verbotener Methoden entsprechend der aktuellen Dopingliste«. Der Fußball wird im Bereich des professionellen Sports durch Dopingtests überprüft. Ausschlaggebend ist der nicht erlaubte Gebrauch von Substanzen, die auf der Dopingliste der WADA (World Anti Doping Agency) stehen.
Dopingmittel können zur Leistungssteigerung in jeglicher Form führen, abhängig von der Sportart und dem Leistungskriterium. Im Jahre 2009 wurden 32 000 Dopingproben bei Profifußballern genommen, von denen 0,3 Prozent positiv waren. Die Dunkelziffer liegt wahrscheinlich höher. Immer wieder werden die Stimmen von Akteuren wie Trainern oder Spielern laut, die von früheren Zeiten berichten, was früher an Dopingmitteln genommen wurde. Die Grenze zwischen Nahrungsergänzungsmitteln, Vitaminpräparaten oder Doping war wesentlich unklarer. Heute werden den Spielern eine Vielzahl von Präparaten verabreicht, die alle nicht auf der Dopingliste stehen oder mit medizinisch begründeten Ausnahmegenehmigungen verabreicht werden dürfen.
Doping ist vor allem im Breitensport ein Problem, da hier keine Tests durchgeführt werden. Fußball ist weniger betroffen als die rein ausdauerorientierten Sportarten wie Radfahren, Schwimmen und Skilanglauf. Vom Doping ist neben der ethischen Komponente des Fair Plays die Gesundheit betroffen, da die Langzeitwirkungen von Dopingpräparaten nicht erforscht sind und jeder Sportler ein hohes individuelles Risiko eingeht.
VERWEISE:





Eine »Krise« ist eine problematische, häufig mit einem Wendepunkt verknüpfte Entscheidungssituation mit einer massiven Störung des Systems. Im Fußball finden sportliche Krisen regelmäßig statt, und die meisten enden mit der Trainerentlassung. Die Steigerungsform einer Krise wäre die Katastrophe, was sich für einen Fußballverein häufig mit der Situation des Abstiegs oder der Insolvenz einstellt. Aktueller Anlass für eine Krise sind ausbleibende sportliche Erfolge und die verbundene, sich verschlechternde Tabellenplatzsituation.
Eine Krise ist häufig zeitlich begrenzt, geht im Fußball sehr zulasten des Trainers. In Krisensituationen fehlt es häufig an den entsprechenden Analysefähigkeiten der dahinterliegenden psychologischen Situation, die komplex sein kann. Trainerentlassungen bringen meist nicht den gewünschten Erfolg, sondern zeigen nur kurzfristige Wirkung.
Selten sind die ausschlaggebenden Gründe rein fußballspezifischer Natur. Es stecken psychologische Faktoren dahinter, die es verhindern, dass eine entsprechende Leistung abgeliefert werden kann. Oft liegen die Probleme im Bereich der Bedürfnisse der Spieler, die nicht ausreichend befriedigt werden.
Die charakteristischen Kennzeichen einer Krise sind die dringende Notwendigkeit von Entscheidungen, das Gefühl der Bedrohung. Dies geht meist einher mit einem Anstieg an Unsicherheit und dem Zeitdruck. Die Zukunft wird als bedrohlich empfunden. Wenn noch emotionale Komponenten wie Wut oder Verzweiflung aufkommen, ist die Trainerentlassung meist nicht mehr fern.
Im Fußball spielen hier die verschiedenen Parteien wie Spieler, Vereinsverantwortliche, Fans oder die Presse eine wichtige Rolle und können die Krisensituation verschärfen, sodass es zu unüberlegten Handlungen kommt. Kritische Situationen sind selten vorhersehbar.
VERWEISE:





Wenn große Menschengruppen außerhalb eines Stadions zusammenkommen, um dem Fußballspiel auf Großbildleinwänden beizuwohnen, spricht man seit der WM 2006 im deutschsprachigen Gebrauch von »Public Viewing«. Hintergrund dieser deutschen Erfindung war die zu geringe Anzahl von Eintrittskarten für die Fußballweltmeisterschaft in Deutschland, die im freien Verkauf für Fans zugänglich gewesen ist. Das Organisationskomitee der WM intervenierte daraufhin bei der FIFA und bei dem Sportrechtevermarkter Infront. Nach langen Verhandlungen wurde der Weg freigemacht, die Liveübertragungen der WM-Spiele kostenlos auf Großbildleinwänden außerhalb der Stadien zu zeigen, was von deutschen Städten und Gemeinden zahlreich genutzt wurde.
Einzige Einschränkung für die (lizenz-)kostenfreie Übertragung war, dass diese nicht durch Sponsoren finanziert wurde und somit nicht kommerziell war. Weitere Bedingung für die kostenfreie Nutzung der Lizenzrechte war die entgeltfreie Nutzung der Übertragung. Sofern Eintritt erhoben wurde, mussten Lizenzgebühren entrichtet werden. Es durften nur ausschließlich lokale oder regionale Sponsoren aktiv werden, die nicht in Konkurrenz zu FIFA-Sponsoren standen. Die einzige Ausnahme blieb das Ausschenken von deutschem Bier, obwohl eine internationale Brauerei FIFA-Sponsor war.
Beim Public Viewing handelt es sich um eine identitätsstiftende Maßnahme, die eine neue Form der Anteilnahme an Großereignissen möglich macht. Bisher war das gemeinsame Erleben von simultan entstehenden Emotionen wie Freude nur Stadionbesuchern vorbehalten. Technisch war das Public Viewing durch die Entwicklung von Großbildleinwänden und Plasmafernsehern möglich geworden. Die Resonanz und Akzeptanz dieser neuen Art von Fankultur überraschte alle Verantwortlichen. Hierbei handelt es sich nicht um Fans im engeren Sinne, vielmehr um eine Art von Fankultur für viele Menschen, die ereignisbezogen und emotional reagieren.

Geteilte Freude ist doppelte Freude: die WM 2006 als Beginn einer neuen Fanbegeisterung.
Public Viewing ist beim Deutschen Patentund Markenamt als Wort-/Bildmarke eines Unternehmens für die Vermietung von Großbildleinwänden geschützt. Als Wortmarke ist der Begriff weiterhin für jeden nutzbar und seit 2007 im Duden gelistet.
VERWEISE:



Von »Talent« oder »Begabung« einer Person spricht man dann, wenn einzelne oder mehrere besondere Leistungsvoraussetzungen vorhanden sind. Talent hat oder besitzt jeder Mensch für irgendeine Tätigkeit.
Im Bereich des Fußballs sind sportliche Talente, Talentsuche, Talentauswahl und deren Förderung in besonderem Maße wichtig. Hier herrschen große Defizite in allen Bereichen. Beleg dafür ist, dass in allen Fußball-Junioren-Nationalmannschaften überdurchschnittlich viele Spieler mit Geburtsdatum in den ersten Monaten des jeweiligen Kalenderjahres sind. Durch die Einteilung in Jahrgänge werden schlicht die körperlich akzelerierten Nachwuchsspieler gefördert. Einige Monate früher geboren zu sein, kann körperlich Einiges ausmachen, obwohl Talent sich sicher über das ganze Geburtsjahr verteilt und nicht nur zu Beginn des Jahres vergeben wird.

Wer einmal ein »Großer« werden will, muss stetig bemüht sein und am Ball bleiben.
Zum sportlichen Talent gehören viele weitere Faktoren, die es zu beachten gilt. Neben der sportlichen Leistungsfähigkeit, die am besten im Wettkampf mit Gleichaltrigen zu beweisen ist, sollten Leistungsbereitschaft und Leistungsfähigkeit vorhanden sein. Da sich Talente entwickeln müssen, gilt es, sie kompetent über einen langen Zeitraum zu fördern. Neben der sportlichen Laufbahn muss die persönliche und schulische Karriere beachtet werden, da ein Fußballer nicht im luftleeren Raum lebt, sondern in einer komplexen Gesellschaft, die vieles abverlangt. Die gesundheitliche Betreuung hat einen besonders hohen Stellenwert, da bei hoch talentierten Fußballern die körperliche Belastung schnell ansteigt.
Die Fußballverbände und der DFB haben einige Talentförderprogramme auf den Weg gebracht. In den Nachwuchsleistungszentren der Fußballbundesligisten wird wesentlich professioneller gearbeitet als vor einigen Jahren, und die Durchlässigkeit bis hin zu den Profikadern und der Nationalmannschaft ist deutlich verbessert worden.
VERWEISE:


»Kommunikation« in seiner ursprünglichen Bedeutung bezieht sich auf Sozialhandlungen zwischen Menschen. Kommunikation als Sozialhandlung ist bezogen auf eine Situation, in der gemeinsam Hindernisse bewältigt werden. Es werden Informationen ausgetauscht oder übertragen. Im Fußball ist ein hohes Maß an Kommunikation nötig. Vielfältige Informationen müssen an die Beteiligten übertragen oder unter ihnen ausgetauscht werden.
Kommunikation gehört zu den komplexesten und wichtigsten Fähigkeiten des Menschen und besteht nicht nur aus sachbezogenen Informationen. Ein großer Teil des Austausches in einem Gespräch läuft über Gesten, Körperhaltungen, Mimiken, Betonungen oder Sprachmelodien ab.
Kommunikation wird als alltäglich und scheinbar selbstverständlich betrachtet. In kaum einem Kommunikationsvorgang werden alle Informationen der Beteiligten so aufgenommen, wie sie gesendet wurden. Solange beide Parteien zufrieden sind, ist das kein Problem. Problematisch wird Kommunikation im Falle von Missverständnissen, Unzufriedenheiten oder Misserfolgen. Ob es sich um Fehler in der Kommunikation handelt oder um andere zwischenmenschliche Probleme, bleibt oft zunächst offen. Vor allem bei sportlichen Misserfolgen leidet die Kommunikation, und es werden Informationen absichtlich vorenthalten oder falsch übermittelt.
Für das praktische Fußballspiel ist Kommunikation untereinander für das taktische Verhalten wichtig. Vieles läuft nonverbal über Beobachtung ab, kann verbal begleitet werden. Im Training kann Kommunikation im Spiel gezielt trainiert werden. Kommunikation spielt eine wichtige Rolle bei der Ansprache des Trainers an sein Team und zur Motivation der Spieler. Die Bedeutung der Kommunikation wird dem Trainer und den Mitspielern besonders deutlich, wenn es um die Integration neuer Spieler oder Spieler ohne deutsche Sprachkenntnisse geht.

Spieler, die sich mitteilen, sind immer gut für ein Team.
VERWEISE:





Wenn Interessen, Ziele oder Wertvorstellungen von Personen oder Gruppen jeglicher Größe nicht miteinander zu vereinbaren sind, spricht man von einem »Konflikt«. Im Fußball können Konflikte auftreten. Sie entstehen zwischen Personen und Gruppen innerhalb einer Mannschaft oder eines Vereins. Zielführend zur Konfliktlösung ist die Analyse, wer die Konfliktpartner und was die Konfliktursache sind.
Die Konfliktursachen können ihren Ursprung in individuellen Wahrnehmungen haben, dabei in Abhängigkeit von der Leistung anderer. Ein Stürmer, der nicht angespielt wird, wird ein Problem damit haben, ebenso ein Team, dessen Stürmer alles allein macht. Unfaire Behandlungen sind Nährböden für Konflikte innerhalb der Mannschaften. Der Eingriff in den persönlichen Bereich eines Spielers, zum Beispiel das Verhältnis seiner Frau zu einem weiteren Spieler, wird fast zwangsläufig zum Konflikt führen. Konflikte sind selten eindeutig zu diagnostizieren. Meist kommen mehrere Ursachen zusammen, und der Konflikt hat sich über einen längeren Zeitraum angebahnt. Deshalb ist die Analyse der möglichen Ursachen oft zielführend.
Die Konfliktlösung, die häufig nur von außen initiiert werden kann, versucht, die Auswirkungen des Konflikts und das schädigende Verhalten innerhalb des Konflikts zu minimieren. Eine Konfliktlösung wird entweder durch Macht ausgeübt – in diesem Fall entscheidet der Trainer – oder durch den Ausgleich der Interessen der Konfliktpartner. Ein guter Indikator für die erfolgreiche Konfliktlösung ist der Umstand, dass beide Partner nach ihrem Konflikt miteinander konstruktiv Kontakt haben.
Die einfachste Form der Konfliktlösung wäre das Gespräch, wobei ein Mediator dies übernehmen müsste. Konflikte innerhalb eines Teams gilt es schnell zu lösen, weil sie leistungshemmend sind. Konflikte gehören folglich zum Prozess des Teambuildings. Ein Trainer sollte einem Konflikt nicht aus dem Weg gehen, da dies seine Position insofern schwächen würde, weil die Mannschaft eine Konfliktlösung durch ihn erwartet.
VERWEISE:



»Emotionen« treten bei Menschen und hier im Fußball häufig auf. Eine Emotion hat einen psychophysiologischen Prozess als Hintergrund und wird durch Wahrnehmung oder Interpretation einer Sache ausgelöst. Es kann zu physiologischen Veränderungen, veränderten Gedanken oder Gefühlserlebnissen kommen, die das Verhalten stark beeinflussen.
Es handelt sich um einen komplexen Prozess auf verschiedenen Ebenen der Verarbeitung. Im Vergleich zu Stimmungen sind Emotionen relativ kurz und intensiv. Während Stimmungen und deren Auslöser oft unbemerkt bleiben, stehen bei Emotionen das auslösende Objekt und die psychologischen, seelischen und physiologischen Komponenten üblicherweise im Fokus.
Davon zu unterscheiden ist das Gefühl, dass nur das subjektive Erleben die Emotion bezeichnet, wie zum Beispiel Freude nach einem Torerfolg oder Traurigkeit nach einer Niederlage. Gefühle unterscheiden sich zunächst von Wahrnehmungen, Eindrücken und vom Denken, vom Wollen abgesehen. Gefühle können sich mit allen anderen Erfahrungen verbinden.
Betreffen Emotionen Handlungsintentionen oder lösen sie Handlungen aus, die sich verselbstständigen und nicht mehr kontrollierbar sind, spricht man von einer Handlung im Affekt. Während bei einem Gefühl der bewusste Aspekt fehlen kann, ist bei Emotionen ein Bezug zum Auslöser vorhanden. Wer zum Beispiel während eines Spiels plötzlich Schmerzen verspürt, muss nicht zwingend verstehen, woher der Schmerz kommt. Spüren kann er ihn trotzdem. Wer nach einem Foul im Affekt aufspringt und sich vor dem Gegner aufbaut, weiß wohl, was vorher passiert ist. Der Schmerz ist nicht verantwortlich für das Aufspringen, sondern die Emotion.
Stimmungen haben demgegenüber einen zeitlich länger andauernden Charakter. Stimmungen können die Wahrnehmung stark trüben und einfärben. Die Realität wird nur noch stimmungsgefärbt wahrgenommen. Alle Arten des Fühlens gleichen sich in gewisser Weise und sind miteinander verbunden. Schlechte Stimmung kommt dort auf, wo vorher etwas als unangenehm gefühlt oder erlebt wurde.