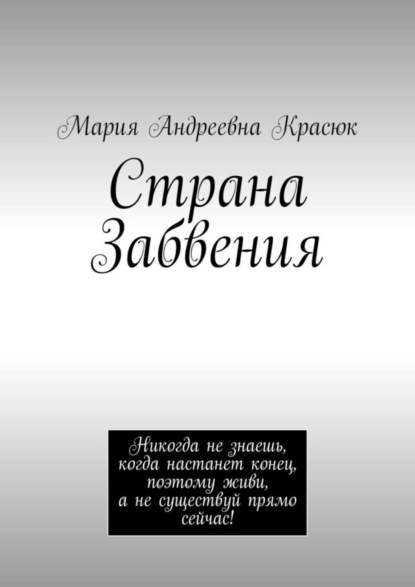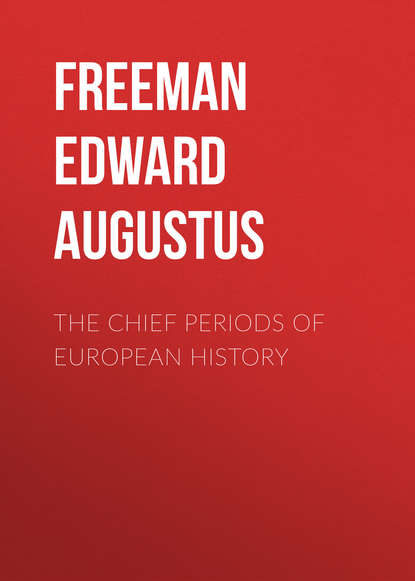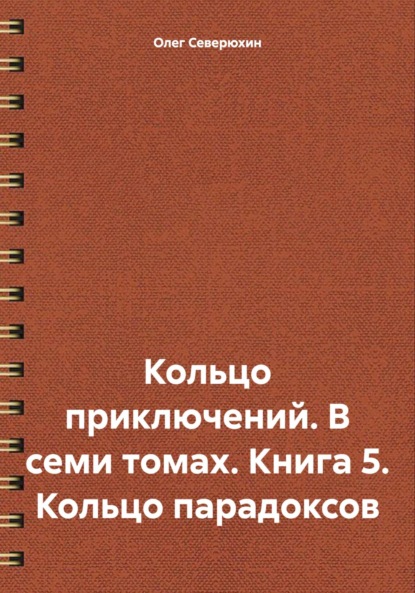- -
- 100%
- +
Heute weiß man, dass sich der Mensch entgegen den frommen Wünschen der christlichen Philosophen hinsichtlich der Erbinformation nur geringfügig von den anderen Säugetieren unterscheidet. Das Nervensystem, die Verarbeitung von Reizen, Emotionen wie Angst und Panik sowie das Empfinden von Schmerzen sind bei Mensch und Tier identisch. Das komplizierte Paarungsverhalten, das Zusammenleben in Gruppen und Familien, die Fähigkeit, vorzusorgen und zu planen, die Verständigungssysteme der Tiere untereinander weisen sie als unsere nächsten Verwandten aus. Die Unterschiede, die zwischen uns und ihnen bestehen bleiben, sind nur gradueller, aber keineswegs prinzipieller Natur.
In vielem sind Tiere dem Menschen sogar weit überlegen. Der Seh-, Hör- und Tastsinn ist bei den meisten Säugetieren höher entwickelt als bei uns. Vom tierischen Navigationssystem, von den Feinheiten der Brutpflege, der beneidenswerten animalischen Work-Life-Balance, der Schönheit und Eleganz der Bewegung, dem bewundernswert genügsamen Lebensstil der Tiere gar nicht erst zu reden. Kurzum: Es gibt überhaupt keinen Grund, den Menschen Leidensfähigkeit und Lebensrecht zuzusprechen und es den Tieren abzuerkennen.
Auch die sogenannte Kulturthese, nach der wir töten dürfen, weil wir so besonders klug sind, gehört also auf den Friedhof für ausgediente Ideologien. Rechtfertigen sollten sich nicht mehr diejenigen, die keine Tiere essen, sondern diejenigen, die es dennoch tun. Denn abgesehen von den kognitiven Fähigkeiten sind Tiere genauso Menschen wie Menschen umgekehrt Tiere sind. Doch während das Menschliche im Tier in seinen Angstschreien und seiner Todespanik in den Schlachthäusern nur allzu deutlich wird, hat der Mensch das Tier in sich auf seinem zivilisatorischen Siegeszug gezähmt oder ausgerottet. Furchtbares – so eine der zentralen Thesen der Frankfurter Schule – habe die Menschheit sich antun müssen, bis das Selbst, der identische, zweckgerichtete, männliche Charakter des Menschen, geschaffen war. Etwas von dieser Selbstverstümmelung, behauptete Max Horkheimer, werde in jeder Kindheit wiederholt. Und, genau besehen, auch bei jedem Mittagessen.
Die Verstümmelung und Herabwürdigung der Tiere zur toten Ware, und zwar ausgerechnet solcher Tiere, die uns am ähnlichsten sind (aus welchem anderen Grund sollten wir lieber Schafe und Schweine als Würmer und Käfer essen?), setzt die Gewalt gegen das Tier in uns selbst fort. »Es herrscht nicht nur Krieg zwischen uns und ihnen«, schreibt Jonathan Safran Foer, »sondern zwischen uns und uns.«
Wir haben das Tier in uns vergessen und vergessen das Tier, sobald es auf unserem Teller liegt. Das gehört zur Verhaltensweise der Kälte, der vielleicht zentralsten psychosozialen Technik fortgeschrittener Kulturen. Dennoch dürfte es wenige Fleischesser geben, die unbeeindruckt blieben, wenn sie sich der Unbequemlichkeit aussetzten, etwa einen Film anzusehen, der ihnen zeigt, wie das Fleisch auf ihre Teller kommt (sehr häufig werden Tiere in der industriellen Schlachthausroutine nicht gründlich genug betäubt und schreiend bei lebendigem Leib gehäutet und zerstückelt). Der südafrikanische Literaturnobelpreisträger J. M. Coetzee erinnert in seiner bewegenden Erzählung Das Leben der Tiere an die »gewaltige gemeinschaftliche Anstrengung«, derer es bedarf, um »unsere Herzen vor den Schlachtstätten zu verschließen«.
Gleichwohl kultivieren wir inmitten dieser offensichtlichen Mitleidlosigkeit sonderbare Mitleidsnischen. Niemand möchte seinen eigenen Hund oder sein eigenes Pferd essen, obgleich Hunde und Pferde durchaus gegessen werden. Für unsere Katzen kaufen wir altersgerechtes Katzenfutter und lassen sie beim Tierarzt gegen Diabetes behandeln, während wir Kühe und Hühner, sauber in Cellophan verpackt, in der Tiefkühltruhe aufbewahren. Dabei ist die Artengrenze, die festlegt, welches Tier geliebt und welches gemordet wird, völlig willkürlich und abhängig von den Sitten und Moden.
Wenn wir die Tiere selbst töten müssten, die wir essen, würde der Fleischkonsum, der sich in den letzten 40 Jahren weltweit verdreifacht hat, vermutlich sprunghaft zurückgehen. Doch die Fleischindustrie, die uns das tote Tier, von Blut gesäubert und zur Unkenntlichkeit zerstückelt, ins Haus liefert, betäubt unsere Empathiefähigkeit. Es fällt uns schwer, uns in unsere Opfer hineinzuversetzen, sie uns als lebendige Individuen überhaupt noch vorzustellen. In diese Vorstellungslücke stoßen die Tiere als Haustiere, Filmhelden, Comic- oder Plüschfiguren. Sie sind die einzigen Tiere, die viele Kinder neben den gebratenen Tierresten auf ihrem Teller noch kennenlernen. Doch sie sind nur Dekor, Erinnerungsstücke an die wirkliche Tierwelt, die selbst nicht mehr zu sehen ist. »Der Blick zwischen Tier und Mensch«, schreibt der Schriftsteller John Berger, »mit dem alle Menschen noch bis vor weniger als einem Jahrhundert gelebt haben, wurde ausgelöscht.«
Was folgt nun aus alldem? Für Jonathan Safran Foer folgt daraus, dass wir zumindest die industrielle Massenhaltung der Tiere unbedingt boykottieren sollten. Tiere müssen wieder artgerecht gehalten und sorgfältig, nicht am Fließband, geschlachtet werden. Und weil aber nahezu alle Tiere, die wir essen, aus Massentierhaltung stammen und in Todesfabriken geschlachtet werden, empfiehlt selbst der Wohlfühlvegetarier Foer, auf Fleisch ganz zu verzichten. Und nicht nur auf Fleisch, sondern auch auf Eier und Fisch, wenn uns das Leben der Legehennen und der sinnlose Tod unzähliger Meerestiere dauert, die für jedes Sushi-Essen als Beifang gestorben sind und wieder ins Meer geworfen werden.
Dem Mitleidsgebot – du darfst die dir verwandten Tiere überhaupt nicht töten, nur weil sie dir schmecken – weicht Foer aus. Er sei, schreibt er, »nicht allgemein dagegen, Tiere zu essen«. Das Glück der Tiere und die Qualität ihres Fleisches liegen ihm mehr am Herzen als ihr Recht auf Leben. Für ihn gibt es, was für mich undenkbar ist: »ethisch unbedenkliches Fleisch«.
So viel Versöhnlichkeit mag die Argumentation dieses eindrücklichen Buches schwächen, aber sie ist nicht unvernünftiger als die Wirklichkeit: 94 Prozent der Deutschen essen gern tote Tiere. Foer agiert wie ein Emissär mit weißer Fahne, der im unversöhnlichen Krieg zwischen der winzigen Minderheit der Tierrechtler und der überwältigenden Mehrheit der Tieresser Frieden stiften will, um das schwerfällige Rad der Geschichte gemeinsam ein wenig zugunsten der Tiere voranzudrehen. Das ist schon viel.
Am Ende wird der Verzicht auf Fleisch allen helfen, den Tieren und den Menschen. Er wird nicht alle Menschheitsprobleme lösen. Er löst noch nicht einmal alle moralischen Probleme, vor die uns unser Hunger stellt. Die Grenzen des Tötungsverbots sind niemals eindeutig zu bestimmen in der unendlichen Kette der Lebewesen. Warum verschone ich die Kuh und töte die Fliege? Ist das Seepferdchen weniger wert als das Pony? Und was ist mit dem Seelenleben der Pflanzen? Der grelle Scheinwerfer der Erkenntnis durchdringt die Materie, doch die meisten Geheimnisse des Lebens bleiben im Dunkeln. Es ist unmöglich, in unserem Zusammenleben mit den Tieren alles richtig zu machen. Doch gibt uns das noch lange nicht das Recht, alles falsch zu machen.
Iris Radisch/Eberhard Rathgeb (Hg.): »Wir haben es satt! Warum Tiere keine Lebensmittel sind.«
Wer darf wen töten und warum? Plädoyers für den Vegetarismus zwischen Empörung und Mitgefühl. Residenz Verlag, 259 Seiten, 19,90 Euro
Lebensreformbewegung: Als Reaktion auf die fortschreitende Industrialisierung entstanden im ausgehenden 19. Jahrhundert verschiedene Bewegungen, die unter dem Begriff »Lebensreform« zusammengefasst werden. Gemeinsam war ihnen, dass sie in der modernen Gesellschaft Zivilisationsschäden befürchteten und die Rückkehr zu einer naturgemäßen Lebensweise forderten. Dazu gehörten die Kneipp- und die FKK-Bewegung, reformpädagogische Vereinigungen und Initiativen gegen das Tragen von Korsetts.
Jonathan Safran Foer: Sein Erstling »Alles ist erleuchtet« machte den damals 25-jährigen Autor 2002 auf Anhieb weltberühmt. Der Roman knüpft an eigene Erlebnisse an und erzählt von einem Amerikaner jüdischer Herkunft, der sich in der Ukraine auf die Suche nach Spuren seiner Vorfahren macht. Sein zweiter Roman, »Extrem laut und unglaublich nah« von 2005, verarbeitet die Ereignisse vom 11. September. Sein jüngstes Werk, »Tree of Codes« aus dem Jahr 2011, ist noch nicht auf Deutsch erschienen.
PETA: Die weltweit größte Tierschutzorganisation People for the Ethical Treatment of Animals (Peta) wurde 1980 in den USA gegründet und hat nach eigenen Angaben mehr als drei Millionen Unterstützer weltweit. Sie kämpft, teilweise mit spektakulären Aktionen, etwa gegen Tierversuche, Massentierhaltung, Hunde- und Hahnenkämpfe sowie die Pelzindustrie. Die deutsche Sektion wurde 1994 gegründet und klagt gegenwärtig vor dem Europäischen Gerichtshof, weil ihr der Vergleich der Massentierhaltung mit dem Holocaust untersagt und ihr Antisemitismus unterstellt wurde.
Descartes: René Descartes (1596–1650) war ein französischer Philosoph, Naturwissenschaftler und Mathematiker. Der Begründer des Rationalismus beschäftigte sich unter anderem mit der Dualität zwischen Geist und Materie und formulierte den Satz »Cogito ergo sum – ich denke, also bin ich«. Außerdem erfand er die analytische Geometrie, die in der Physik eine große Rolle spielen sollte. Da er sich auch mit der Existenz Gottes beschäftigte, stellte der Vatikan seine Schriften 1663 auf den Index.
Frankfurter Schule: Die marxistisch inspirierte Frankfurter Schule ging aus dem Institut für Sozialforschung hervor, das 1923 an der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität in Frankfurt gegründet wurde. Ihr Forum war die Zeitschrift für Sozialforschung, herausgegeben von Institutsleiter Max Horkeimer, in der unter anderem Theodor W. Adorno, Herbert Marcuse und Walter Benjamin schrieben. 1933 wurde das Institut von den Nazis geschlossen und 1951 von Horkheimer und Adorno wiedereröffnet.
Fleischkonsum: Weltweit aß im Jahr 2010 jeder Mensch im Schnitt rund 42 Kilogramm Fleisch. In den Industrieländern waren es 80 Kilogramm pro Kopf, in den Entwicklungsländern nur 31,5 Kilo. Deutschland lag mit einem Pro-Kopf-Verbrauch von etwa 90 Kilogramm weit über dem Durchschnitt. Rund 55 Kilogramm davon entfielen auf Schweinefleisch.
John Berger: John Berger, geboren 1926, ist ein britischer Schriftsteller, Maler und Kunstkritiker. Als er für seinen Entwicklungsroman »G.« 1972 den Booker Prize erhielt, verursachte er einen Skandal, indem er die Hälfte des Preisgeldes der Black-Panther-Partei spendete. 2006 erntete er ebenfalls Empörung, weil er dazu aufrief, die kulturelle und wissenschaftliche Zusammenarbeit mit Israel wegen dessen Besatzungspolitik zu boykottieren. Sein jüngster Roman erschien 2010 unter dem Titel »A und X. Eine Liebesgeschichte in Briefen«.
Fleischkonsum
Alles Geschmackssache
Nichts gegen Paprika, Rüben, Pilze. Aber schon mal Rehfilet probiert, gewürzt mit Meersalz, schwarzem Pfeffer und Thymian?
Von Michael Allmaier
Zwei Jahre habe ich durchgehalten, zwei Jahre ohne Fleisch. Meine Gründe waren nicht ehrenwert, im Wesentlichen wohl Ekel. Vor der babyrosa Wurst, nachdem ich wusste, was drin war. Vor den grausamen Mechanismen des Aufziehens, Anfütterns, Tötens. Wieder angefangen habe ich aus einem Grund, auf den ich auch nicht sehr stolz bin: Es hatte mir einfach zu gut geschmeckt. Der Wildschweinschinken, die Kalbsleber, die Taubenbrust – ich wollte nicht länger darauf verzichten.
Fleisch ist ein erstaunliches Lebensmittel. Man brät es und hat fast schon ein Gericht. Man kocht es und gewinnt eine Brühe. Nichts gegen Paprika, Pilze, Rüben, aber die kommen da einfach nicht mit.
Der Tierwelt hat meine vorübergehende Läuterung kaum etwas gebracht. Mir aber schon. Ich verstehe jetzt, was Vegetarier sehen. Diesen Blick, der auf fremde Teller fällt: Igitt, zerstückeltes Tier. Und der dann prüfend aufwärts wandert zu dem, der so etwas isst. Zu einem, der kein Huhn rupfen könnte, ohne sich zu erbrechen, der aber, einem dumpfen Trieb folgend, seine verkümmerten Eckzähne in das Aas des Tieres schlägt, das ein anderer für ihn erlegt hat. Ein kläglicher Anblick, so kam mir das vor. Heute sehe ich mit diesen Augen vor allem mich selbst.
Wenn man uns Fleischesser zur Rede stellt, verstricken wir uns in heillosen Unsinn. »Der Mensch ist ein Raubtier und braucht nun mal Fleisch«, »das Tier stirbt irgendwann ja sowieso«, solche Sachen. Die Wahrheit ist viel einfacher: Wir stehen vor einem Dilemma. Wir mögen Tiere, ihr Fleisch aber auch. Und entscheiden meistens eher mit dem Magen als mit dem Herzen.
Wie schlimm ist das? Ich weiß es nicht. Es gibt ja keinen, der uns vormacht, wie man eigene Freud und tierisches Leid gegeneinander aufwiegen soll. Mitgeschöpfe als Nahrung zu betrachten ist auf dieser Welt der Normalfall. Wir wissen, dass Tiere Tiere töten, ohne Not oft und gewiss ohne Reue. Und auch die Naturvölker, sonst ein gern bemühtes Vorbild, zeigen sich in dieser Hinsicht alles andere als zimperlich. Um an Fleisch zu kommen, haben Menschen keine Mühen gescheut. Aus freiem Entschluss darauf zu verzichten ist eine bewundernswerte zivilisatorische Leistung. Aber braucht sie diesen Rigorismus, diese Bereitschaft, jeden ins Unrecht zu setzen, der es etwas lockerer sieht?
Ich selber halte es heute so: Ich esse wenig Fleisch, in der Woche nicht sehr viel mehr als der Durchschnittsdeutsche am Tag. Ich lasse es mich etwas kosten. Das Tier soll die Sonne gesehen, sein kurzes Leben genossen und sein liebstes Futter gefressen haben, ehe es mir als Nahrung dient. Dahinter steckt auch Eigennutz; solches Fleisch schmeckt einfach besser.
Ja, das ist ein fauler Kompromiss. Und wann immer ich auf einer Speisekarte von Milchlamm oder Stubenküken lese, sehe ich die Tiere vor mir und schäme mich. Aber auch der komplette Verzicht hat mir damals keinen Seelenfrieden gebracht. Ich kam immer noch ins Stottern, wenn einer fragte, warum ich weiter Fisch aß, Milch trank, Lederjacken trug, Arzneimittel verwendete, die an Tieren erprobt worden waren. Man kann verzichten, soweit man es aushält, und wird doch den Zwiespalt nicht los.
Wir Fleischesser stellen uns dumm, wenn wir unser Steak anschauen, als sei es am Baum gewachsen, nur zu unserem Vergnügen. Aber ganz ehrlich sind auch die Vegetarier nicht, wenn sie milde auf uns herunterlächeln von einer höheren Stufe der Evolution. »Was ihr nur habt mit eurem Fleisch?«, fragen sie gerne. »Ich brächte das gar nicht herunter.«
Liebe Vegetarier, bitte probiert doch einmal oder noch einmal, wie es sich anfühlt, Fleisch zu essen. Es müssen keine zwei Jahre sein, aber wenigstens zwei Bissen. Kostet ein Stück Rinderschulter, Charolais, marmoriert, einen Tag lang mit Rotwein und Wurzelgemüse geschmort. Eine Scheibe vom Rehfilet, medium rare gebraten, bestreut mit Meersalz, schwarzem Pfeffer und frischem Thymian. Dann versteht ihr besser, wovon wir reden. Jedenfalls so lange, bis der antrainierte Ekel euch einholt und ihr ausspucken müsst. Es stimmt ja, ihr seid die besseren Menschen.
Aber mehr Spaß haben wir.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.