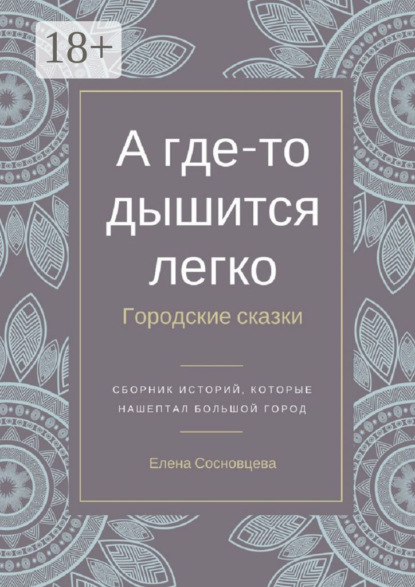Maritime E-Bibliothek: Sammelband Abenteuer und Segeln

- -
- 100%
- +
Arme, kleine Niña, die sonst so tapfer ist! Und skeptisch. Und nicht an Geister glaubt …
Josset verabschiedete uns: „Sie sahen das Beste und das Schlechteste von Pigeon Island“. Mit dem Schlechtesten meinte sie aber nicht etwa Niñas Erlebnisse, sondern die vielen Touristen, die am Sonntag von Martinique und von Port Cast ries in Yachten angesegelt kamen.
Am Nachmittag segelten wir weiter, den Schatz hatte ich nicht entdecken können, und das war gut so, sonst hätte Pigeon Island doch eine seiner vielen Attraktionen verloren.
Die letzten Indianer
In der Nacht segelten wir an Martinique vorbei, das einer der großen Knotenpunkte des Karibischen Touristenverkehrs ist. Doch Niña kannte es schon. Wir hatten uns als nächstes Ziel das urwüchsige, regenreiche Dominica ausgesucht; nachmittags liefen wir am Nordwestende dieser Insel in die riesige Prinz Rupert-Bay ein und warfen vor dem halb verfallenen Dorf Portsmouth Anker.
Als wir uns der Mole näherten, rief eine Schar von Kindern, schon bevor wir aussteigen konnten, mit ausgestreckter Hand nach „Pennies“. Das erstaunte uns, weil Dominica die fruchtbarste der Westindischen Inseln ist und dazu noch, im Gegensatz zu den anderen Inseln, unterbevölkert. Alles wächst in Dominica, ob man düngt oder nicht, ob man den Boden pflegt oder sich selbst überläßt – man braucht nur wenig zu arbeiten, um ernten zu können.
Portsmouth ist ein sauberer Ort, dessen Häuser jedoch an Skorbut zu leiden scheinen, denn überall fehlen Ziegel, Bretter oder Fensterscheiben. Wir waren nach Portsmouth gekommen, um von hier aus zu dem berühmten Indianerreservat zu gelangen, das auf der Ostseite der Insel liegt und nur sehr mühselig zu erreichen ist. Nach langem Suchen fanden wir schließlich den Sohn des Drogisten, der gegen hohe Entlohnung bereit war, uns bis in die Nähe eines neu erbauten Flugplatzes zu fahren, von wo aus wir laufen wollten. Unser Führer war ein Schwarzer, dessen Wurzeln nach Afrika wiesen. In der Neuen Welt leben rund 50 Millionen Menschen afrikanischer Abstammung.
Wissenschaftler haben auf den Antillen die verschiedensten afrikanischen Kulturkreise abgrenzen können: Einflüsse der Fanti-Aschanti-Kultur aus der Goldküste, dem heutigen Ghana, lassen sich auf den ehemals britischen Antillen nachweisen; auf den französischen Inseln dominieren Kultureinflüsse aus Dahome, und auf den spanischsprechenden findet man vorwiegend Sitten und Gebräuche, deren Ursprungsland Nigeria ist.
Ohne die Sklavenimporte nach der Neuen Welt wäre der wirtschaftliche Aufschwung in Amerika nicht denkbar gewesen; das Wohlergehen ganzer Länder basierte auf der billigen Arbeitskraft der Afrikaner, Industriezweige blühten auf, die neue Naturprodukte verarbeiteten: Zuckerrohr und Baumwolle, in kleinem Maße auch Tabak und Indigo.
Bereits ein Menschenalter nach der Entdeckung Amerikas waren die Indianer auf einigen Karibischen Inseln nahezu ausgestorben, geflohen oder gefangen und in die Bergwerke und Plantagen der Spanier abtransportiert. Da wollte der spanische Bischof Las Casas der zum Aussterben verurteilten Rasse helfen und empfahl, Afrikaner zur Arbeit heranzuziehen. Er hat diese gutgemeinte Empfehlung später bitter bereut.
In unserer heutigen Zeit kann man den Sklavenhandel mit seinen schändlichen Auswüchsen nicht mehr so recht verstehen, zieht man nicht in Betracht, daß in Europa noch Feudalsysteme herrschten und die meisten Menschen der ländlichen Bevölkerung Leibeigene waren, als sich die Portugiesen dem afrikanischen Sklavenhandel zu verschreiben begannen. Später stiegen die Spanier und vor allem die Briten ganz groß in das Sklavengeschäft ein.
Nicht sehr bekannt ist auch, daß es im 17. Jahrhundert oft mehr Todesfälle auf den Auswanderschiffen als auf den Sklavenschiffen gab. Die Kapitäne der einen Schiffe erhielten für jeden heil herübergebrachten Afrikaner ein Handgeld, die der anderen sparten das Verpflegungsgeld der an Bord gestorbenen Emigranten! Was haben die königlich privilegierten Pfeffersäcke aus England, aber auch aus Neuengland, nicht für Geld mit dem schwarzen Elfenbein verdient! Erst als sich damit keine rechten Geschäfte mehr machen ließen, schafften sie den Sklavenhandel ab – und ernteten sogar noch Applaus dafür, weil die Spanier und Portugiesen in kleinem Rahmen weitermachten.
Die letzten Ureinwohner der Antillen-Inseln, die Kariben-Indianer, deren Nachkommen wir nun aufsuchen wollten, hatten sich auf einigen der Inseln verzweifelt gegen die europäischen Eindringlinge gewehrt. Wer von ihnen nicht im Kampfe fiel oder Selbstmord beging, erlag meist den Krankheiten, die von der Alten Welt in die Neue eingeschleppt wurden. Tuberkulose, Pocken und Malaria forderten viel mehr Opfer als die Feindseligkeiten. Heute findet man nur noch selten auf den Karibischen Inseln ein Gesicht, in dem sich indianische Züge entdecken lassen. Auf Dominica jedoch gibt es ein Reservat, ein „Naturschutzgebiet“ für Indianer.
Da wir erst am späten Morgen eine Transportmöglichkeit gefunden hatten, mußten wir uns beeilen, wollten wir noch vor Einbruch der Dunkelheit wieder zurück sein. Auf einem primitiven Weg ging es bergauf und bergab, bald durch Morast, bald über vulkanisches Gestein, mal unter Mangobäumen hindurch, dann wieder in der grellen Mittagssonne. Wir dampften, die Hemden klebten an der Haut. Fragten wir in einer Hütte, ob das Dorf der Kariben nicht endlich bald käme, hieß es stets: „Hinter dem nächsten Berg!“
Dann stießen wir auf eine Gruppe von Indianern, die aus einem Gummibaum einen Einbaum geschlagen hatten und ihn nun durch Aufsetzen einer Planke zu einer echten indianischen Piroge umbauen wollten. Gedichtet wurde mit Asphalt, die Breite des Bootes etwas erweitert, indem man Wasser hineinschüttete und die Bordwände mit Hilfe von Querstäben dehnte.
Keiner dieser Indianer war reinblütig, alle hatten sie einen Schuß afrikanischen Blutes in ihren Adern. In ihrer Nähe wuschen und badeten Frauen und Kinder, die vorwiegend indianisch aussahen, aber trotzdem von fremden Blutbeimengungen nicht frei waren. Erst als wir in dem Dorf Salybia auf den neugewählten König stießen, hatten wir einen reinrassigen Indianer vor uns.
Bretterbude als Königspalast
Der König des Reservates war gerade erst vor wenigen Wochen gewählt worden und wartete noch auf die Bestätigung seiner Würde durch die Engländer. Von königlicher Haltung war bei ihm nichts zu sehen, er war ein junger, schüchterner und verlegener Mann, der außer seiner Reinblütigkeit nichts Königliches an sich hatte. Seiner Hütte gegenüber lag der kleine Krämerladen seines Onkels, in den wir ihn zu einem Drink einluden.
Mehrere hundert Indianer, meist Mischlinge, leben in dem Reservat und verdienen sich durch Landwirtschaft und Ackerbau ihren Unterhalt. Die Königshütte – sie wurde durch große Balken gestützt – bestand aus zwei Räumen: einem Schlafzimmer mit einem Doppelbett, einem Schrank und einem Stuhl, und einem Wohnzimmer, in dem ein Tisch und zwei Stühle standen. Alle Wände waren mit Bildern, zum Teil aus Zeitungen ausgeschnitten, beklebt. Eine junge Frau mit einem Baby auf dem Arm und einem halben Dutzend Kinder am Rockzipfel stellte uns der König später als seine Schwester vor. Wie ihr Bruder war auch sie ein weicher, pastöser, blasser Typ, den man geographisch in den koreanischen Raum einordnen möchte. Eine andere Schwester des Königs arbeitete als Hausmädchen in Guadeloupe.
Die Indianer sprachen leise in schlechtem, mit dem Patois der Afrikaner vermischten Englisch; das Indianisch ihrer Vorfahren haben sie vergessen. Mit ungelenker Hand schrieb uns der König ein paar Zeilen für unser Bordbuch auf einen Zettel.
Auf dem Rückweg trafen wir einen englischen Farmer, der wie ein Eingeborener lebte. Er lud uns zu einer Aguti-Mess ein. Das Aguti ist ein „Kaninchenferkel“, ähnlich dem Meerschweinchen, ein Nagetier, dem man auf den Inseln häufig begegnet. Wir hatten zu wenig Zeit, um das gutgemeinte Angebot des Farmers annehmen zu können. Ob wir dann nicht wenigstens „Berghühner“ mit ihm essen wollten? Mountain chicken sind große, eßbare Frösche, auf die wir leider auch verzichten mußten. Aber einen selbstfabrizierten Zuckerrohrschnaps konnten wir ihm nicht abschlagen.
Dem Schiffbruch nahe
Noch in der Nacht nahmen wir Abschied von Dominica, dem Aschenbrödel Westindiens, um mit dem ersten Morgengrauen Les Saintes zu besuchen, eine kleine Inselgruppe im Süden von Guadelope. Im Gegensatz zu Dominica sind die Saintes kahl und arm. Aber sie sind von Interesse, weil auf ihnen eine Gruppe von Franzosen gesiedelt hat, die das geruhsame Leben ihrer Ahnen aus dem 17. Jahrhundert weiterführen.
Als wir durch die schmale Einfahrt in die Bucht von Bourg segelten, griff die Sonne mit ihren goldenen Strahlenfingern gerade nach dem wuchtigen Fort Napoleon über uns. Direkt vor der Mole ankerten wir. Das Städtchen Bourg des Saintes unterscheidet sich von allen anderen Orten Westindiens, die wir bisher kennengelernt hatten, dadurch, daß in ihm mehr Weiße als Schwarze wohnen und daß es blitzsauber gefegt ist. Kleine, in prächtigen Farben gehaltene Häuser waren von Wein umrankt – es war wohl das erste Mal, daß wir in den Tropen Wein entdeckten. Kokospalmen und gut gepflegte Ziergärten umsäumten die Anwesen. Am Ufer lagen Boote über Boote; die Bevölkerung ernährt sich vorwiegend von Fischfang.
Mehrfach hatten wir in den Berichten früherer Besucher gelesen, die Bretonen der Antillen seien „degeneriert“, Lepra und vererbte Syphilis an der Tagesordnung. Von alle dem war an diesem Tage nichts zu sehen. Die Weißen – sie werden häufig „Weiße Neger“ genannt – waren groß, schlank, muskulös; einige zeigten lediglich Hautverbrennungen durch Sonneneinwirkung; sie als „degeneriert“ zu bezeichnen, fanden wir kühn. Wir fühlten uns zeitweilig an die französische Rivieraküste versetzt, vor allem, als wir mittags Rotwein zum Essen serviert bekamen.
Auf der Mole lernten wir einen Franzosen kennen, der vorgab, Dieselfachmann zu sein. Er wollte gerade nach Guadeloupe und erbot sich, den Motor und die Umsteueranlage zu überprüfen. Drüben könnte ich ihn dann wieder an Land setzen.
Wir segelten also nach dem nur wenige Kilometer entfernten Guadeloupe, während der Fachmann mit Kennermiene bald herausfand, daß er uns nicht helfen konnte. So wollte ich ihn in seinem Hafen Trois Rivieres absetzen. Wir steuerten durch die enge Einfahrt und waren gezwungen, direkt hinter einer Brandungslinie Anker zu werfen. Hinter uns ragten drohend Felsen auf. Wenn der Anker nicht hielt, mußten wir zerschellen!
Mir gefiel das gar nicht, aber schließlich blieb mir nichts anderes übrig, als den Fachmann an Land zu bringen. Das Boot tanzte zwischen Brandungswellen und Felsen auf und ab, ich hatte den Eindruck, daß es den Felsbrocken mit jeder Welle näher rückte. Niña war nicht weniger aufgeregt als ich, weil wir uns beide über die Gefahr im Klaren waren. Unser Spezialist aber lächelte nur, er war kein Segler und hatte keine Ahnung, was er uns da eingebrockt hatte. Schließlich faßte ich mir ein Herz und pullte ihn zu einem nahen Ruderboot, mit dem er vollends an Land kommen konnte.
Als ich zum Boot zurückenterte, sah ich Niña schon von weitem winken, als könnte sie mich so schneller herbeiholen. Die LIBERIA hatte sich wirklich mehr und mehr der Felswand genähert. In höchster Eile strebte ich zu ihr, sprang an Bord und hievte unseren Anker aus dem Grund. Nur wenig mehr, und die LIBERIA hätte Bekanntschaft mit dem Felsen gemacht …
Durch solche dummen Zufälle kann man ein Boot verlieren! Schwitzend und wie zerschlagen saßen wir anschließend im Cockpit und schauten auf die vielen Lichter von Basseterre, die in der beginnenden Dunkelheit zu uns herüberglitzerten. An Nachtruhe war nicht zu denken; die Aufregung steckte uns noch immer zu tief in den Knochen.
Dorf im Vulkankrater
Nach einer Fahrt von emem Tag und zwei Nächten standen wir frühmorgens vor Saba, einer kleinen holländischen Insel, die nur aus einem gewaltigen, erloschenen Vulkan besteht. Wie schon in Lome konnten wir hier nicht mit unserem eigenen Beiboot an Land gehen, die Brandung war zu stark. Nach den Zollbeamten kam ein Brandungsboot und brachte uns wohlbehalten, wenn auch naß, auf den „Felsen“, The Rock, wie man Saba nennt.
Auf Serpentinenwegen marschierten wir den Berg hinauf, mühsam, Schritt für Schritt. Als wir vom Kraterrand das Dorf Bottom sehen konnten, glaubten wir in Walt Disneys Kinderland zu schauen, so puppenähnlich sah die Anordnung der kleinen sauberen Häuser aus. Auch hier schien man vollkommen abgeschlossen zu leben; Ausblicke haben die Dorfbewohner praktisch meist nur nach oben; sie wohnen im Grunde und an den Rändern des Kraters.
Holländer leben auf Saba; doch sprechen sie meist kein Holländisch, sondern Englisch. Viele der Männer fahren auf den Weltmeeren als Kapitäne oder als Seeleute auf den Küstenbooten im Karibischen Meer. Wenn sie pensionsreif sind, kehren die meisten wieder zurück und führen ein beschauliches Leben, indem sie ihren winzigen Garten bestellen oder vor der Tür sitzen und paffen. Die Frauen fertigen ebenso schöne Stickereien an wie die Bewohnerinnen von Madeira.
Auf der Ostseite der Insel gibt es noch ein weiteres Dorf, das jedoch an den Steilhängen klebt, vom Passat wird es kostenlos auf Temperaturen ventiliert, die nicht mehr tropisch sind.
Mit dem Gouverneur fuhren wir in einem Jeep wieder zum Landeplatz. Wir sprachen über Hurrikane, die Geißel der Karibischen See. Selbst sein Dorf inmitten des Inselvulkans hielt der Gouverneur nicht für hurrikansicher. Daß er mit seiner Meinung recht hatte, beweist die Vergangenheit der Insel.
Vor allem im Sommer und Herbst entwickeln sich Hurrikane; zwar schrieben wir noch Mai, jedoch wollten wir auf alle Fälle noch im Juni in Miami eintreffen. Jeden Tag hörten wir zweimal den Wetterbericht, um uns auf einen eventuellen Orkan einrichten zu können. Wie die tropischen Zyklone im einzelnen heißen, bleibt sich gleich; ob Hurrikan, Taifun (in Ostasien) Baguio (auf den Philippinen) oder Willy-Willy (in Australien) – ihre Winde bewegen sich immer kreisförmig und können Geschwindigkeiten von über 400 km in der Stunde erreichen. Im Gegensatz zu örtlich scharf begrenzten Tornados erreichen Hurrikane oft Durchmesser von vielen hundert Kilometern.
Von der Stärke eines tropischen Zyklons kann man sich am besten einen Begriff machen, wenn man sich diese bei den Unfälle vor Augen führt: einem schweren amerikanischen Kreuzer, der gerade erst ein Jahr im Dienste stand, wurden bei Okinawa in einem schweren Taifun 35 Meter seines Vorschiffes einfach weggerissen. Während des letzten Krieges sind in einem anderen Taifun drei amerikanische Zerstörer bei den Philippinen gesunken, über 750 Menschen kamen dabei ums Leben.
Auf den Jungferninseln
Die Bugwelle wie einen weißen Knochen im Maul, jagte die LIBERIA IV bei steifem Passat nach Westen, nach St. Croix, der südlichsten amerikanischen Jungferninsel, auf der ich 1955 nach 65 tägiger Einbaumfahrt zum ersten Male an Land gegangen war. Nichts hatte sich seither hier verändert. Wir trafen den alten Hafenkapitän wieder, die Zollbeamten und meine Bekannten, als wir am frühen Morgen des nächsten Tages in den blauen, glasklaren Wassern der Lagune ankerten.
Auf unserem ersten Postgang stießen wir auf das Ehepaar Lawaetz, Westinder dänischer Abstammung, bei denen ich früher gewohnt hatte und die mich schon in Deutschland besucht hatten. Mit einem anderen alten Bekannten, Fritz Henle, dem berühmten Fotografen, plauderten wir später in dem eleganten Hotel „St. Croix-by-the-Sea“, das den Lawaetzens gehört. Als eine Kellnerin einem kranken Gast Essen aufs Zimmer bringen wollte, hielt Frau Lawaetz sie an, schaute aufs Tablett und legte noch ein paar Blumen hinzu: „Es ist kein Spaß, krank zu sein“. Wir freuten uns, daß in diesem Hotel Gäste noch als Individuen und nicht als Nummern behandelt wurden.
Noch ist auf St. Croix der Fremdenverkehr nicht zur Industrie geworden, aber überall schießen neue Hotels aus dem Boden, und die Grundstückspreise schnellen in die Höhe, so daß die friedliche Insel bald einen hektischen Charakter erhalten und mit ihrem internationalen Nachbarn im Norden, St. Thomas, wetteifern dürfte.
Als wir von einem unserer Ausflüge auf St. Croix zu unserer LIBERIA zurückkamen, saß auf der Reling ein brauner Pelikan. Er war so tief in Gedanken versunken, daß er erst verstört aufflog, als wir unmittelbar neben ihm waren. Im Flug glich er einer Witzblattfigur: vorne nichts, in der Mitte ein plumper Körper, auf dem der Hals mit einem langen Schnabel ruht, und achtern auch nichts, es sei denn ein Stummelschwanz.
Überall in den Kariben haben wir Pelikane gesehen. Manchmal gehen sie gemeinsam auf Jagd, indem sie in „Schlachtordnung“ Schulen von Fischen ins seichte Wasser treiben und dann plötzlich mit ihrem gewaltigen Kehlsack, der als Kescher dient, zufassen. Da sie in ihrem Fangsack bis zu 15 Liter Wasser halten können, wird sich wohl so mancher Fisch hineinverirren.
Wir haben sie indes nur aus der Luft jagen sehen. Sie flogen flach über dem Wasser und ließen sich, sobald sie einen fetten Brocken entdeckt hatten, mit geöffnetem Schnabel auf das ahnungslose Opfer fallen. Es gab einen Aufprall, als hätte ein Turmspringer einen Bauchklatscher gemacht, das Wasser spritzte nach allen Seiten, und dann sah man den Schwanz des Vogels wieder aus dem Wasser kommen, gefolgt vom Kopf.
Im Vergleich zum gewandten Tölpel, der die Kunst des Stoßtauchens beherrscht, ist der Pelikan ein tolpatschiger Anfänger. Seine Jungen sind noch häßlicher als die Alten, und sie schreien in ihrer Jugend so viel, daß sie im Alter noch die Ohren voll haben und meist schweigen.
Wieder rüsteten wir zur Weiterfahrt. Ganz entgegen unserer bisherigen Gewohnheit segelten wir dieses Mal bei Tage los und kamen am Abend in dem mir so vertrauten Charlotte Amalie an, dem Hafen von St. Thomas. Kaum war der Anker in die Tiefe gesunken, als auch schon Bekannte an Bord gestiegen kamen.
St. Thomas hat sich in den letzten Jahren immer mehr auf den Fremdenverkehr eingestellt, neue Piers sind errichtet, unzählige Häuser und Hotels aus dem Boden gestampft und sogar neue Straßen angelegt worden. Im Yachtclub wimmelt es von schnittigen Yachten, die den Touristen zur Verfügung stehen.
Deutsche luden uns zu einer Inselrundfahrt ein. Unser erstes Ziel war French-Town im Westen der Bucht. Hier hatten sich vor Jahrhunderten bretonische Fischer von der Insel St. Barts angesiedelt und eine kleine Ortschaft um eine Kirche herum errichtet; sie nannten ihre Siedlung schlicht Carénage, weil sie hier ihre Boote bauten und kielholten. Die Englisch sprechenden Eingeborenen verstanden jedoch nicht, was die braungebrannten Fischer redeten und nannten diesen Ort deswegen „Cha-Cha-Town“, ähnlich ihrem „Cha-Cha-Baum“, der Samenkapseln trägt, die im Winde das lautmalerische Cha-Cha erzeugen.
Auch diese Nachkommen der Bretonen haben sich wie die auf Les Saintes erstaunlich reinrassig gehalten, obwohl ihre Haut manchmal von der Sonne so braun gegerbt ist, daß man Mulatten in ihnen vermuten könnte. Die Alten unter ihnen sprechen noch heute kein Englisch, die Frauen flechten seit altersher Hüte, Körbe und Reusen, während die Jugend heute überall in den Geschäften der Stadt arbeitet und den bunten Kistenhäusern ihrer Eltern einen moderneren Anstrich geben möchte.
Auf der Nordseite der Insel suchten wir nach seltenen Muscheln und badeten in einer geschützten Bucht. Zum erstenmal hatte Niña Zeit und Lust, sich mit dem Unterwasserleben zu beschäftigen, und wenn sie auch nur mit Maske und Schnorchel an kleinen Riffs ihre Tauchversuche unternahm, so war sie doch voller Begeisterung, wie alle, die jemals in den Tropen den Kopf unter Wasser gesteckt haben.
Über das „Mountain-Top-Hotel“ fuhren wir in die herrliche Magens Bay, suchten nach Scherben aus der Zeit der Kariben, schlenderten durch Mangrovenwälder, in denen riesige Landkrabben Vertiefungen in der Größe von Kaninchenlöchern ausgebuddelt hatten und gingen in den Botanischen Garten, in dem afrikanische Affenbrotbäume neben indischen Feigenbäumen standen. – St. Thomas ist ein Paradies für den reichen Touristen. Es bietet ein ideales Klima, tief eingeschnittene, von Palmen umsäumte Buchten, mondäne wie entlegene Strandplätze mit weißem Korallensand und türkisfarbenem Wasser; und von nahezu allen Hotels genießt man eine majestätische Aussicht auf die Nachbarinseln und das Meer. Wer sich die Inselwelt genauer ansehen will, mietet sich eine der vielen Hochseeyachten, die an der neuen Pier des Yachtclubs von St. Thomas in unübersehbarer Zahl darauf warten, die Besucher der Insel an jeden erwünschten Punkt der Antillen oder sogar der Welt zu bringen.
1 Altes Längenmaß der Seeschiffahrt: der zehnte Teil einer Seemeile, also 185,2 m.
ZEHNTES KAPITEL
ES GEHT UM KOPF UND KRAGEN
Kurz vor Mitternacht starteten wir nach San Juan, der Hauptstadt von Puerto Rico. In der engen Virgin Passage stießen wir nachts auf ein seltsames Lichtergewirr, das sich bei näherem Hinschauen als ein Schlepper mit zwei Dampfern erwies, die gerade von einem anderen Dampfer überholt wurden. Zum dritten Male passierte es uns, daß wir auf dieser Fahrt Hochseeschleppern begegneten, ein Beweis dafür, wie wichtig es ist, die Lichterführung genau zu kennen.
Tangwiesen im Ozean
In den Morgenstunden des nächsten Tages holte ich mit dem Kescher Sargassokraut aus dem Meer, schüttete die Krautbüschel über der Plicht aus und ließ Niña von den vielen Garnelen kosten, die aus dem Tang herausfielen. Nach anfänglichem Widerstreben überwand sie sich und probierte die Tierchen. Es blieb ihr nichts anderes übrig, als ihren Wohlgeschmack zu loben.
Als ich auf den letzten 500 Seemeilen meiner Faltbootfahrt keine Lebensmittel mehr hatte (bei der ersten Kenterung waren die Konserven aus dem Boot gefallen), waren mir vor allem die köstlich schmeckenden Garnelen von größtem Nutzen gewesen. Aber in diesem gelbbraunen Sargassokraut halten sich nicht nur Garnelen auf, sondern noch viele andere Tiere: Krebse, Schnecken, Fische und wenn auch seltener, Seepferdchen.
Von dem Sargassum-Tang berichtete schon Kolumbus auf seiner ersten Fahrt; seine Matrosen befürchteten nämlich, die Tangwiesen, durch die sie am Ende ihrer Reise segelten, deuteten auf verborgene Klippen, an denen sie zerschellen könnten. Kolumbus ließ daraufhin loten, fand aber keinen Grund.
Das Gebiet in dem das Sargassokraut vorwiegend treibt, das Sargasso-Meer, erstreckt sich als ovales Gebilde zwischen den Jungferninseln im Süden und den Bermudas und Azoren im Norden. Es ist eingekeilt zwischen Golfstrom und Passatgebiet, vergessen von den Strömungen, vernachlässigt von den Winden. Und welche Schauermärchen sind nicht von diesem Sargasso-Meer in Seemannskreisen erzählt worden! Wracks sammelten sich dort, hieß es, Schiffe hätten sich in den Tangwiesen festgefahren! Nun, ich bin einmal mit einem Dampfer durch das ganze Sargasso-Meer gefahren; es ist eine Fahrt wie durch andere Meere auch, mit dem einen Unterschied, daß man überall auf die gelben Tangbüschel stößt. Aber nicht einmal ein Faltboot würde sich in diesen Tanghaufen festfahren können!
Über die Herkunft des Tangs sind sich die Gelehrten nicht einig. Die einen meinen, es stamme von den Küsten, die anderen glauben, es vermehre sich vegetativ im Meer und bekäme keinen Zuwachs durch abgerissenes Küstenkraut. Dann wäre das Sargasso-Kraut also wie eine Amöbe unsterblich; schon Kolumbus’ oder Drakes Schiffe könnten das Kraut gestreift haben, das ich gerade aus dem Wasser geholt hatte.
Seepferdmännchen in Wehen
Obwohl ich etwa zehn Netze voller Sargassokraut aus dem Wasser fischte, förderte ich kein Seepferdchen darin zu Tage. Dafür hatten wir aber schon auf mehreren Inseln kleine Seepferdchen als Andenken erworben. Man findet sie vor allem in ruhigen Gewässern, im Gras und im Tang. Es gibt an die 50 Gattungen, so groß wie ein kleiner Finger und länger als ein ausgewachsener Fuß.