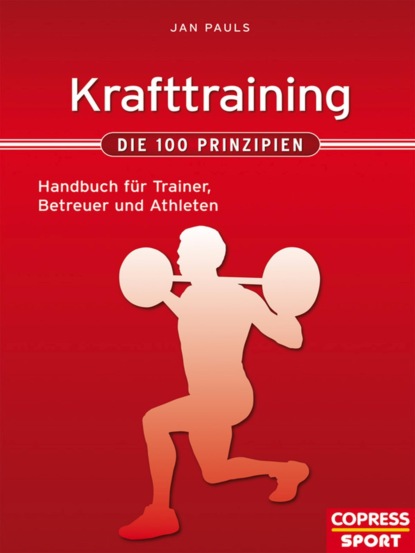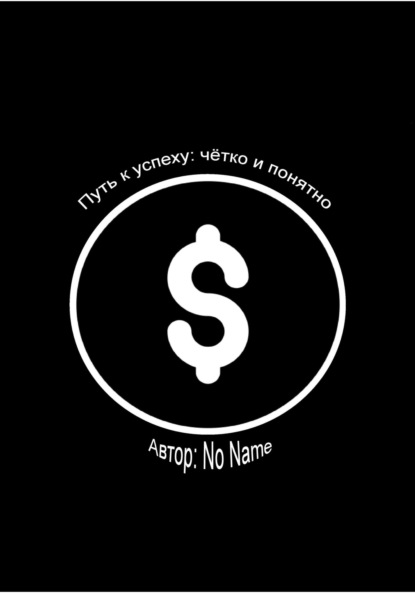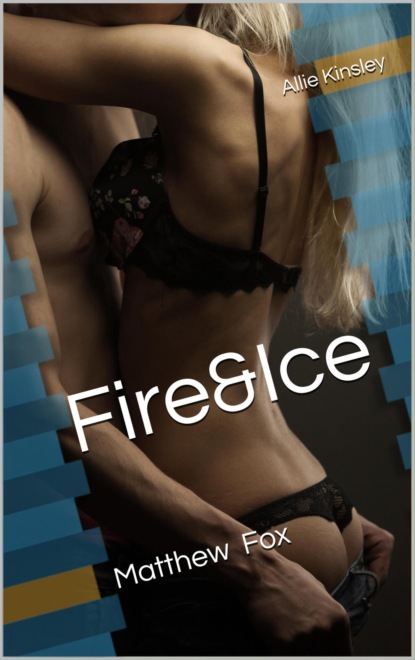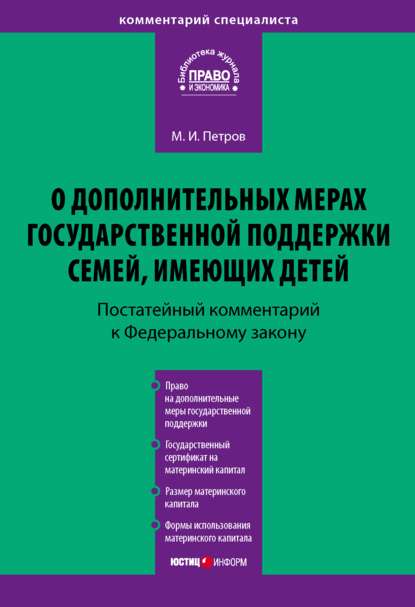- -
- 100%
- +








Das Prinzip, dass die Inhalte eines Trainings an der jeweiligen Zielsetzung ausgerichtet werden müssen, ist eine Grundvoraussetzung für jedes erfolgreiche Training und gilt in allen Sportarten. Wer schnell laufen will, muss das schnell Laufen üben. Wer im Fußball Tore erzielen will, muss ein Schusstraining absolvieren. Im Krafttraining gilt dieses Prinzip genauso. S.A.I.D. ist die Abkürzung für Specific Adaptation to Imposed Demands, was in der deutschen Übersetzung etwa »eine spezifische Anpassung an auferlegte Anforderungen« bedeutet.
Die Anforderungen an den Muskel im Training bewirken also ganz spezielle Veränderungen, die sich qualitativ und quantitativ sehr eng an dem orientieren, was der Muskel leisten musste. Wurden in der Übungseinheit die muskulären Energiespeicher entleert, wird der Muskel diese Energiespeicher nach dem Training wieder auffüllen und – sofern die Erschöpfung intensiv genug war – vorsorglich erweitern (Superkompensation). Fand diese Erschöpfung des Muskels gleichzeitig unter einer hohen Spannung statt, d. h. durch die Verwendung schwerer Gewichte, kommt es zusätzlich zu einer Vermehrung der Proteinstrukturen im Muskel, also zur Muskelhypertrophie. Wurden die Speicher unter geringen Lastbedingungen entleert, z. B. durch intensives Ausdauertraining (Laufen, Radfahren etc.), gibt es für den Muskel jedoch keinen Grund, seine krafterzeugenden Proteine zu vermehren, da keine hohe Kontraktionskraft abgefordert wurde, sondern lediglich eine hohe Umsatzrate an Energie.
Die Veränderungen im Muskel richten sich also nach der Art seiner Beanspruchung. Bei einem Muskeltraining mit sehr hohen Lasten (90– 100 % MVC), die nur wenige Wiederholungen zulassen und zur Steigerung der Maximalkraft dienen, verbessert sich vor allem die neuronale Ansteuerung der Muskulatur (intramuskuläre Koordination), wodurch der Muskel in die Lage gesetzt wird, eine hohe Kontraktionskraft zu erzeugen, indem er sehr viele Muskelfasern synchron aktiviert, und diese mit einer hohen Frequenz von Nervenimpulsen befeuert. Ein Muskelhypertrophie-Training bewirkt hingegen vor allem eine Vermehrung der krafterzeugenden Proteine sowie der Enzyme und Energieträger für eine anaerobe Glykolyse (Energiegewinnung ohne Sauerstoff).
Wer Krafttraining betreibt, muss sich also genau überlegen, welche Anpassungserscheinungen für seine Ziele erwünscht sind und muss dementsprechend sein Training gestalten. Wer stark werden will, muss mit hohen Gewichten trainieren. Wer Kraftausdauer braucht, muss seine Muskeln durch lange Serien und eine hohe Übersäuerung quälen. Das S.A.I.D.-Prinzip gilt insbesondere auch für die Bewegungstechniken. Die anspruchsvolle Technik des Reißens im Gewichtheben kann nur durch spezifische Übungen erlernt werden. Wer eine hohe Leistung in der Kniebeuge erreichen will, muss auch Kniebeugen trainieren. Es reicht nicht, sich regelmäßig an der Beinpresse zu quälen. Je koordinativ anspruchsvoller die Zielübung ist, in der eine Leistungsverbesserung erfolgen soll, desto enger müssen sich die Übungsformen an ihrem Bewegungs- und Beschleunigungsverlauf orientieren.
Das S.A.I.D.-Prinzip sagt aber nicht, dass es nutzlos ist, ergänzende Übungen durchzuführen. Die Forderung nach spezifischen Trainingsreizen schließt weniger spezifische Übungen nicht aus. Manche individuelle Schwachstelle benötigt ein isoliertes Training, auch wenn der Bewegungsablauf der Isolationsübung mit der eigentlichen Zielbewegung nicht in direkter Verbindung steht. Hat ein Sportler eine mangelhafte Rumpfstabilität, kann er diese mit isolierten Rumpfrotationen und Rückenstreckbewegungen an einer Maschine sehr wohl verbessern, da er in seinem spezifischen Übungsprogramm lernt, diese erhöhte, isoliert erworbene Rumpfkraft, für eine Leistungssteigerung nutzbar zu machen. Diese Aspekte werden oft übersehen, wenn Trainer sich darauf versteifen, nur in »funktionellen Bewegungsketten« arbeiten zu wollen und Isolationsübungen als »unfunktionell« ablehnen.
VERWEISE:






Das Prinzip der Individualisierung bedeutet, dass das sportliche Training in seinen Inhalten und Methoden an die speziellen Bedürfnisse und Eigenschaften des jeweiligen Sportlers angepasst werden muss. Nicht allein eine abstrakte Zielsetzung, z. B. Muskelaufbau oder Sprungkrafttraining, bestimmt den Trainingsplan. Vielmehr muss dieser in Einklang mit der Individualität des Trainierenden gebracht werden, um optimale Ergebnisse zu erzielen und eine Unter- oder Überforderung zu verhindern. Dieses Prinzip führt dazu, dass trotz gleicher Sportart und Zielsetzung ein Anfänger nach anderen Plänen trainiert als ein Fortgeschrittener, ein Fortgeschrittener wiederum nach anderen als ein Meister seiner Disziplin. Der Trainingsplan des Meisters würde den Anfänger völlig überfordern und Verletzungen, Überlastungsschäden und Frustration provozieren.
Im Kraftsport arbeitet das Grundlagentraining gegenüber dem speziellen Leistungstraining z. B. mit geringeren Lastintensitäten (40–60 % MVC statt 80–100 %), weniger Trainingseinheiten (2-mal statt 5- bis 6-mal pro Woche), anderen Organisations formen (Zirkeltraining statt Stationstraining) und anderen Übungen (»Hopserlauf« statt Tiefsprungtraining). Im Training mit Kindern und Jugendlichen sind sensible Wachstumsphasen gesondert zu berücksichtigen, da die Belastbarkeit des Bewegungsapparates herabgesetzt ist. Ebenso muss ihren entwicklungsbedingten kognitiven, psychischen und motivationalen Bedingungen Rechnung getragen werden. Im Training mit Senioren (> 60 Jahre) dominiert hingegen eine Rücksichtnahme auf die abnehmende Leistungs- und Anpassungsfähigkeit durch einen langsameren Stoffwechsel und veränderte Hormonspiegel sowie ggf. degenerative Erkrankungen des Bewegungsapparates.
Wichtige Einflussfaktoren einer individualisierten Trainingsplanung sind










Durch eine individuell angepasste Trainingsplanung werden im Rahmen der Gesetzmäßigkeiten der Trainingslehre die persönlichen Bedingungen des Sportlers, seine Stärken und Schwächen, berücksichtigt, um eine optimale Leistungsentwicklung zu ermöglichen. Je höher das Leistungsniveau und der Leistungsanspruch, desto enger wird der Rahmen, in dem individuelle Merkmale gegenüber den leistungsphysiologischen Gesetzmäßigkeiten den Trainingsprozess bestimmen. Dennoch entscheiden selbst auf höchster internationaler Ebene letztendlich auch die individuellen Merkmale über Sieg oder Niederlage.
VERWEISE:






Das Prinzip vom optimalen Verhältnis zwischen Belastung und Erholung ist grundlegend für den Trainingserfolg und Leistungsfortschritt in jeder Sportart. In der Erholungsphase nach der Belastung finden wesentliche Anpassungsvorgänge des Körpers statt und nur ein ausgeruhter Sportler kann seine maximale Leistung abrufen.

Ausreichende Erholungsphasen sind eine Voraussetzung für die optimale Umsetzung von Trainingsreizen.
Im Krafttraining ist es wichtig, dass nach der Belastung die Energiespeicher aufgefüllt und Proteinstrukturen neu aufgebaut werden. Ferner muss der Körper wieder ein Gleichgewicht in seinem Flüssigkeits- und Elektrolyt haushalt herstellen. Auch die psychische Erholung des Sportlers von der Überwindung und Willensanstrengung im Training (oder Wettkampf) ist zu berücksichtigen. Die für diese physiologischen und psychologischen Prozesse erforderliche Regenerationszeit hängt im Wesentlichen von der Intensität und Dauer der vorangegangenen Belastung sowie vom Trainingszustand des Athleten ab. Der Energieabbau ist bei hohen Trainingsumfängen besonders intensiv, der Proteinabbau bei hohen Intensitäten mit maximal möglicher Belastungsdauer. Findet keine ausreichende Erholung statt, wirken sich die Ermüdungsrückstände kurzfristig in Form einer Leistungsreduktion aus. Langfristig führt eine wiederholte unzureichende Regeneration zu einem Übertrainingszustand. Leistungsverlust, Müdigkeit und Trainings unlust können erste Symptome einer unzureichenden Regeneration sein. Zu einer optimalen Erholung gehört neben der Abwesenheit körperlicher Anstrengung eine gesunde, bedarfsgerechte Ernährung, ausreichender Flüssigkeits- und Elektrolytersatz, ausreichender Nachschlaf und psychische Entspannung. Leichte körperliche Aktivitäten sind nützlicher als vollständige Ruhe, da Stoffwechselprozesse gefördert werden. Warme Bäder, Duschen und Massagen wirken ebenfalls regenerationsfördernd. Für ein übliches Krafttraining werden Erholungszeiten von 48 Stunden als ausreichend angesehen. Ein hochintensives Krafttraining kann Erholungszeiten von bis zu 7 (selten 10) Tagen erfordern. Diese Zeiträume beziehen sich natürlich nur auf die zuvor belasteten Muskelgruppen. Die nachfolgende Tabelle zeigt mögliche Zeiträume für eine vollständige Wiederherstellung nach Krafttrainingseinheiten für die jeweils belasteten Muskelgruppen.
MethodeBeanspruchungZeitintervall zur nächsten gleichartigen Reizsetzung• Bewegungslernen,• Techniktrainingüberwiegend neuronal, gering metabolisch3–6 Stunden• extensives Kraftausdauertrainingmittelgradig metabolisch24 Stunden• intensives Kraftausdauertraining• moderates Hypertrophietraining• moderates Innervationstraining• moderates Sprungtrainingintensiv metabolisch, moderat strukturell, moderat neuronal48 Stunden• intensives Hypertrophietraining,• intensives Innervationstraining,• intensives Sprungtrainingintensiv metabolisch, intensiv strukturell, intensiv neuronal72–96 Stunden• High-Intensity-Training• hochintensives Sprungtraining (Tiefsprünge)hochgradig metabolisch, hochgradig strukturell> 96 Stunden bis 7 (10) TageEmpfohlene Regenerationszeiten bis zur nächsten gleichartigen Reizsetzung im Krafttraining
VERWEISE:






Das Prinzip der Kontinuität im Trainingsprozess sagt aus, dass nur ein regelmäßiges Training über einen langen Zeitraum einen großen und dauerhaften Leistungsgewinn ermöglicht. Gemäß dem Prinzip der Superkompensation kann in jeder Trainingseinheit ein Leistungszuwachs erzielt werden, der jedoch nur genutzt werden kann, wenn die nächste Trainingseinheit spätestens nach sechs bis zehn Tagen erfolgt, da ansonsten die Leistungsfähigkeit auf das Ausgangsniveau zurückfällt. Genauso verhält es sich auch im längerfristigen Trainingsaufbau. Verletzungen, unregelmäßiges Training und zu lange Pausen zwischen den Trainingseinheiten behindern einen Leistungsfortschritt bzw. führen zu einem Leistungsabfall. Auch das saisonale Training ist daher wenig effektiv. Dabei gilt das Prinzip »Wie gewonnen, so zerronnen«. Es bedeutet, dass in kurzer Zeit erworbene Leistungszuwächse sich auch schnell zurückentwickeln, wenn das Training ausgesetzt wird. Andersherum wird ein über Jahre erworbenes Leistungsniveau vom Körper selbst bei längeren Trainingspausen nur langsam absinken und lässt sich umso schneller wieder aufbauen.
Wer bereits lange trainiert hat, kann sich also trainingsfreie Phasen leisten, ohne empfindliche Leistungseinbußen fürchten zu müssen. Im Anfängertraining sind die Leistungsgewinne pro Zeiteinheit zwar sehr hoch, während der auf höchstem Niveau Trainierende um jeden weiteren Zuwachs hart kämpfen muss. Dafür verliert der Anfänger den Leistungsgewinn allerdings auch schnell wieder, wenn das Training nach wenigen Wochen bzw. Monaten abgebrochen wird. Im leistungsorientierten Krafttraining muss also das ganze Jahr über – im langfristigen Verlauf über Jahre hinweg – trainiert werden. Die Phasen höherer und geringerer Belastung werden dabei über das Prinzip der Periodisierung gesteuert.
Bei einem kontinuierlichen und gezielten Trainingsaufbau in Wettkampfsportarten durchläuft der Sportler zunächst das Grundlagentraining, dann das Aufbautraining. In diesen Abschnitten findet die Ausbildung allgemeiner technischer und konditioneller Grundlagen mit zunehmender Spezialisierung für die jeweilige Sportart statt. Im darauf folgenden Anschlusstraining wird durch eine vertiefte Spezialisierung die Phase des Hochleistungstrainings vorbereitet. Für das Erreichen der individuellen Höchstform können etwa 10–15 Jahre Training veranschlagt werden, d. h. 3–4 Jahre pro Entwicklungsstufe. Irgendwann erreicht der Trainierende die Grenzkraft, das heißt das höchste Kraftniveau, das ihm von seiner genetischen Veranlagung her möglich ist. Beim Kraftsportler (z. B. Kugelstoßer, Hammerwerfer, Gewichtheber, Bodybuilder) liegt das Alter der optimalen Leistungsfähigkeit zwischen Anfang und Ende 20. Höchstleistungen lassen sich in einigen Kraftsportarten allerdings auch bis weit in das vierte Lebensjahrzehnt noch erbringen.
Als Einstiegsalter für ein Krafttraining mit Zusatzlasten wie Langhanteln oder Kurzhanteln eignet sich die frühe Adoleszenz (15–16 Jahre), wobei die Besonderheiten der Belastbarkeit der im Wachstum befindlichen Jugendlichen berücksichtigt werden müssen. Im Leistungssport (z. B. Gewichtheben) wird häufig bereits in der Pubeszenz begonnen, d. h. mit 11–14 Jahren. Vorab sollte ein Kraftaufbau mit Technikübungen sowie einer spielerischen und gymnastischen Kräftigung erfolgt sein. Ein Krafttraining mit Kindern und Jugendlichen gehört immer unter die Aufsicht erfahrener Trainer.
VERWEISE:



Das Variationsprinzip ist ein sehr wichtiges Prinzip im Krafttraining, das besagt, dass Trainingsreize in regelmäßigen Abständen verändert werden müssen, um weitere Fortschritte zu ermöglichen. Es ist allerdings ein häufig missachtetes Prinzip, da viele Trainierende ihr gleiches Programm monatelang einfach herunterspulen und ineffizient trainieren. Am häufigsten werden im Trainingsprozess die Gewichte verändert, was zumindest dem Prinzip der progressiv ansteigenden Belastung entspricht.
Die Forderung des Variationsprinzips geht jedoch wesentlich weiter und fordert eine regelmäßige Veränderung der Übungsauswahl, Übungsreihenfolge, Trainingsintensität und des Belastungsumfangs (Anzahl der Serien und Wiederholungen). Auch die Reizdichte kann variiert werden, indem man z. B. Serienpausen verkürzt oder mehr Trainingseinheiten in einer Woche absolviert als üblich. Durch diese Variationen zwingt man den Körper, sich ständig an die neuen Belastungsreize anzupassen, wodurch eine Leistungs stagnation durch Gewöhnung verhindert wird. Insbesondere beim fortgeschrittenen Kraftathleten sind Variationen unverzichtbar, um weitere Veränderungen herbeizuführen.
Neben dem Leistungsaspekt verhindert die Variation von Trainingsinhalten auch die Langeweile im Training, was für die Aufrechterhaltung der Motivation unabdingbar ist. Die Trainingsmonotonie kann neben dem Ausbleiben von erhofften Trainingserfolgen gerade im Breitensport ein wichtiger Grund sein, warum Trainierende ihre Mitgliedschaft in einer Trainingsinstitution kündigen. Ein weiterer Aspekt eines variationsreichen Trainings ist die Verhinderung einer einseitigen Ausbildung der Muskulatur. Wer immer nur die gleichen 10 Übungen macht, vernachlässigt in der Regel bestimmte Gelenkwinkelpositionen und Muskelgruppen und fördert dadurch unter Umständen muskuläre Ungleichgewichte oder provoziert Überlastungssyndrome. Für einen Bodybuilder ist es besonders wichtig, die Gesamtheit der körperformenden Muskeln zu trainieren, wodurch in diesem Sport auch eine enorme Übungsvielfalt notwendig ist. Viele Argumente sprechen also für die regelmäßige Umstellung von Trainingsplänen.
Wenn man nicht als Leistungssportler ohnehin schon einen gut durchdachten Periodisierungsplan absolviert, sollte man als Krafttrainierender spätestens alle drei Monate deutliche Veränderungen im Trainingsplan vornehmen. Ein Abstand von 6–8 Wochen ist, insbesondere bei fortgeschrittenen »Eisensportlern« noch günstiger, da diese die neuen Reize schneller verarbeiten als Neuanfänger und entsprechend schneller eine Gewöhnung eintritt. Die einfachste Art der Variation ist der Austausch von Übungen: Wenn bislang die Oberschenkel an den Maschinen Beinpresse, Beinbeuger und Beinstrecker trainiert wurden, kann man diese Übungen durch Nackenkniebeugen (mit Langhantel), Kreuzheben mit fast gestreckten Beinen und einen Leg-Kick am Seilzug (einbeiniges Beinstrecken im Stehen bei angebeugtem Hüftgelenk) austauschen. Wenn der breite Rückenmuskel (Latissimus) bislang mit Latissimus-Ziehen am Seilzug und Rudern an einer Rudermaschine trainiert wurde, setzt man neue Reize durch Klimmzüge im Untergriff oder Pull-Downs mit gestreckten Armen am Seilzug in Oberkörpervorneige.
Eine Variation der Trainingsintensität kann über eine verminderte (oder erhöhte) Wiederholungszahl erreicht werden, wenn bis zum Ermüdungsabbruch der Serie trainiert wird. Dazu führe man z. B. statt der üblichen 10–12 Wiederholungen nur 6 durch, wodurch die Gewichtslast deutlich steigt und neue Reize auf das Nerv-Muskel-System einwirken. Intensivierungstechniken zur Serienverlängerung und ein High-Intensity-Training, sind ebenfalls eine hervorragende Möglichkeit zur Variation, da der Belastungsumfang wechselt (weniger Serien) aber dennoch intensive, neue Reize auf das gesamte Faserspektrum des Muskels und dessen Stoffwechsellage ermöglicht werden. Eine Sonderform des Variationsprinzips ist das Schockprinzip.
VERWEISE: